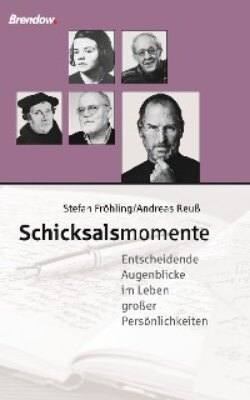Читать книгу Schicksalsmomente - Stefan Fröhling - Страница 14
Geistesgeschichtliche Situation in spätrömischer Zeit
ОглавлениеBei dem Begründer dieser Sekte, Mani (216 – 276), handelt es sich um eine typische Gestalt der Geistesgeschichte des Römischen Reichs in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt. Er mischte aus allen möglichen Strömungen seine Überzeugungen und Kulte zusammen. Aber auch das Christentum war ursprünglich ein religiöser „Schmelztiegel“, ein sogenanntes „synkretistisches Phänomen“51, wie es der Theologe Rudolf Bultmann bezeichnete: Verschiedenste Kulte, Religionen, religiöse Strömungen oder philosophische Lehren wurden in das Glaubenssystem einbezogen oder im Zusammenhang damit diskutiert. In der Spätphase des Römischen Reichs stand alles zur Frage, keine Orientierung war mehr unangefochten vorherrschend – im Grunde wie hierzulande seit 1989, seit dem (auch ideologischen) Ende des Ost-West-Konflikts.
Ganz am Anfang hatten die ersten Christen auf die Frage, „Woran glaubt ihr eigentlich?“, als Antwort vor allem eine kurze Geschichte parat, die sich im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth erhalten hat: „Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien erst dem Kephas, dann den Zwölf.“ (15,3 ff).
Damit unterschied sich das Christentum freilich von „synkretistischen Sekten“: Auf der Basis einer sehr alten Tradition mit einem tief durchdachten Gottesbild, nämlich dem der jüdischen Schriften („der Schrift“) – selbst von alten Hochkulturen geprägt –, wurde diese Ur-Geschichte über Jesus in der Auseinandersetzung vor allem mit der griechischen Philosophie immer weiter ausgeprägt, und zwar bis zum heutigen Tag. Bis heute arbeiten Theologen wissenschaftlich an der Vertiefung der christlichen Lehre, indem sie Gedankengänge aus Geschichte und Gegenwart aufnehmen bzw. verwerfen. Dass diese Auseinandersetzung nicht nur durch das kirchliche Lehramt, sondern auch durch die theologische Wissenschaft geführt wird, macht wohl die faszinierende geistige Tiefe dieser Weltreligion aus. Selbst den Theologen Joseph Ratzinger reizt es nach wie vor, sich an dieser globalen theologisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu beteiligen, und er brachte bis 2012 unter anderem drei Bände über Jesus Christus heraus, auch nachdem er 2005 zum Papst gewählt worden war und sich Benedikt XVI. nannte (2013 zurückgetreten).
Weil das theologisch-wissenschaftliche Denken im Christentum einen solch hohen Stellenwert einnimmt, verehrt oder schätzt man tiefsinnige christliche Denker. Als die bedeutendsten Theologen auf dem Weg des Christentums durch die Zeiten gelten die sogenannten „Kirchenväter“, zu denen Augustinus vorrangig gehört.
Augustinus war jedoch anfangs nicht einmal getauft, führte in seinen ersten Studienjahren ein ausschweifendes Leben und diente seinem von ihm so genannten „Selbstgefühl“. Dann gab ihm das erwähnte Buch Ciceros eine neue Richtung für seinen Lebensweg, die ihn zunächst zu den Manichäern führte. Also war auch er, Augustinus, zunächst eine typische Erscheinung des „synkretistischen Schmelztiegels“ in der Spätzeit des Römischen Reiches?
Zur Beantwortung dieser Frage muss man seinen weiteren Lebensweg verfolgen. Um das Jahr 374 ging er wieder nach Thagaste, aber nicht mehr als Schüler, sondern diesmal als Lehrer der Grammatik und Rhetorik. Jahre später, 389, erschien Augustinus’ nach wie vor lesenswerte Schrift „De magistro“ („Über den Lehrer“) in der er den Lehrer als Anreger zeigt, die menschliche Disposition der Seele wahrzunehmen und zu entwickeln – und das ist von der Sicht eines Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) gar nicht so weit entfernt.52
Ein Jahr darauf ließ er sich in Karthago nieder. Hier wuchsen mit den Jahren die inneren Zweifel am „manichäischen System“53, die nicht einmal nach seinem Umzug nach Rom 383 ausgeräumt waren. Aber er blieb in Beziehung zu Freunden, „die von der manichäischen Torheit trunken waren“54 und erhielt 384 eine bedeutende Stelle als Magister der Rhetorik in Mailand.