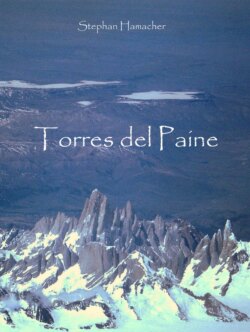Читать книгу Torres del Paine - Stephan Hamacher - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das stille Auge
ОглавлениеNach all dem Getöse und Glamour und Glitzer der Ginza, nach all dem pyrotechnischen Paraden und dem ohrenbetäubenden Lärm sehnt sich Ayumi nach Ruhe und Frieden, nach Stille und der Abwesenheit aller schnellen Bewegungen, nach Sonne nach dem Neon, nach Offenheit nach der Enge der Häuserschluchten. Die Ginza strahlt auch ohne Silvesternächte heller als Las Vegas und der Times Square zusammen, doch die Flut an Reizen war für Ayumi zur Sintflut geworden, und nun sucht sie die Abgeschiedenheit in den östlichen Gärten.
Die größte Stadt der Welt ist ein dichter Wald aus Glas, Stein und Beton. Das Zentrum jedoch rund um den Kaiserpalast ist eine ebene grüne Oase, eine streng geordnete und dennoch bisweilen freundliche Lichtung der Meditation inmitten einer brausenden brodelnden Wüste zwischen Mächten, Märkten und Moden mit Menschenmassen, Menschen, die sich scheinbar zügel- und ziellos wie durch einen Ameisenhaufen bewegten. Zweimal im Jahr, zum Kaisergeburtstag am 23. Dezember und zu Neujahr am 2. Januar, werden die Pforten des Palastes geöffnet. Ayumi blickt über die weite Grünfläche, über die Bäume hinweg, die wie Zedern aussehen, Ayumi kennt sich mit Bäumen nicht so aus, auf die Häuserwand am Rasenrand, die aussieht, als beherberge sie nichts als Firmensitze, Banken und Büros. Ayumi kennt sich mit Häusern nicht so aus. Es sind Häuser aus Glas und Beton, rostrote, gelbe, graue, blaue Häuser, wie sie auch in Cincinatti oder Manchester stehen könnten.
Andere Städte haben ein Denkmal oder architektonische Kronjuwelen als ihre Prunkmitte, eine Kathedrale, ein Parlament, einen Triumphbogen. Dieses sterile urbane Monstrum hat das große Nichts als Zentrum auserkoren, das stille Auge inmitten eines Orkans. Eine Grünfläche, so groß wie ein Kleinstaat, und doch sind diese Gärten nicht der Central Park und auch kein Prachtfriedhof für Städte aus Patina mit toten Menschen, deren Ruhm das einzig Überirdische ist, was von ihnen bleibt. Anders als in New York liegen diese Anlagen wirklich mitten in der Stadt, und anders als in Manhattan ist dies keine reine Stätte zur Regeneration alltagsgeplagter Großstadtwesen. Und es ist eben auch keine Nekropole mit dem nanokristallinem Hydroxylapatit edler Verblichener, wie sie die schattigen Ecken von Städten wie Wien, Hamburg oder Paris ziert.
Die kalte Winterluft tut gut, und die Sonne von einem nackten blassblauen Himmel wärmt nur mäßig. Ayumi trägt eine Daunenjacke und Handschuhe, sie genießt die Schritte auf dem gefrorenen Grund, der immer noch grün ist, weil kein Schnee liegt. Und sie genießt ihr Alleinsein inmitten eines überdimensionierten Freiluftareals, so fern vom Schweiß in den Untergrundbahnen und den Essensgerüchen in Asakusa. Dort, zwischen dem alten und dem neuen Asakusa, ist Ayumi aufgewachsen, ein Einzelkind vom Ufer des breiten kurzen Sumida, lange bevor der sich in die Bucht ergießt. Rechts auf der anderen Flussseite der nüchterne Quader der Asahi-Brauerei mit dem weithin sichtbaren Flammenornament von Philippe Starck auf dem Dach. ein Gruß über die Ufer, links der mächtige buddhistische Kannon Tempel Sens?ji mit seinen leuchtend roten Säulenornamenten, den übermannshoghen Lampions und der schattigen Ladenzeile mit den Kitschsouvenirständen. Dazwischen die Nudelsuppenküchen und, erstmals überhaupt und erst seit ein paar Jahren, die fragilen Zelte, Plastiktüten und Decken der Obdachlosen unter den Brücken, wie es sich gehört, am Uferrand, also am Rand des Rands. Die hässlichen Aushängeschilder einer Wirtschaftskrise und der daraus folgenden Deflation.
Ayumis Leben ist größtenteils kleinteilig. Sie bewegt sich mit der Tokyo Metro Ginza Line oder dem Flussboot, seltener mit dem Bus oder dem Taxi. Mittags isst sie je nach Hunger ein bis zu zwölfteiliges Bento, abends kehrt sie zwischen den Quadraten der Hochhäuser in ihre kleine viereckige Wohnung zurück und schaut Werbung auf der rechteckigen Mattscheibe mit den grellen Bildern der NHK. Manchmal besucht sie mit Arbeitskollegen ein Restaurant, danach den angeschlossenen Karaoke-Saal. Sie hat noch nie in einem Ryokan übernachtet und mag amerikanische Burger aus Billigketten. Auch die kommen über die Theke in eckigen Faltschachteln. Bei den seltenen Gelegenheiten, in denen Ayumi Gast in einem Hotel war, anlässlich der Geburtstage oder Hochzeiten von Bekannten, wählte sie immer die westliche Seite des Büffets.
Ayumi denkt überwiegend quadratisch, sie arbeitet im Mitsukoshi, meist an der Theke mit den sündhaft teuren würfelförmigen Melonen. Das Mitsukoshi sieht aus wie eine Kreuzung aus Waldorf Astoria und Woolworth und ist das bekannteste Kaufhaus der Stadt, und bis heute weiß Ayumi nicht, warum das so ist. Manchmal, wenn ihr das Leben allzu quadratisch erscheint und sie ein paar Stunden zu erübrigen hat, dann lässt sie sich zum Rathaus und dort mit dem Aufzug in zweihundert Meter Höhe fahren. Der Aufzug und der Ausblick sind kostenlos. An guten klaren Tagen sieht man von hier oben etwas ganz und gar nicht Quadratisches, eher etwas Dreieckiges, unten blau und oben weiß, das ist der schönste Berg der Welt, der perfekte Berg, der Fuji-san mit seiner Schneekappe, ein Kegel mit der anmutigsten Symmetrie, die je in einem Kopf Raum einnehmen kann. Einmal, das ist lange her, ist Ayumi nach Hakone gefahren, um den Fuji-san aus der Nähe zu betrachten, mitsamt den Kratern und dem Müll an seinen Flanken. Selbst hinaufsteigen wollte sie nicht, dazu fehlten die Zeit und die Zielstrebigkeit, ein Anlass und die Motivation. Es hätte ihr vollkommen genügt, den Vulkan zu sehen, erkennen, wahrzunehmen, vielleicht eine Weile zu studieren, doch der Ausflug an den Ashi-See wurde zu einer einzigen Enttäuschung. Der Meister aller Berge hatte sich hinter einer dicken Nebelwand versteckt, und in der Nacht fing es an zu nieseln, dann zog auch noch ein monströses Gewitter auf. Ein reinigendes Gewitter: Hätte Ayumi auch nur einen Tag länger und ein paar Stunden mehr Zeit gehabt, sie hätte einen zauberhaften Fuji-san mit frischer Schneedecke vor einem marinefarbenen Himmel gesehen, doch so blieb ihr der Anblick versagt, und sie musste sich weiterhin mit den wolkenlosen klaren Wintertagen im Rathaus begnügen. Die Chancen, den Fuji in seiner vollkommenen Pracht zu sehen, stehen ohnehin nur dreißig zu siebzig, wo bei dreißig die Zahl ist, die die positive Seite dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung ausdrückt.
Ayumi war noch nie im Ausland, nicht einmal in Korea. Sie war auch noch nie aus Honshu herausgekommen. Einmal hätte es fast geklappt, zur Beerdigung ihrer Großmutter mütterlicherseits auf Hokkaido, doch da war ihr eine schwere Grippe dazwischengekommen. Seit Hakone hatte Ayumi die Kant?-Ebene nicht mehr verlassen, ein Umstand, dem sie nicht allzu viel Bedeutung beimisst, schon gar nicht Fernweh oder auch nur einen Seufzer. Ayumi mag ihre Quadrate, die Vierecke und die Rechtecke der Architektur, der Straßenzüge, Parkanlagen und der Melonenwürfel, sie liebt den Anblick des Dreiecks in der Ferne vom fünfundvierzigsten Stock des T?ky?-to Ch?sha in Shinjuku, und sie mag das Intermezzo der Farben in all diesem Grau, die Mode in Shibuya, die Blumen, das flirrende Neon von Ch??. Sie mag auch die runden Formen, vielleicht, weil sie so selten sind und ihr daher besonders auffallen. Ayumi mag Kinder, auch wenn sie keine eigenen hat. Bald wird sie sechsund-zwanzig, und ihre Eltern meinen, gleuben, wissen, drängen, dass es an der Zeit ist, einen passenden Mann zu finden. Doch das ist nicht an der Zeit, das hat noch Zeit, findet Ayumi. Sie ist keine, die sucht, sie ist eine, die findet. Wie alle ist Ayumi mit zwei Religionen aufgewachsen, dem Shintoismus und dem Buddhismus, mit dem Tod und dem Leben. Vielleicht ist es auch umgekehrt: mit dem Leben und dem Tod, je nachdem, was zuerst kommt. Aber daran verschwendet Ayumi nicht einmal halb so viele Gedanken wie an den Preis von gewürfelten Melonen oder eingelegten Nashi-Birnen. Den Tod hat sie bislang nur im Museum gesehen, im Friedenspark von Hiroshima. Damals war sie noch Schülerin, und die Reise war eine Klassenfahrt gewesen. In dunklen Räumen waren geschmolzene Uhren und verbrannte Kleidung ausgestellt - Rückstände menschlichen Atmens, ausgelöscht durch die Atombombe. Irgendwer hatte irgendwann einmal behauptet, dass nach der Detonation der Bombe am 6. August 1945 kein Grashalm mehr wachsen würde in und um Hiroshima. Ayumi hatte sich damals über all das Grün gewundert, über das Leben an den Ufern von gleich sechs Flussarmen, die sich Richtung Seto-Inlandsee erstreckten, über die Menschen, die ihr viel lässiger und gelassener erschienen als all die Leute zwischen Adachi und Yokohama. Und dann war sie noch auf Miyajima gewesen, hatte das leuchtend orange Torii bewundert und den Zyklus von Ebbe und Flut. Der Schrein ist einer der belkiebtesten und teuersten Orte für traditionelle Hochzeiten, und so oder so wird Ayumi, falls sie denn einmal heiratet, nie in Miyajima ihr Gelübde ablegen.
Manchmal ergattert man zu Neujahr von den östlichen Gärten einen Blick auf den Tenn? und dessen Familie, aber darauf hat es Ayumi nicht abgesehen. Sie betritt die steinerne Brücke und schaut dem Treiben zu. Dann geht sie durch das Tor Nishi-no-maru ?te-mon, überquert die eiserne Brücke und steht vor dem, was einst die Burg Edo gewesen war und nunmehr nichts als eine Replik ist, nach einem Brand und vielen Bomben und noch mehr Irrungen und Wirrungen der Geschichte, einer Geschichte, in der sich Ayumi nicht besonders gut auskennt. Was Ayumi mag, ist den Menschen dabei zuzusehen, wie sie Menschen zusehen. Das gibt ihr ein langsames Glücksgefühl, und das gibt ihr eine Ruhe und Freude, die zu beschreiben sie sich nicht in der Lage sieht. Aber Ayumi betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, Dinge zu beschreiben, und da sie weiß, dass sie Dinge nicht beschreiben kann, versucht sie erst gar nicht, Gefühle zu beschreiben. Denn Gefühle zu beschreiben, so viel weiß Ayumi, ist wesentlich schwieriger als Dinge zu beschreiben.