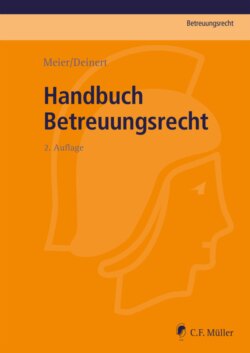Читать книгу Handbuch Betreuungsrecht - Sybille M. Meier - Страница 75
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеB. Das gerichtliche Verfahren bis zur Bestellung eines Betreuers › VII. Das Sachverständigengutachten › 9. Bekanntgabe des Sachverständigengutachtens
9. Bekanntgabe des Sachverständigengutachtens
187
Sachverständigengutachten sind der betroffenen Person vor der richterlichen Anhörung kostenfrei, vollständig, schriftlich und rechtzeitig zugänglich zu machen.[1] Dies folgt bereits aus Art. 103 Abs. 1 GG.[2] Die Übersendung des Gutachtens an den Verfahrenspfleger allein genügt nicht.[3] Ein rechtsstaatliches Verfahren verlangt, dass keine wesentlichen Entscheidungen hinter dem Rücken der betroffenen Person gefällt werden. Der Zweck der vorherigen Bekanntgabe des Sachverständigengutachtens an den Betroffenen besteht darin, diesen vor gerichtlichen Überraschungsentscheidungen zu schützen.
188
Beispiel
Die für Doris Z. zuständige Amtsrichterin führt im Rahmen eines anhängigen Betreuungsverfahrens im Krankenhaus einen Anhörungstermin durch. Bei dieser Gelegenheit erläutert sie Frau Z. im Groben den Inhalt des bereits seit längerem vorliegenden Sachverständigengutachtens, welches Frau Z. nicht übersandt wurde. Die Vorgehensweise der Amtsrichterin ist verfahrensfehlerhaft. Eine mündliche Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des Gutachtens oder aber eine Zusammenfassung reicht nicht.
189
Von einer Bekanntgabe des Sachverständigengutachtens kann nur dann abgesehen werden, wenn zu befürchten steht, es könne hierdurch zu einer Gesundheitsgefährdung des Betroffenen kommen oder wenn dieser nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichtes offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun, § 288 Abs. 2 FamFG.[4] In einem solchen Fall ist dann jedoch stets erforderlich, einen Verfahrenspfleger zu Gunsten des Betroffenen zu bestellen, worauf im Weiteren noch einzugehen sein wird.[5]
190
Checkliste Überprüfung einer Sachverständigengutachtens
Für die Überprüfung eines Sachverständigengutachtens empfiehlt sich folgende Checkliste:
| 1. | Hat der ernannte Sachverständige verantwortlich unterzeichnet? |
| 2. | Sind alle Fragen aus der Beweisanordnung beantwortet worden? – Soweit keine ausdrückliche Beantwortung erfolgt ist: Ist dies aus der Beantwortung der anderen Beweisfragen begründet? |
| 3. | Sind die persönlichen Daten des Betroffenen richtig wiedergegeben? |
| 4. | Wurde die soziale und gesundheitliche Anamnese richtig und vollständig erhoben? |
| 5. | Berücksichtigt die gesundheitliche Anamnese die relevanten Angaben des Betroffenen/seines sozialen Umfelds, seines Hausarztes, behandelnder Ärzte und Krankenhäuser? |
| 6. | Ist der wesentliche Akteninhalt richtig erfasst? |
| 7. | Ist die herrschende medizinische Lehrmeinung mitgeteilt und vom Sachverständigen bei der Beantwortung der Beweisfragen zu Grunde gelegt worden? Wird eine verbindliche klinische Diagnose angegeben? |
| 8. | Sind die danach notwendigen Untersuchungen durchgeführt worden? Wurden Untersuchungsmethoden unbegründet ausgelassen, wie z.B. körperliche und neurologische Untersuchungen? Wurde auf Untersuchungsmethoden verzichtet, die eigentlich angebracht waren, wie z.B. psychologische Testung bei Minderbegabung, bildgebende Verfahren bei Demenz (z.B. Uhrentest, DemTec-Test, MMST-test?[6] |
| 9. | Sind die Antworten des Sachverständigen schlüssig (aus Befunden und herrschender Lehrmeinung) hergeleitet worden? Ist der psychische Befund oberflächlich und schematisch geschildert? Wurden diagnostische Begriffe wie z.B. Neurose, Persönlichkeitsstörung etc. zutreffend angewandt? Wurden Befunde/Zeugenaussagen erörtert, die nicht ins Bild passen? Wurde Widersprüchen nachgegangen? Wurden angezeigte therapeutische, respektive prognostische Überlegungen angestellt? Wurden differentialdiagnostische Schwierigkeiten übersehen? |
| 10. | Hat der Sachverständige seine Fachgebietsgrenzen überschritten? Liegt ausreichendes Wissen über den gesetzlichen Hintergrund der Fragestellung vor? Liegen Subsumtionsfehler bei der Anwendung juristischer Krankheitsbegriffe vor? |
191
Ohnehin kann nicht genug betont werden, dass das anwaltliche Vorgehen bei einer bereits vorhandenen negativen Begutachtung des eigenen Mandanten von hoher Sorgfalt geprägt sein muss. Die Gutachten sind in der Regel verfahrensentscheidend, und gelingt es nicht, das Gericht von Fehlern in der Begutachtung durch eine qualitativ gute Argumentation zu überzeugen, so wird es unausweichlich zu einer Betreuungsanordnung kommen.
192
Checkliste Einholen eines Sachverständigengutachtens
| 1. | Welche Qualifikation hat der Sachverständige? Wies der Sachverständige auf seine fehlende Schweigepflicht hin vor der Begutachtung? |
| 2. | Wurde die Person des Sachverständigen dem Betroffenen zuvor bekanntgegeben? |
| 3. | Liegen Ablehnungsgründe bezüglich des Sachverständigen vor? |
| 4. | Wurde zur Gutachtenvorbereitung ein richterlicher Beweisbeschluss erlassen? |
| 5. | Wurde das Sachverständigengutachten dem Betroffenen vollständig, schriftlich und rechtzeitig übermittelt? |
| 6. | Wurde das Gutachten durch den Richter sorgfältig und kritisch geprüft? |
| 7. | Weist das Gutachten Mängel auf, siehe vorstehende Checkliste? |
| 8. | Falls kein Psychiater mit der Gutachtenerstellung beauftragt wurde: Erläuterte das Gericht dessen Sachkunde im Beschluss? |
193
Es kann für einen Anwalt sinnvoll sein, dem Mandanten anzuempfehlen, ein Privatgutachten auf zunächst eigene Kosten einzuholen. In Sozialgerichtsverfahren und in Arzthaftungssachen handelt es sich hierbei um ein übliches Vorgehen, vgl. § 109 SGG. Der Inhalt des Privatgutachtens sollte von einer kritischen Auseinandersetzung mit den Vorbefunden und dem Gerichtsgutachten mit den Mitteln der medizinischen Wissenschaft geprägt sein. Dem Privatgutachter ist zur Vorbereitung seines Gutachtens das Gerichtsgutachten zur Verfügung zu stellen. Das BSG und der BGH qualifizieren Privatgutachten als von besonderer Sachkunde getragenes Parteivorbringen.[7] Das Gericht ist von Amts wegen verpflichtet, Widersprüche zwischen dem Privatgutachten und dem Gerichtsgutachten aufzuklären.[8] Der Anwalt sollte dem Privatgutachter in einem Anschreiben die abweichenden Auffassungen des Mandanten beschreiben. Die Vergütung des Privatgutachters erfolgt nach § 631 BGB, nicht nach dem JVEG. Trug das Privatgutachten zur Klärung des Sachverhalts bei, ist ein Kostenantrag zu stellen. Bei Beeinflussung der Entscheidung tritt Erstattungspflicht ein.[9]
194
Der Anwalt ist verpflichtet, die Einwendungen gegen das Sachverständigengutachten zeitnah zu formulieren, § 411 Abs. 4 ZPO. Bei Unklarheiten, Ungereimtheiten im Gutachten ist ein Antrag auf Ladung des Sachverständigen zur Erläuterung seines Gutachten zu stellen, §§ 397 Abs. 2, 402, 411 Abs. 3 ZPO. Die frühere Rechtsprechung dahingehend, der Antragsteller müsse sachdienliche Fragestellungen ankündigen, andernfalls das Gericht die Ladung des Sachverständigen ablehnen könne, ist verfassungsrechtlich nicht haltbar und verstößt gegen das Recht auf rechtliches Gehör, Art. 103 GG.[10] Das Gericht kann allenfalls wegen Verfahrensverschleppung bzw. Rechtsmissbrauch einen Ladungsantrag des Sachverständigen ablehnen. Die verfassungsrechtlichen Hürden hierfür sind freilich hoch.
195
Im Termin, in dem der Sachverständige sein Gutachten erläutert, ist seitens des Anwalts auf Folgendes zu achten:
| – | Wie gut ist der Sachverständige auf den Termin vorbereitet? Hat der Sachverständige Unterlagen dabei, anhand deren die Erläuterung erfolgt? |
| – | Sind die Erläuterungen verständlich oder flüchtet sich der Sachverständige in ein „Fachchinesisch“? |
| – | Wie reagiert der Sachverständige auf Vorhalte? Verärgerte, ungehaltene Reaktionen deuten auf fehlende Souveränität des Sachverständigen hin. |
| – | Achtet der Sachverständige auf eine präzise Protokollierung seiner Aussagen durch den Richter? |
196
Vorgehen nach der Sachverständigenanhörung:
| – | Antrag auf schriftsätzliche Stellungnahme zur Beweisaufnahme |
| – | Antrag auf Unverwertbarkeit von Gutachten, bei denen der Akteninhalt dem Sachverständigen nicht bekannt war. |