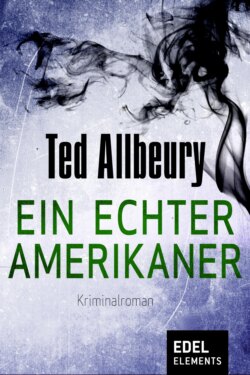Читать книгу Ein echter Amerikaner - Ted Allbeury - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NEUNTES KAPITEL
ОглавлениеAm 22. Juni 1941, einem Sonntag, überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Tags darauf erhielt Malloy einen Anruf von Hancox.
»Mister Malloy, hätten Sie heute nachmittag vielleicht ein paar Minuten für mich Zeit? Wir könnten uns irgendwo treffen, wo es Ihnen paßt, aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nach Manhattan kommen könnten.«
»Meine Frau und ich wollen uns heute abend Citizen Kane ansehen. Die zweite Vorstellung beginnt um halb neun. Das Kino ist unmittelbar am Times Square.«
»Wie wär’s, wenn wir uns um sechs an der Bar im Waldorf treffen? Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie bitte, eine halbe Stunde mit mir unter vier Augen zu sprechen?«
»Ich nehme an, Kathy ist das ganz recht. Okay, um sechs Uhr an der Bar.«
Hancox erwartete ihn bereits. Während Malloy sich setzte, winkte er einem Kellner. »Was möchten Sie?«
»Scotch mit Eis, bitte.«
»Zweimal«, sagte Hancox zu dem Kellner.
»Sind Sie sehr beschäftigt bei der Gewerkschaft?«
»Allmählich komme ich voran, aber es gibt immer viel zu tun.«
Der Kellner brachte die Getränke, und Hancox übernahm die Rechnung. »Was halten Sie vom Krieg in Europa?« sagte er, als er gezahlt hatte.
Malloy zuckte die Achseln. »Meiner Ansicht nach ist da noch gar nichts entschieden. Ich hoffe nur, Roosevelt zieht uns da nicht rein.«
»Warum?«
»Der Krieg geht uns nichts an.«
»Auch nicht, wenn ihn die Nazis gewinnen?«
Malloy runzelte die Stirn, gleichzeitig aber lächelte er. »Was soll das? Wollen Sie mich etwa auf die Probe stellen?«
»Wir werden in diesen Krieg hineingezogen werden, Malloy, ob es uns paßt oder nicht. Deswegen wollte ich mit Ihnen reden.« Er hielt kurz inne. »Können Sie mir versprechen, daß dieses Gespräch unter uns bleibt? Erzählen Sie niemandem davon. Nicht einmal Ihrer Frau.«
»Klar.«
»Kennen Sie sich eigentlich in Washington aus?«
»Nicht besonders.« Malloy lächelte. »Ich war auf Studienreise dort, und einmal habe ich zwei Tage lang im Kongreß recherchiert.«
»Was waren das für Recherchen?«
»Ich habe nachgeschlagen, wie hoch das durchschnittliche Einkommen eines Staatsanwalts in den einzelnen Bundesstaaten ist.«
Hancox lächelte kurz. »Haben Sie schon mal etwas von einem Verein namens COI gehört?«
Malloy schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Oder dem SPI?«
»Nein.«
»Langweilt Sie die Arbeit bei der Gewerkschaft?«
»Ein bißchen. Vieles wiederholt sich. Ich habe meinem alten Herrn versprochen, daß ich zwei Jahre bleibe und dann meinen eigenen Weg gehe und mich bei einer Anwaltskanzlei bewerbe.«
»Und wie lange ist es noch bis dahin?«
Malloy lachte. »Zwei Monate und drei Tage.«
»Was hielten Sie von einer Mitarbeit bei einer Spezialabteilung der Regierung?«
»Geht es um juristische Arbeit?«
»Nein. Juristische Vorkenntnisse wären allenfalls eine gute Voraussetzung.«
»Und warum gerade ich?«
»Das werde ich Ihnen später sagen.«
»Worum geht es? Wieso diese Geheimnistuerei?«
»Ich bin nicht befugt, Ihnen mehr zu verraten. Ich kann Ihnen lediglich sagen, daß alles heimlich, still und leise vor sich geht und daß es eine große Ehre ist, wenn einem die Aufnahme angetragen wird.«
»Gehören Sie dazu?«
»Nein. Man hat mich gebeten, passende Leute zu suchen, die für ein Sondierungsgespräch in Frage kommen. Ich habe Ihren Namen genannt. Man hat Ihren Werdegang unter die Lupe genommen und möchte gern mit Ihnen reden. Sie ein bißchen auf die Probe stellen.«
»Das klingt ja so, als ginge es um Geheimdienstarbeit.«
»Sie müßten sich drei Tage freinehmen – für die Sondierungsgespräche.« Hancox stockte. »Möchten Sie darüber nachdenken?«
Malloy schüttelte den Kopf. »Nein. Wann soll ich nach Washington fahren?«
»Ich werde bei Ihnen zu Hause anrufen. Nächste Woche dürfte es soweit sein. Ihre sämtlichen Auslagen werden übernommen. Was wollen Sie Ihrer Frau sagen?«
»Die Wahrheit. Nur, daß ich nach Washington fahre.«
»Vielen Dank, daß Sie die Zeit für mich erübrigen konnten. Ich glaube, es hat sich gelohnt.«
»Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie auf mich gekommen sind.«
Hancox lächelte. »Aus zwei Gründen. Erstens die Antwort, die Sie mir gegeben haben, als ich Sie fragte, was sie machen würden, wenn Sie bei dieser Abfindungssache den Sieg davontrügen. Sie haben gesagt, sie würden sich vollaufen lassen. Ich bin davon überzeugt, daß Sie das nicht getan haben, aber die Antwort war gut. Naiv und erfrischend zugleich.«
»Und der andere Grund?«
»Wenn Sie gesagt hätten, Sie brauchten Bedenkzeit, hätte ich gewußt, daß ich einen Fehler gemacht habe.« Hancox stand auf und bot ihm die Hand. »Viel Glück.«
Ein Wagen holte Malloy an dem kleinen Washingtoner Hotel ab, wo man ihn einquartiert hatte, und brachte ihn zu einem Haus in der Nähe der Connecticut Avenue. Der Posten an der Tür prüfte seine Papiere und wählte dann eine zweistellige Nummer am Haustelefon. Ein paar Minuten später wurde Malloy von zwei Männern empfangen. Sie waren gut gekleidet, seiner Schätzung nach ein paar Jahre älter als er und wirkten wie ehemalige Studenten. Sie stellten sich als Jack und Homer vor. Homer war der Blonde.
Sie unterhielten sich über die Fahrt, das Hotel, über New York und ob Ted Williams dieses Jahr die meisten Homeruns in der Arnerican League schaffen werde. Dann nahmen sie am Tisch Platz, Malloy auf der einen Seite, die beiden anderen ihm gegenüber.
Sie stellten allerhand Fragen nach seiner Herkunft, aber er hatte das Gefühl, daß sie bereits Bescheid wußten. Und dann erkundigte sich Homer nach seiner Religionszugehörigkeit.
»Was soll damit sein?«
»Ich nehme an, Sie sind Katholik.«
»Warum?«
»Als Ire. Mit einem irisch-katholischen Vater.«
»Mein Vater ist Amerikaner.«
Homer lächelte. »Okay. Irischstämmiger Amerikaner.«
»Nein. Ganz und gar nicht. Er ist reinrassiger Amerikaner, und ich ebenfalls. Ich bin noch kein einziges Mal in Irland gewesen.«
Jetzt war Jack an der Reihe. »Haben Sie schon mal eine Leiche gesehen, Bill?«
»Ja.«
»Wie haben Sie darauf reagiert?«
»Ich war traurig.«
»Warum?«
»Es war meine Mutter.«
»Könnten Sie jemanden töten, wenn der Betreffende andernfalls Sie töten würde?«
»Darüber habe ich noch nie nachgedacht.«
»Dann denken Sie jetzt darüber nach.«
Malloy zögerte einen Moment, dann sagte er achselzuckend: »Ich glaube schon.«
»Was für Menschen hassen Sie?«
»Meinen Sie tatsächlich hassen oder bloß nicht mögen?«
»Ich meine es so, wie ich es gesagt habe.«
»Ich hasse Rüpel.«
Beide lachten, und Jack sagte. »Okay. Wir haben verstanden. Wie steht es um Ihre Ehe?«
»Gut, soweit ich weiß.«
»Sind Sie glücklich?«
»Jawohl.«
»Schon mal was vom COI gehört?«
»Mister Hancox hat den Namen erwähnt, aber nicht gesagt, worum es geht.«
»Worum geht es Ihrer Meinung nach?«
»Angesichts des Wirbels, den man hier mit mir anstellt, muß es sich um eine Art Geheimdienst handeln.«
Homer blickte zu Jack, der seinerseits mit den Achseln zuckte und nickte. »Sie werden hier von etlichen Spezialisten ins Gebet genommen werden, und wenn man Sie für geeignet hält, wird man Ihnen genau erklären, was das COI macht.«
»Ich vermute, daß es sich auf jeden Fall um eine reinrassige Regierungseinrichtung handelt.«
Homer lächelte. »Das schon. Aber es handelt sich nicht – ich wiederhole: nicht – um eine Behörde.«
Die nächsten zwei Tage führte Malloy Einzelgespräche mit zwei Psychologen, füllte Fragebogen aus und unterzog sich einer medizinischen Untersuchung. Am dritten und letzten Tag fand lediglich ein Gespräch mit einem Mann statt, offenbar dem Vorgesetzten der anderen. Er wurde ihm als Lieutenant Colonel Williams vorgestellt. Malloy schätzte den Mann auf Mitte Vierzig. Er trug ein Khakihemd ohne Schlips und eine graue Hose.
Er winkte Malloy zu einem Sessel, wartete, bis er Platz genommen hatte, und sagte dann: »Malloy, wie machen wir uns denn so?«
Malloy lachte. »Ich habe keine Ahnung, Sir.«
»Haben Sie überhaupt verstanden, worum es bei diesen Sondierungen geht?«
»Bei den meisten schon. Aber ich habe nicht kapiert, worum es bei dem Gespräch mit Jack und Homer ging.«
»Warum nicht?«
»Ihre Fragen bezogen sich auf kein bestimmtes Thema.«
Williams lächelte. »Sie wollten nur Ihre Belastungsgrenze ausloten. Herausfinden, wie Sie in aussichtsloser Lage reagieren.« Er hielt inne. »Was haben sie Ihnen über das COI erzählt?«
»Gar nichts.«
»Gut. Dann will ich Sie mal ins Bild setzen. COI steht für Central Office of Information, was zunächst einmal gar nichts bedeutet – und auch nichts bedeuten soll. Früher oder später wird daraus das OSS werden. Das Office of Strategic Studies.« Er zuckte die Achseln. »Was auch nicht viel besagt. Es geht um folgendes: Jeder, der in diesem Land halbwegs Bescheid weiß, ist sich darüber klar, daß wir in den Krieg hineingezogen werden. Das wollen wir zwar nicht – aber wir werden es, ob es uns gefällt oder nicht. Und wir möchten eine Einheit aufstellen, die uns siegen hilft. Weniger mit Waffengewalt als vielmehr mit ihrem Verstand. Die Briten haben bereits einen Geheimdienst – die sind schon seit Jahrzehnten im Geschäft. Die Deutschen haben die Gestapo, die Abwehr und den sogenannten Sicherheitsdienst. Und die Russen haben zwei Dienste, den Geheimdienst und den militärischen Nachrichtendienst. Aber wir haben bislang gar nichts. Das Pentagon wurstelt diesbezüglich vor sich hin, das Außenministerium ebenfalls, aber beide kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Das OSS soll herausfinden, was wirklich vor sich geht.« Er hob die Hand. »Aber nicht, bevor die Sache spruchreif ist. Bislang existiert es offiziell noch gar nicht. Wir tun uns derzeit zwar ein bißchen um, aber das sind reine Fingerübungen. Wenn wir grünes Licht bekommen, wollen wir ein einsatzbereites OSS auf die Beine stellen. Daher halten wir derzeit Ausschau nach den entsprechenden Leuten.
Nach welchen Leuten? Nun, nach allen möglichen Leuten. Alte, Junge, Akademiker, Anwälte, allerlei Spezialisten. Eins aber haben sie alle gemein: Es sind Männer und Frauen, die zupacken können. Leute, die nie nein sagen. Leute, die darüber nachdenken, wenn man etwas Unmögliches von ihnen verlangt, und die dann sagen, sie machen es trotzdem. Leute, die nicht gradlinig denken, nicht wie Beamte, auch nicht wie Soldaten. Wir möchten Menschen mit Ausstrahlung und persönlichem Mut.« Er hielt kurz inne. »Hätten Sie Interesse daran?«
»Soll das ein Angebot sein?«
»Ja.«
»Dann nehme ich an.«
»Schön. Wenden wir uns ein paar weniger wichtigen Dingen zu. Meines Wissens stehen Sie bei Ihrem Arbeitgeber noch zwei Monate in der Pflicht.«
»Das ist richtig.«
»Okay. Erfüllen Sie Ihre Pflicht, und kommen Sie anschließend zu uns. Sie erhalten den Dienstrang und den Sold eines Captain. Man wird Sie zwei Monate lang ausbilden, und dann werden wir Ihnen einen festen Posten zuweisen.«
»Heißt das, daß ich aus New York wegziehen muß?«
»Ja. Zunächst mal nach Washington, und danach ...« – er stockte – »... wer weiß?«
»Gibt es irgendwelche Einwände dagegen, daß man die Ehefrau mitnimmt?«
»Möchten Sie das denn?«
»Wenn es möglich ist.«
»Hat sie was gelernt?«
»Sie ist Sekretärin bei einer einheimischen Firma.«
»Wir könnten eine Arbeit für sie suchen, während Sie in Washington sind. Aber falls bis dahin der Ernstfall eintritt und wir uns bereits im Krieg befinden, müßten Sie bereit sein, jedem Marschbefehl Folge zu leisten, egal, wohin man Sie schickt. Wahrscheinlich nach Übersee. Aber Ihre Frau bekäme eine Sondererlaubnis für Eheleute, eine Wohnberechtigung und könnte weiterhin arbeiten.«
»Darf ich ihr trotzdem Bescheid sagen?«
»Ja. Aber weisen Sie sie darauf hin, daß sie mit niemandem darüber reden darf. Nicht einmal mit ihren Eltern, falls sie welche hat.«
»Danke.«
Lächelnd stand Williams auf und bot ihm die Hand. »Freut mich, daß Sie dabei sind, Malloy. Ich glaube, Sie werden eine echte Bereicherung sein.«