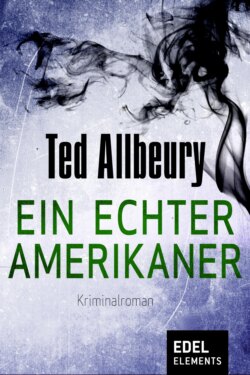Читать книгу Ein echter Amerikaner - Ted Allbeury - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWÖLFTES KAPITEL
ОглавлениеMalloy hatte vor seiner Einschiffung vier Tage Urlaub bekommen, die er mit Kathy in New York verbrachte. Sie wohnten im Waldorf, wo man ihnen nach Fürsprache aus Washington einen Sonderpreis gewährte.
Am letzten Tag, einem Sonntag, standen sie zeitig auf, frühstückten und gingen dann zu Fuß zum Central Park. Trotz des schönen Wetters, das einen baldigen Frühlingsbeginn verhieß, waren nur wenige Menschen unterwegs.
Sie spazierten bis zum See, setzten sich auf eine Bank und beobachteten einen Vater, der mit seinen Kindern auf das Bootshaus zuruderte.
Malloy trug seine Uniform mit den Doppelstreifen, die ihn als Captain auswiesen, aber ohne das Abzeichen seiner Einheit, und Mary war sich bewußt, daß dies für lange Zeit ihre letzten gemeinsamen Stunden waren. Sie hatten einen Tag mit seinem Vater verbracht, der sichtlich stolz gewesen war, daß sein Sohn Uniform trug. Der Vater hatte darauf bestanden, daß sie zu Fuß zum Friedhof und zurück spazierten, damit seine alten Kameraden sie sehen konnten.
Sie war mit dem Umzug nach Washington einverstanden gewesen, aber sie vermißte New York, und durch die jetzige Rückkehr war dieses Gefühl nur noch stärker geworden.
»Werden wir wieder nach New York ziehen, wenn alles vorbei ist?«
Lächelnd schaute er sie an. »Das hoffe ich doch. Du sehnst dich danach, stimmt’s?«
»Ja. Du auch?«
»Mir ist erst in den letzten paar Tagen klargeworden, wie sehr ich mich danach sehne.«
»Was fehlt dir am meisten?«
»Alles. Die Lichter, das Rockefeller Center, das Chrysler Building, das Pan Am ...« Er lachte. »Es gibt nichts Vergleichbares. Wie hat Jimmy Walker immer gesagt? Lieber ein Laternenpfahl in New York als Bürgermeister in Chicago.«
Sie lachte ebenfalls. »Bei mir sind es die Horn-&-Hardart-Auto-matenrestaurants, Tiffany’s, die Radio City Music Hall und die Rockettes.« Sie schaute ihm in die Augen. »Hast du eigentlich Angst, Bill?«
Er runzelte die Stirn. »Wovor?«
»Vor dem, was dich in Übersee erwartet.«
»Nein. Das ist nicht weiter gefährlich, wenn man ordentlich ausgebildet worden ist.«
»Colonel Williams hat gesagt, er meldet sich von Zeit zu Zeit bei mir, weil die Postverbindung so schlecht ist.«
»Ich melde mich ebenfalls, Kleines.« Er lächelte. »Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme heil wieder.«
»Wann mußt du heute abend aufbrechen?«
»Gegen acht. Die schicken mir ein Auto, das mich zum Flugplatz bringt.« Er lächelte. »Ich habe mir gedacht, wir essen im Hotel zu Mittag, und dann gibt’s da einen Bing-Crosby-Film – Musik, Musik. Wie wär’s, wenn wir uns den ansehen?«
»Darf ich dich zum Flughafen bringen?«
»Ich fliege mit einer Militärmaschine. Nicht vom Flughafen aus, sondern von einem Militärflugplatz.« Er nahm sie an der Hand. »Ich sollte dich lieber gegen sieben zum Busbahnhof bringen, dann bist du schon zu Hause, wenn ich losfliege. Okay?«
Sie nickte und zuckte die Achseln. »Du wirst mir schrecklich fehlen.«
»Du wirst mir ebenfalls fehlen, Schatz. Aber je eher wir uns ranhalten, desto eher wird’s wieder vorbei sein.«
»Komm bloß heil zurück. Alles andere ist mir egal.«
Er stand auf. »Gehen wir, Schatz. Wir haben noch genügend Zeit, die Avenue runterzulaufen.«
Sie fuhren mit dem Taxi zum Port Authority Bus Terminal, wo ihnen, genau wie von Malloy geplant, nicht mehr viel Zeit bis zur Abfahrt des Busses blieb. Sie kaufte sich zwei Illustrierte, küßte ihn zum Abschied und nahm ihren Platz im Bus ein, einen Fensterplatz, so daß sie ihn wenigstens bis zur Abfahrt sehen konnte.
Er wirkt viel zu jung, um in den Krieg zu ziehen, dachte sie, als sie ihn anschaute, und in der Uniform sieht er noch jünger aus. Sie hatte immer daran gezweifelt, ob es richtig war, daß er zum OSS ging, und nun, da sie ebenfalls dort arbeitete, machte sie sich noch mehr Gedanken. Die Leute dort stellten eine Unbekümmertheit zur Schau, die sie manchmal erschreckte. Anscheinend betrachteten sie den Krieg als eine Art Spiel. Und aufgrund der Berichte, die sie abtippen mußte, wußte sie, daß es keineswegs ein Spiel war. Als der Bus losfuhr, winkte sie ihm zu und hielt den Teddybär hoch, den er ihr in einem Laden am Times Square gekauft hatte. Sie sah, wie er ihr zulächelte und hinterherwinkte, bis der Bus in die 42nd Street abbog.
Es dauerte drei Tage, bis Malloy auf einem Flugplatz der Royal Air Force in Schottland landete. Er wurde zur Offiziersmesse gebracht und bekam über Nacht ein Feldbett zugewiesen. Anscheinend hatte ihn niemand erwartet. Niemand war von seiner Ankunft verständigt worden, und keiner wußte, was man mit ihm anfangen sollte. Der Staffelkapitän, der ihn unter seine Fittiche nahm, wirkte allenfalls leicht belustigt über den unverhofften Besuch.
»Ist immer das gleiche in dem Laden, Captain. Erwartet wird man nie. Man kriegt den Befehl, sich unverzüglich in einem Kaff zu melden, von dem man noch nie was gehört hat, und wenn man hinkommt, hat dort noch nie einer was von einem gehört.« Er lachte. »Sie sagen, Sie sind beim OSS. Was, zum Teufel, heißt das?«
»Office of Strategic Services.«
»Hab’ ich noch nie gehört. Amerikanisch?«
»Ja. Dem Militär unterstellt.«
»Nun ja, ich habe London angefunkt und um Bescheid gebeten, was ich mit Ihnen machen soll. Sie können inzwischen in der Messe was essen und ein bißchen schlafen. Könnte zwei, drei Tage dauern, bis wir rauskriegen, zu wem Sie gehören.«
Malloy war zum ersten Mal in seinem Leben außerhalb der Vereinigten Staaten, und zum ersten Mal war ihm unter Männern seines Alters unwohl zumute. Nicht, daß sie unfreundlich gewesen wären; sie reichten ihm den Senf, das Salz und eine Flasche mit einer Art Tomatensoße. Aber sie waren Piloten, Navigatoren, Bordschützen, und er war ein Außenstehender, der nichts zu ihren Gesprächen beisteuern konnte. Er verstand ohnehin kaum die Hälfte, da sie eine eigene Sprache mit allerlei Kürzeln und Fachbegriffen hatten. So redeten sie zum Beispiel ständig von »Mordsbrüchen« und wollten sich vor Lachen schier ausschütten, als ein Pilot auftauchte, der den Arm in der Schlinge trug. Malloy traute seinen Ohren kaum, als er tags darauf erfuhr, daß sie mit einem »Mordsbruch« einen Flugzeugabsturz meinten. Und über so was amüsierten die sich. Als er sich nach einem Telefon erkundigte, von dem aus er zu Hause anrufen könnte, hieß es, Telefonate ins Ausland seien nicht erlaubt, von Dienstgesprächen einmal abgesehen.
Als die Tage verstrichen, ohne daß aus London ein Bescheid kam, fragte er sich, ob man ihn möglicherweise absichtlich hinhielt, um seine Moral auf die Probe zu stellen. Doch allmählich faszinierte ihn die Fliegerstaffel, und er erkannte, daß sich die Männer deshalb so unnahbar gaben, weil sie wußten, daß sie schon beim nächsten Feindflug über Deutschland umkommen konnten. Allein in der zweiten Woche waren zwei Maschinen samt Besatzung nach einem Angriff auf Hamburg nicht zurückgekehrt.
Ende der zweiten Woche wurde er in die Schreibstube gerufen, und der Kommandeur der Einheit teilte ihm mit, daß er nach Manchester fahren solle, wo er seine Springerausbildung erhalten werde.
Auf der Fallschirmspringerschule der RAF am Stadtrand von Manchester hatte er das Gefühl, als sei er offiziell zur Ansicht freigegeben worden. Alle waren neugierig auf ihn. Er war der Yankee. Und Malloy stellte fest, daß er sich darauf einließ.
Er war der Vertreter Amerikas, sei es in den hallenden Hangars, den knarrenden Körben der Fesselballons oder im Bauch eines Flugzeugs. Hier, wo man Witze über ihn riß, ihn neckte, aber auch aufrichtig mochte, fühlte er sich endlich zu Hause. Abends redete er in der Messe mit jungen Männern, die aus den armseligsten Vierteln der Industriestädte kamen, oder mit anderen, die aus dem Mittelstand stammten. Es gab auch junge Männer aus der Oberschicht, die er zunächst nicht mochte, nur um festzustellen, daß sie nicht weniger tapfer oder unsicher waren als alle anderen in dem Kursus. In wenig mehr als drei Wochen lernte er eine ganze Menge über das Leben und die Mentalität außerhalb von Amerika. Als er den Befehl erhielt, sich im Hauptquartier des OSS in London zu melden, kam es ihm vor, als müsse er sein Zuhause verlassen.
Malloy war sich durchaus bewußt, daß er an der Euston Station nur wegen seiner Uniform ein Taxi bekommen hatte. Nicht, weil er Soldat war. Auch nicht, weil er Captain war. Sondern weil er Amerikaner war und Dollars hatte.
In dem Haus am Grosvenor Square wurde er einem gewissen Lieutenant Colonel Kelly vorgestellt, der mit ihm einen kurzen Fußmarsch zur Baker Street unternahm, wo er einem Major Wallace vorgestellt wurde. Major Wallace war Schotte, und er war bei der SOE. Im Verlaufe seiner SOE-Ausbildung, so erfuhr er, würde er Wallaces Schützling sein.
Der Major wollte ihn zum Essen ins Dorchester ausführen, und als sie durch die verdunkelten Londoner Straßen gingen, hörte er zum ersten Mal Fliegeralarm.
»Im Hotel kann uns nichts passieren«, sagte der Major. »Jedenfalls ist es da drin sicherer als hier.«
Eine Tanzkapelle spielte, während sie zu Abend speisten, und gelegentlich kamen Leute an ihren Tisch und plauderten ein paar Minuten lang mit Wallace. Hauptsächlich hübsche Mädchen in Khakiuniform.
»Sind Sie verheiratet, Malloy?«
»Ja, Sir.«
»Ich heiße Mike, und Sie Bill, stimmt’s?«
»Ja.«
»Wenn Sie Ihrer Frau schreiben, können Sie ihr eine schöne kleine Anekdote erzählen. Heute wurde nämlich in den Nachrichten bekanntgegeben, daß Damenunterwäsche nicht mehr bestickt sein darf, solange Krieg herrscht.« Er brüllte vor Lachen. »Das wird die Deutschen umhauen.«
»Was bezweckt man mit dieser Vorschrift?«
»Weiß der Teufel.« Er lächelte. »Durch den Krieg haben sämtliche alten Vetteln in den Ministerien endlich die Gelegenheit, einem das Leben noch trostloser zu machen, als es ohnehin schon ist.«
»Der Großteil der Leute hier kommt mir aber ziemlich fröhlich vor.«
»Irgendwie sind sie das ja auch. Jeder hat Arbeit. Jeder verdient Geld, die Frauen eingeschlossen. Leute, die jahrelang auf Stütze angewiesen waren, sind plötzlich wieder gefragt. Kein Wunder, daß ihnen das gefällt.«
»Was haben Sie vor dem Krieg gemacht, Mike?«
»Ich war Anwalt, Strafverteidiger.«
»Ich war ebenfalls Anwalt.«
»Ich weiß. Wollen Sie das auch noch machen, wenn Sie wieder zurückkommen?«
»Ich weiß nicht genau. Kommt drauf an, wie es hinterher aussieht. Durch den Krieg wird sich allerhand verändern.«
»Zum Beispiel?«
»Alles. Dieser Krieg wird nicht nur die beteiligten Länder verändern, sondern auch die Menschen. Es wird ein einziges Chaos geben. Und wenn wir den Krieg gewonnen haben, wird es noch einmal genauso lange dauern, bis dieses Chaos wieder beseitigt ist.«
»Sind Sie davon überzeugt, daß wir ihn gewinnen?«
Malloy schaute ihn erschrocken an. »Natürlich. Sie etwa nicht?«
Wallace zuckte die Achseln. »Wir kämpfen jetzt seit über einem Jahr allein gegen die Deutschen und die Italiener. Wenn man halbwegs bei Verstand war, hat man sich manchmal schon gefragt, ob wir das durchstehen. Jetzt, wo ihr mit dabei seid, hat sich die Lage schlagartig geändert.« Er stockte. »Aber trotzdem müssen wir ihn erst mal gewinnen.«
Bei der Besprechung am nächsten Tag kam Wallace sofort zur Sache. »Ich möchte klarstellen, daß Sie völlig unabhängig sind. Mit mir haben Sie nur während der Ausbildung zu tun, bei der wir Ihnen beibringen, wie Sie in Frankreich leichter über die Runden kommen. Sie sind nach wie vor Kelly unterstellt und unserer Befehlsgewalt entzogen. Wir haben gar nicht vor, uns irgendwelche OSS-Operationen unter den Nagel zu reißen. Wir wollen lediglich dafür sorgen, daß die Erfahrungen, die wir bei unseren Einsätzen im besetzten Frankreich gemacht haben, an Sie weitergegeben werden. Wenn Sie mit der Schulung fertig sind und zum Einsatz kommen, haben Sie freie Hand. Sie können auf das zurückgreifen, was wir Ihnen beigebracht haben, oder sich darüber hinwegsetzen – liegt ganz bei Ihnen. Haben Sie das verstanden?«
»Ja. Aber ich verstehe nicht ganz, warum Sie mir das sagen.«
Wallace zuckte die Achseln. »Ihre Leute hier in London haben ihre eigenen Ansichten. Danach haben Sie sich zu richten. Und gewisse Leute in Washington meinen, wir wollen dem OSS bloß unsere Methoden aufdrücken, damit wir wenigstens den Überblick über eure Aktivitäten haben, wenn ihr schon nicht gemeinsame Sache mit uns machen wollt. Ihre Leute hier würden das gar nicht zulassen, selbst wenn wir wollten. Die wissen, worum es geht – die Politiker in Washington aber nicht. Alles klar?«
Malloy lächelte. »Kommt mir bekannt vor.«
Wallace zuckte die Achseln. »Sie kommen nach Beaulieu, das liegt in Hampshire. Ein riesiges Anwesen mit einem Herrenhaus. Dort bildet die SOE ihre Leute aus. Man wird Ihnen beibringen, wie man mit einem Funkgerät umgeht, wie man Nachrichten chiffriert und dechiffriert, wie man eine Observierung durchführt und seinerseits Beschatter abschüttelt, wie man deutsche Truppen anhand der Abzeichen und Waffenfarben erkennt und zu guter Letzt ... wie man sich verhält, wenn man von den Deutschen erwischt wird.«
»Klingt nach viel Arbeit. Wie lange dauert so was?«
»Sie werden etwa sechs Monate dort bleiben.« Er stand auf. »Übrigens, am Grosvenor Square liegt Post für Sie. Ich habe einen Wagen angefordert, der Sie beim OSS abholt und nach Beaulieu bringt.«
Auf dem Landsitz Beaulieu wurde Malloy in einem Haus einquartiert, in dem nur SOE-Leute untergebracht wurden, die in Frankreich eingesetzt werden sollten. Niemand benutzte seinen richtigen Namen. Malloys Deckname sollte Maurois lauten, der Vorname Guillaume, genau wie bisher. Man zeigte ihm seine künftigen Papiere, die er aber erst unmittelbar vor dem Einsatz ausgehändigt bekommen würde.
Durch das ständige Beisammensein mit Leuten, die darauf beharrten, daß ausschließlich französisch gesprochen wurde, besserten sich Malloys Sprachkenntnisse, und er bekam eine genauere Vorstellung davon, was ihn im besetzten Frankreich erwartete. Der theoretische Unterricht war anstrengend, die praktische Ausbildung lang und erschöpfend. Aber das Wissen, das er durch den Umgang mit Franzosen sammelte, war fast genauso wertvoll. Sie waren nach wie vor verbittert, weil ihr Land vor den Deutschen kapituliert hatte, und ständig diskutierten sie über die Politik der Vichy-Regierung. Außerdem erfuhr er, daß es dem Großteil von ihnen nur darum ging, Frankreich zu befreien – alles andere war ihnen gleichgültig. Malloy wurde etwas kribblig, wenn er daran dachte, daß er mit derart engstirnigen und kurzsichtigen Leuten zusammenarbeiten sollte. Die Ziele der Briten, die er bei dem Kursus kennenlernte, deckten sich schon eher mit den seinen: sowohl ein Sieg über die Nazis als auch die Befreiung von ganz Europa.
Zu guter Letzt stattete man ihn mit Kleidung aus, die man französischen Flüchtlingen abgekauft hatte, und entfernte zwei amerikanische Füllungen aus seinen Zähnen, die daraufhin von einem französischen Zahnarzt plombiert wurden. Ein Ausbilder überprüfte sorgfältig seine Papiere – ein Personalausweis, eine Reisegenehmigung, ein ärztliches Attest, in dem ihm bescheinigt wurde, daß er an Asthma litt. Damit wollte man verhindern, daß er zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert würde.
Danach ging es wieder nach London, wo zwei OSS-Offiziere noch einmal seinen Einsatzbefehl durchsprachen und ihm nähere Einzelheiten über das Netz mitteilten, dem er zugeteilt werden sollte. Es stand unter dem Befehl eines SOE-Offiziers namens Parish, eines Briten. Genauso alt wie er. Er und seine Leute würden ihm Geld, Nahrung und Unterkunft sowie eine Funkverbindung mit London zur Verfügung stellen. Sie seien zu seiner Unterstützung da, aber nicht für seine Arbeit zuständig, hieß es. Sie dürften nur einschreiten, wenn sie den Eindruck hätten, durch seine Pläne werde das ganze Netz gefährdet. In drei Tagen werde er von einem Flugplatz in den East Midlands aus aufbrechen, aber er werde nicht mit dem Fallschirm abgesetzt, sondern von einer Westland Lysander in die Nähe von Chartres gebracht werden, wo ihn eine Widerstandsgruppe in Empfang nehmen werde. Danach machten sie ihn anhand einer Generalstabskarte mit dem Gebiet vertraut, in dem er eingesetzt werden sollte, und erklärten ihm, daß der Führungsoffizier des Netzes bereits über Malloys Auftrag Bescheid wisse.
Sowohl Colonel Kelly als auch Major Wallace begleiteten ihn in dem Humber-Geländewagen der britischen Army, aber sie kamen nur sporadisch miteinander ins Gespräch. Und wenn, dann unterhielten sie sich über Alltäglichkeiten, so als sei ihnen der Anlaß, der sie hier zusammenführte, peinlich. So ähnlich, dachte Malloy, muß es sein, wenn man in einem Wagen voller Trauergäste sitzt, die hinter dem Leichenwagen zum Friedhof fahren. Aus Sicherheitsgründen hatten sie sich in Beaulieu nicht voneinander verabschieden dürfen, und in dem Haus am Grosvenor Square hatten sie keine Gelegenheit dazu gehabt. Kein Mensch hatte ihm viel Glück gewünscht.
Das Auto bog nach rechts in eine Zufahrtsstraße ab, die etwa anderthalb Kilometer weiter in eine Betonpiste überging, wo sie vor einer rot-weiß gestreiften Schranke anhielten. Ein Mann in RAF-Uniform, die Sten-Maschinenpistole locker in der rechten Armbeuge hängend, kam aus dem hölzernen Schilderhaus. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und reichte dem Posten einen Ausweis, den dieser sorgfältig überprüfte, worauf er die hintere Tür öffnete und die Insassen musterte. Dann begab er sich zu Malloys Tür, öffnete sie, schaute erneut auf den Ausweis und sah sich Malloy genau an. Er nickte dem Fahrer zur und deutete auf das in der Ferne verschwimmende rote Licht.
Aus der Holzbaracke, vor der sie anhielten, drang Musik. Der Fahrer führte sie an ein paar weiteren Baracken vorbei zu einem Ziegelbau, vor dem ein bewaffneter Posten stand. Major Wallace übernahm die Vorhut. Er stieß die Tür auf und schob den Verdunkelungsvorhang beiseite, und Malloy kniff die Augen zusammen, als er plötzlich mitten im Licht stand. Ein RAF-Offizier kam ihnen mit ausgestreckter Hand entgegen. »Sie sind früh dran, Wallace. Vielleicht möchten Sie und Ihre Leute noch was essen?«
Wallace schaute Malloy an. Der schüttelte den Kopf und sagte: »Ich hätte gern einen Kaffee, wenn Sie welchen haben.«
Zwanzig Minuten später stand Malloy nackt unter der Dusche, und als er wieder herauskam und sich abtrocknen wollte, untersuchte ihn ein Zivilist von oben bis unten. Hinten und vorne. »Keinerlei Operationsnarben, oder?«
»Nein.«
»Zeigen Sie mir Ihre Hände.«
Malloy streckte die Hände aus, und der Mann besah sie sich aufmerksam. Dann sagte er: »Bürsten Sie gründlich die Nägel, und ziehen Sie sich an.« Er deutete auf einen Holztisch, auf dem Malloys französische Kleidung lag.
Daneben stand ein kleiner Segeltuchbeutel, und als er hineinschaute, sah er, daß er Rasiermesser, -seife und -pinsel enthielt, dazu eine Garnitur Unterwäsche, zwei Paar Socken, ein Fläschchen Vitamintabletten und ein Taschenmesser mit mehreren Klingen. Er war gerade dabei, den Beutel wieder zu verschließen, als Major Wallace mit einem Ledersack hereinkam.
»Das ist für die Leute im Netz, Bill. Post und Anweisungen. Sie dürfen sie nur Captain Parish persönlich aushändigen.« Er stockte. »Wenn Sie soweit sind, können wir, alter Junge.«
»Ich bin bereit. Wo ist der Colonel?«
»Der erwartet Sie an der Maschine.«
Als sie über den Flugplatz gingen, gewöhnten sich Malloys Augen allmählich wieder an die Dunkelheit, und er stellte fest, daß die ganze Umgebung in helles Mondlicht getaucht war. Vollmond oder »Bombermond«, wie er bei den Männern der RAF hieß.
Die gedrungene Westland Lysander mit ihren merkwürdig angewinkelten Flügeln wirkte wie eine riesige Libelle. Als eine Wolke am Mond vorbeizog, schien sie über dem Boden zu schweben.
Colonel Kelly stellte Malloy einem Piloten der RAF vor, schüttelte ihm die Hand, wünschte ihm viel Glück und klopfte ihm auf die Schulter. Major Wallace lächelte, als er ihm die Hand gab. »Alles erdenklich Gute, mein Junge. Passen Sie auf sich auf.«
Dann kletterte er über die kurze Metalleiter ins Innere. Die Luke wurde verschlossen, und mit ohrenbetäubendem Dröhnen sprang der Motor an. Die Maschine wackelte einmal mit dem Schwanz, rollte kurz an, und dann stiegen sie in den dunkelblauen Himmel auf.
Zur gleichen Zeit starteten hundertfünfzig Kilometer weiter südlich, von dem streng geheimen Flugplatz in Tempsford aus, die neuesten Bomber der RAF, die Lancaster, zu einem Angriff auf die U-Boot-Werften in Danzig.