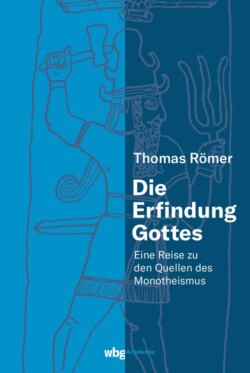Читать книгу Die Erfindung Gottes - Thomas Römer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Untersuchungsgegenstand und Fragestellung
ОглавлениеUnsere Untersuchung über den Gott Israels wird also ungefähr den Zeitraum von einem Jt. umfassen, vom Ende des 2. Jt. v.u.Z. bis in hellenistische Zeit. Wir werden zunächst die Frage nach der Bedeutung seines Namens klären, den wir im Folgenden rein konsonantisch schreiben werden, nämlich Jhwh. Es folgt eine Untersuchung der Belege für diesen Namen außerhalb der Bibel und die Frage nach dem geographischen Ursprung des Gottes, der diesen Namen trägt. Dabei werden wir einige Hinweise finden, die uns in den „Süden“ führen werden, zunächst nach Ägypten, wo es Nomaden gibt, die eine Gottheit namens „Jahwa“ verehren, bei der es sich vielleicht um einen vergöttlichten Berg handelt. Wir werden die eigenartige Überlieferung vom Aufenthalt des Mose bei den Midianitern untersuchen, während dessen Jhwh sich ihm offenbart. Aber wie wird dieser Gott der Gott „Israels“? Wann erlangte er den Status eines Schutzgottes der Königreiche Israel und Juda? Wurde er in beiden Gebieten auf dieselbe Weise verehrt? Wie gelangte er in dem Tempel Jerusalems? War er dort allein oder teilte er sich den Tempel mit anderen Gottheiten? War er von Anfang an unsichtbar, wie die biblischen Redaktoren behaupten, oder gab es Darstellungen von Jhwh? War er ein „Junggeselle“? Als Ergebnis welchen Prozesses und als Reaktion auf welche Ereignisse hat sich die monolatrische Verehrung, die er nach und nach erfuhr, durchgesetzt?
Die Antworten auf diese Fragen werden es ermöglichen, am Ende der Untersuchung zu verstehen, wie der Monotheismus erfunden wurde und wie er die polytheistischen Wurzeln, deren Erbe er bewahrt, in sich aufgenommen hat.
1 Der Plural zeigt bereits an, dass es verschiedene voneinander abweichende christliche Bibeln gibt: Das Alte Testament der Katholiken unterscheidet sich vom Alten Testament der Protestanten, und die orthodoxen Kirchen zählen je nach ihren verschiedenen Traditionen noch weitere Bücher hinzu.
2 Diese konfessionell neutrale Bezeichnung wird im Folgenden der Bezeichnung „Altes Testament“ vorgezogen, da letztere christlichen Ursprungs ist und die jüdische Bibel „nur“ als ersten Teil der christlichen Bibel begreift.
3 Jan Assmann, ein berühmter deutscher Ägyptologe, der sich sehr für die Ursprünge des biblischen Monotheismus interessiert, hat diesen Ausdruck sehr häufig verwendet.
4 Im Judentum gibt es kein eigenes Wort für die Bibel in ihrer Gesamtheit, daher greift man oft auf das Akronym TaNaK zurück, das aus den jeweiligen ersten Buchstaben der drei Teile (Tora, Nebiim, Ketubim) gebildet ist.
5 Es handelt sich um die Bücher Jesaja, Jeremia, Ezechiel und die zwölf „kleinen Propheten“.
6 Diese dreiteilige Hebräische Bibel hat eine andere Anordnung als das Alte Testament, das in vier Teile aufgeteilt wird. Zudem gibt es, wie schon gesagt, zumindest drei verschiedene Alte Testamente, entsprechend den drei Hauptrichtungen der christlichen Religion: Katholizismus, Protestantismus und Orthodoxie. Die Unterteilung und die Anordnung der verschiedenen Bücher und die Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme mancher von ihnen erklären sich durch die theologischen Optionen der verschiedenen Konfessionen.
7 Der Jahwist (J), der den Gottesnamen Jahwe benutzt, stammt nach dieser Theorie aus dem Jahr 930 v.u.Z., der Elohist (E), der den Namen Elohim für Gott bevorzugt, aus dem 8. Jh., das Deuteronomium (D) aus der Zeit Joschijas (Ende 7. Jh.), die Priesterschrift (P) aus der Zeit des babylonischen Exils oder aus den Anfängen der persischen Zeit. Siehe dazu Thomas Römer: „Der Pentateuch”, in: Walter Dietrich u.a.: Die Entstehung des Alten Testaments (= Theologische Wissenschaft 1), Stuttgart (Kohlhammer) 2014, S. 52–166.
8 Siehe dazu ausführlich: Jean-Daniel Macchi: „Die Geschichte Israels. Von den Ursprüngen bis zur Zeit der babylonischen Herrschaft“ und Arnaud Sérandour: „Die Geschichte des Judentums in persischer, hellenistischer und römischer Zeit. Von Kyros bis Bar Kochba“, in: Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi und Christophe Nihan (Hgg.): Einleitung in das Alte Testament, Zürich (TVZ) 2013, S. 34–64 und 65–103.
9 Oswald Loretz: Habiru-Hebräer. Eine sozio-linguistische Studie über die Herkunft des Gentiliziums ‘ibrî vom Appellativum habiru, Berlin-New York (De Gruyter) 1984; Nadav Na’aman: „Habiru and Hebrews, the transfer of a social term to the literary sphere“, in: Journal of Near Eastern Studies 45 (1986), S. 217–288.
10 Israel Finkelstein und Neil A. Silbermann: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel, München (dtv) 20095 [Deutsche Erstausgabe München (Beck) 2002]. Oded Lipschits: The Fall and Rise of Jerusalem. Judah under Babylonian Rule, Winona Lake (Eisenbrauns) 2005. Was Aren Maeir betrifft, so können die Leserinnen und Leser, die des Englischen mächtig sind, eine wunderbare Tagung auf You-Tube abrufen, wo er die Rolle der Archäologie gegenüber den biblischen Erzählungen von den Anfängen definiert: www.youtube.com/watch?v=3eWqMX716Zs&feature=-youtu.be (eingesehen 4.1.2018).
11 Zum Beispiel finden sich einige Ereignisse, von denen in den Königsbüchern berichtet wird, aus anderem Blickwinkel auch in assyrischen und anderen Annalen und Inschriften wieder.
12 Diese Epoche endet in der Terminologie der Archäologie der Levante mit der persischen Zeit.
13 Die biblischen Texte nennen sie die „Unbeschnittenen“, denn anders als die Bewohner der Levante kannten die Philister keine Beschneidung.
14 Es handelt sich um die Könige Omri, Ahab und Joram.
15 Diese Inschrift wird, wie auch die Mescha-Stele, im Folgenden ausführlicher besprochen werden. Nach mehrheitlicher Auffassung enthält sie den ersten Beleg für den Namen David außerhalb der Bibel.
16 Jehu war keinesfalls der Sohn Omris, sondern Sohn des Nimschi. Da jedoch für die Assyrer Omri der Gründer Israels war, verstanden sie auch Jehu als seinen „Sohn“. Möglicherweise haben sich die Assyrer auch einfach nicht besonders für die innenpolitischen Verhältnisse Israels interessiert.
17 Es ist unmöglich, die genauen Regierungsdaten der israelitischen und judäischen Könige zu ermitteln; alle chronologischen Angaben zu den Regierungsdaten dieser Könige können also nur Näherungswerte sein.
18 Diese beiden Überlieferungen werden im 12. Kapitel des Buches Hosea einander gegenübergestellt.
19 Dies wird auch in Kapitel 17 des 2. Königsbuches eingeräumt.
20 Möglicherweise sind einige Hiskija zugeschriebene Arbeiten eigentlich das Werk des Königs Manasse, den die Verfasser der Königsbücher verabscheuen.
21 Der zweite Teil des Sprüchebuchs (25,1) gibt im Titel an, zur Zeit des Königs Hiskija kompiliert worden zu sein.
22 Im heutigen Jesajabuch die Kapitel 40 bis 55.
23 Wörtlich „Verbannung/Wegführung“. Bezeichnung für die in Babylon exilierten Juden.