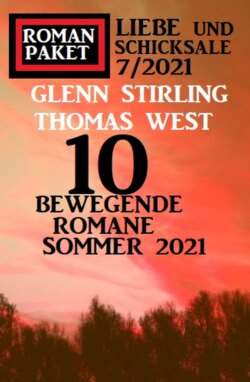Читать книгу 10 bewegende Romane Sommer 2021: Roman Paket Liebe und Schicksale 7/2021 - Thomas West - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеDer Graf zog nervös an seiner Zigarette, als ihm Timo Veith im Büro der Gutsverwaltung gegenübersaß.
Die grüne Jägerkleidung stand dem hageren Gutsherren vortrefflich. Aber Timo entging nicht, dass Graf Hall in den letzten Jahren beträchtlich gealtert war. Und nicht nur die Falten bewiesen das, die sich in seinem Gesicht abzeichneten, auch die zunehmende Nervosität. Einen Grund glaubte Timo Veith dafür zu kennen.
„Ich weiß, Herr Graf“, sagte er, „dass wir mit der Schweinezucht Verlust machen werden. Aber, entschuldigen Sie, ich hatte Ihnen abgeraten, so viele Schweine aufzuziehen. Sie hatten es haben wollen. Schweinemast, haben Sie gesagt, wär’ eine Sicherheit. Aber drüben in Deutschland haben sie einen Schweineberg, und wir hier in Österreich haben ihn auch. Die Leut essen nicht mehr gar so viel Schweinefleisch. Und die Preise fallen. Es gibt zu viel Schweinefleisch. Hätten Sie auf mich gehört, Herr Graf, wären wir mit den Schafen auf die Hochalmen gegangen. Immer mehr Bauern in Tirol und im Salzburgischen tun das. Da können Sie Almen abweiden, wo wir mit der Rinderzucht gar nichts mehr machen können. Die Schafe nutzen die Almen aus.“
„Und machen's Gebirg’ kaputt“, meinte der Graf mit weinerlicher Stimme. „Mehr Rindfleisch brauchen wir. Rindfleisch. Ochsen müssen wir halten.“
„Alles zu umständlich. Junge Bullen bringen mehr. Aber auf den Almen droben ist das nichts. Hier unten, wo viel saftigeres Gras wächst, da können wir die Bullen halten. Wir halten sie ja. Aber nicht genug.“
„Nicht nur das habe ich mit Ihnen besprechen wollen, Herr Veith“, sagte der Graf und drückte seine Zigarette nervös im Aschenbecher aus. „Da ist noch eine andre Geschieht’, ich mein’ die Sabrina.“
In Timos Brust machte sich ein beklemmendes Gefühl breit. Wieso sprach der Graf plötzlich von seiner Tochter? War er irgendwie hinter die Geschichte mit Roswitha gekommen? Aber was sollte er da gehört haben? Im Grunde gab es nichts zu erzählen. Da hatte sich nichts weiter ereignet, als dass er, Timo, eine alte Bekannte besucht hatte, der es sehr schlecht ging.
Der Graf schien zu überlegen, wie er seine Worte wählen sollte, und schließlich begann er:
„Wissen’S, ich hab nur das eine Kind. Ich hätt’ mir einen Jungen gewünscht. Aber da ist nun die Sabrina d'raus geworden, und ich bin froh, dass ich sie hab. Ich lieb sie ja so sehr, meine Sabrina. Auf der anderen Seite ist sie verwöhnt. Nun ja, lieber Herr Veith, wenn man nur ein Kind hat, verwöhnt man’s halt. Und arm sind die Halls auch nie gewesen. Nur, da ist noch was anderes. Und ich wünscht’ mir, dass Sie’s recht verstehn, lieber Herr Veith. Ich bin ein modern denkender Mensch, ein Aristokrat auf dem Papier. Aber Sie wissen gut, dass ich den Grafen und die Herkunft nie groß herausgehängt hab. Aber ein wenig auf die Linie muss ich schon achten. Ich weiß net, ob’s mich recht verstehn, Herr Veith.“
Timo Veith hätte zugeben müssen, dass er den Grafen durchaus nicht verstand. Er wusste nicht, worauf der hinaus wollte. Aber er wartete ab, ließ ihn ausreden und war der Überzeugung, dass er das, was Graf Hall ihm sagen wollte, früher oder später schon begreifen würde. Sollte der nur weitersprechen.
Aber der Graf schien immer noch nicht zu wissen, wie er es anpacken sollte, sein Anliegen vorzubringen. Und es war ein Anliegen. Er hatte nie einen besseren Betriebsleiter als Timo Veith gehabt und wusste durchaus, dessen Fähigkeiten zu würdigen. Wenn er jetzt etwas Falsches sagte, dann brachte es Timo Veith womöglich fertig, den ganzen Kram hinzuwerfen, seine Position zu kündigen und wegzugehen. So tüchtig wie er war, würde er überall eine ähnliche Stellung finden. Davon war Graf Hall fest überzeugt. Einen solchen Viehwirt wie Timo Veith, bekam er bestimmt nicht noch einmal. Und auch davon war er überzeugt. Also musste er seine Worte sehr sorgfältig wählen.
Auf der anderen Seite war das, was er Timo Veith begreiflich machen wollte, für ihn ein Zwang, dem er sich nicht entziehen konnte.
„Also kurzum, auch auf die Gefahr, dass Sie mich falsch verstehen, Herr Veith: Die Sabrina mag sie. Die mag sie sehr. Sie mögen die Sabrina auch. Nur, wenn’s nach meiner Frau geht, können’s net der Mann von der Sabrina werden. Das geht net. Das geht ganz und gar net, Herr Veith. Und wissen’S auch, warum's net geht? Von mir aus tät’s schon gehen“, fügte er fast weinerlich hinzu.
„Wollen Sie damit sagen, Herr Graf, dass Sie deshalb plötzlich Bedenken haben, weil ich nicht adlig bin?“, fragte Timo förmlich.
Der Graf wirkte erleichtert. Denn genau das hatte er sagen wollen und doch nicht fertiggebracht, es so auszusprechen.
„Jedenfalls net“, meinte er deutlich befreit von dieser Last, „solang wie’s nur einfach Veith heißen.“
Timo musste lachen, ob er wollte oder nicht. „Wie soll ich daran etwas ändern?“, fragte er.
Zu seiner Überraschung schien Graf Hall genau dafür ein Rezept zu haben. „Wissen’S, ich hab lang darüber nachdenkt, und dann mit meinem Freund, dem Baron Rezzori gesprochen. Alter ungarischer Adel, das wissen’S ja. Und er wär bereit, Sie zu adoptieren. Timo, mein Freund, ist das nix?“
Timo Veith hatte Mühe, ernst zu bleiben. Der Graf war ihm beinahe wie ein Vater gewesen, oder, etwas genauer ausgedrückt, wie ein väterlicher Freund.
Welche Bauchkrämpfe es Graf Hall gekostet haben mochte, das auszusprechen, was er jetzt gesagt hatte, konnte sich Timo fast vorstellen. Und dass er seinen Gutsinspektor schließlich beim Vornamen genannt hatte, war ein besonderer Akt der Freundlichkeit und Vertraulichkeit, die er nur ganz wenigen entgegenbrachte, mit denen er nicht direkt verwandt oder eng befreundet war. Auch das war ein Zeichen der Anerkennung, das Timo durchaus zu werten wusste. Andererseits hatte er, was seine Herkunft anging, auch seinen Stolz. Und diesen trotteligen Baron Rezzori, den er sehr wohl auch kannte und der oft genug hier zu Besuch weilte, mochte er nicht zum Adoptivvater haben. Warum auch? Er war stolz auf seinen Namen Veith und war nicht gewillt, nur um gewissen Formen der Aristokratie zu genügen, ein adoptierter Adliger zu werden, weil er sonst für Sabrina nicht standesgemäß gewesen wäre.
„Haben Sie das auch mit Ihrer Tochter besprochen?“ fragte er.
Der Graf hob sofort abwehrend die Hände. „Aber nein, Sabrina weiß nix. Sagen Sie ihr auch kein Wort, kein Sterbenswort, lieber Timo. Das muss noch unter uns bleiben.“
Timo schüttelte den Kopf. „Herr Graf, mein Name gefällt mir. Ich finde ihn gut. Ich möcht’ kein Baron von Rezzori werden, Herr Graf.“
„Aber warum net? Es ist uralter Adel aus Ungarn“, beteuerte der Graf noch einmal.
Timo hätte am liebsten laut aufgelacht, und er entsann sich sehr deutlich, wie halb Tirol über den Baron gelacht hatte, als der eine Kuh erlegte, die er für einen Hirsch hielt. Oder daran, wie der trottelige Baron, der immerhin schon siebzig war, trunken von Rotwein letzten Sommer bei einer Sennerin auf der Stundser Alpe im Rudeggertal fensterln wollte und dabei in die Jauchenkuhle gefallen war.
Von den vielen anderen Lächerlichkeiten, denen sich der Baron laufend preisgab, ganz zu schweigen und die ihn in Tirol mittlerweile zu einer amüsanten Figur gemacht hatten. Nein, mein Vater, dachte, Timo, ist immer ein ernsthafter Mensch gewesen und war es bis zu seinem Tod. Bei seinem Anblick brauchte man sich nicht das Lachen zu verkneifen.
Timo schüttelte den Kopf. „Danke, Herr Graf, das möcht’ ich net.“
„Ich geb’s ja zu“, meinte Graf Hall, „ein wenig trottelig ist er schon. Aber sonst wüsst’ ich niemand, der es macht. Und er war bereit dazu.“
„Danke, Herr Graf, sehr gütig. Aber darauf möcht’ ich verzichten“, sagte Timo noch einmal.
Da war Graf Hall mit seinem Latein am Ende, und sie sprachen dann doch wieder über die Schweinepreise. Später, als Timo den Grafen verlassen hatte, traf er unten im Hof auf Sabrina, die gerade ausreiten wollte, Timo zuwinkte und dann auf ihn zugeritten kam.
Sie war groß und schlank, hatte ihr langes blondes Haar zum Knoten gerafft und bot, alles über allem, einen äußerst attraktiven Anblick auf diesem herrlichen Rappen, den sie ritt.
Der Hengst zeigte sich an diesem Vormittag sehr nervös. Trippelte auch noch auf der Stelle, als ihn Sabrina zügelte.
Die Ähnlichkeit des Mädchens mit ihrem Vater war unverkennbar. Nur in ihrem Wesen hatte sie auch sehr viele Züge der Mutter geerbt. Timo war das eigentlich noch nie so sehr aufgefallen wie gerade jetzt, da sie vor ihm auf dem Pferd saß und temperamentvoll mit ihrer Reitpeitsche immerzu an ihre Stiefelschäfte schlug.
„Was habt ihr den geredt, ihr zwei, du und der Papa?“, fragte sie, und ihre Stimme hatte etwas Forderndes, das Widerspruch nicht zuließ. Auch das fiel Timo im Augenblick im besonderen Maße auf.
Ohne auf ihre Frage einzugehen, sagte Timo: „Eigentlich möcht' ich auch mit dir reden, Sabrina.“
„Und warum tust das net?“, fragte sie ungeduldig.
Sie war eine Frau, die einen Mann absolut nicht gleichgültig ließ. Timo musste das auch jetzt wieder erkennen. Auf der anderen Seite fehlten ihr die weichen Linien, wie sie zum Beispiel Roswitha besaß.
Er ertappte sich selbst dabei, dass er Sabrina mit Roswitha verglich. Aber Roswitha ... wer weiß, ob sie jemals wieder gesund wurde?
Diesem Gedanken folgte bei Timo gleich ein zweiter. Sie muss gesund werden, dachte er! Sie muss es!
„Steig ab vom Pferd!“, bat er Sabrina. „Ich bind es dir an. So möcht’ ich nicht mit dir reden.“
Immer dann, wenn er sehr ernst wurde, sprach er reines Hochdeutsch. Sabrina merkte daran, dass es nicht nur eine harmlose Plauderei werden sollte. Ein wenig beunruhigt folgte sie widerspruchslos seiner Bitte, saß ab, reichte ihm die Zügel, und er führte das Pferd hinüber zum Stall, wo er es an einem Ring anband.
Nervös trippelte der Hengst auf der Stelle.
Timo bot Sabrina den Arm, aber sie übersah es und ging, ohne sich einzuhaken, neben ihm her.
„Wo willst hin?“, fragte sie unwirsch.
Ohne ihr darauf zu antworten, ging er mit ihr bis an den Rand des Parkes auf der anderen Seite der Wirtschaftsgebäude. Da gab es einen kleinen Tisch und abgeschnittene Baumstämme, die als eine Art Hocker dienten. Früher hatten sie oft hier gesessen. Die letzte Zeit war es seltener dazu gekommen.
Sabrina schien nich sehr erbaut davon zu sein, mit ihm ein längeres Gespräch zu führen. Offenbar hatte sie sich auf ihren Ausritt gefreut. Widerstrebend setzte sie sich, stutzte die Ellenbogen auf die Tischplatte und sah Timo sehr ungeduldig an, als er sich gegenüber niederließ. „Also sag, was willst?“
„Dein Vater möchte, dass ich mich vom vertrottelten Baron Rezzori adoptieren lasse, damit ich für dich standesgemäß bin, verstehst?“
Er hatte damit gerechnet, dass sie lachen würde. Aber sie tat es nicht. Sie sah ihn nur ernst an, zuckte die Schultern und meinte: „Na und? Was ist schon dabei?“
„Ich heiße Veith und nicht Rezzori. Ich bin zwar kein Baron, kein Graf, kein Fürst, aber das alles ist doch etwas vom vorigen Jahrhundert. Findest du nicht auch?“
„Natürlich finde ich das“, stimmte sie ihm zu. „Aber wenn’s der Vater möcht’? Mein Gott, so schlimm ist das doch net, oder? Und dann, Timo, es ist nicht der Vater. Mama will, dass du standesgemäß bist. Sie hat mit mir schon länger darüber gesprochen. Ich hab dir’s net erzählt, weil ich’s net für wichtig halte.“
„Für mich ist das schon wichtig“, erklärte er, „ob du mich heiratest oder einen Namen.“
„Ach, geh!“, meinte sie und lachte dann doch noch. „Was ist schon dabei?“
„Der Baron Rezzori ist ein Mann, über den sich halb Österreich ausschüttet vor Lachen. Findest du, dass dieser Name mehr wert ist als meiner?“
„Ach, geh! Mach keine Geschieht’ daraus! Es ist doch eh wurscht, ob du ein Rezzori oder ein Veith bist. Die Mama und Papa sind Leut von einer anderen Welt. Ich versteh’s ja auch net. Aber wenn’s schon unbedingt wollen, dann tu ihnen doch den Gefallen.“
Timo schüttelte den Kopf. Und in diesem Augenblick erkannte er in sich selbst, dass er Sabrina eigentlich provozieren wollte, dass er sich krampfhaft nach einem Grund umsah, um ihre Liebe zu ihm auf die Probe zu stellen.
„Hör mal zu, Sabrina. Ich möchte das nicht, und ich mache es auch nicht. Entweder bist du damit zufrieden, einen Veith zu heiraten oder ...“
„Aber geh! Timo, was ist denn mit einmal? Warum fängst jetzt damit an. Ich möcht meinen Ausritt machen. Der Wildfang ist ohnehin so nervös. Und jetzt ist er am Stall angebunden. Er wird wie verrückt herumspringen, wenn ich nachher auf ihm reit’.“
„Der Wildfang wird warten“, erklärte Timo. „Ich möchte das jetzt klären. Jetzt und für alle Zeiten. Entweder bist bereit, Timo Veith zu heiraten, aber ein Timo Rezzori wird's nie werden.“
„Willst Streit mit mir, oder warum sagst das so?“, fragte sie und blickte ihn irritiert an.
„Weil ich’s wissen möchte. Dein Vater hat mich schockiert mit dieser Bedingung. Ja, eine Bedingung ist es.“
„Nein. Das ist es net. Er möcht’, dass ich dich heirat'. Aber Mama ...“
„Heiratst mich als Veith oder was sonst?“
Jetzt zögerte sie mit der Antwort, sah ihn ungeduldig an und erhob sich. „Der Wildfang ...“
Weiter ließ sie Timo nicht kommen. „Der Wildfang wart’!“
„Ich möcht aber net, dass er wart’.“
Er versuchte es noch einmal, sie zu überzeugen. „Sabrina“, sagte er, „sag es mir jetzt. Oder du brauchst es mir nimmer sagen. Heiratest mich als Veith oder willst mich net.“
„Aber du könnt’st Papa und Mama den Gefallen tun.“
„Mich vom vertrottelten Rezzori adoptieren lassen? Nein, daraus wird nix. Daraus wird nie und nimmer nix.“
„Ja, wennst meinst? Ich reit jetzt aus. Kannst dir ja alles überlegen.“ Und mit einem versöhnlichen Lächeln fragte sie: „Bist heut Abend da? Es ist unser Abend. Das weißt doch.“
„Ich werd aber net der Rezzori sein. Ich werd immer der Veith bleiben.“
„Ach, geh! Red keinen Schmarrn!“ Sie nickte ihm zu, als wär das weiter nichts und wollte gehen.
Aber er kam um den Tisch herum, ergriff ihren Arm und sagte:
„Sabrina, das ist keine Hetz, keine Gaudi. Das ist mir ganz ernst. Bitterernst ist mir das. Sabrina, wenn wir zwei ein Paar werden wollen, ein Paar für immer, dann bleib ich Timo Veith. Es wird nie und nimmer ein Timo Rezzori daraus.“
Sie erkannte nun, dass es ihm wirklich sehr ernst war, obgleich sie seine Beweggründe offensichtlich nicht verstand.
„Ich kann mich net gegen Mama auflehnen. Begreif das doch“, sagte sie beschwörend. „Ich möcht keinen Streit mit ihr.“
„Also gut, wie du willst.“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Net wie ich will, wie du willst.“
„Kurzum, es ist aus zwischen uns. Ist das richtig?“
Sie wollte erst noch einmal nachgeben. Sie hatte Timo immer gemocht und immer haben wollen. Aber jetzt siegte der Starrsinn in ihr und der Hochmut.
„Wenn'st meinst, es muss aus sein zwischen uns, dann ist’s eben aus“, erklärte sie schnippisch, klatschte sich wieder mit der Reitpeitsche an den Stiefelschaft, wandte sich um, und er ließ sie sofort los, sah ihr nach, wie sie um das Wirtschaftsgebäude herumging und verschwand. Kurz darauf hörte er den Hufschlag des Pferdes, der sich rasch entfernte.
Ich habe es so haben wollen, dachte er. Sie hatte völlig recht. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hatte sagen wollen, die ich einfach habe sagen müssen. Es ist mein Wunsch gewesen, dass es aus sein wird. Die Forderung des Grafen hätte der sicher zurückgenommen. Ein Gespräch mit ihm, ein eingehendes Gespräch, wäre dafür schon genug gewesen. Aber ich habe das in Wirklichkeit gar nicht gewollt. Wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, war ich sogar froh darüber, eine Handhabe zu finden, um mit Sabrina Schluss zu machen. Ich hätte ihr die Wahrheit sagen müssen. Darauf besäße sie einen Anspruch. So gleichgültig ist sie mir doch gar nicht gewesen.
Zwei Stunden später hatte er Gelegenheit zu einer Aussprache, als er Sabrina nach dem Essen wiedertraf. Er hatte gerade die Arbeiten eingeteilt und befand sich auf dem Weg zum Maschinenschuppen, als Sabrina ihm nachkam und ihn dann im Traktorenhaus einholte.
„Timo, ich möchte ein Wort mit dir reden. Ich habe über alles nachdenken müssen.“
Er sah sie abwartend an. „Und?“, fragte er nur.
„Da muss noch etwas sein. Ja, es muss was sein. Sei ehrlich! Bitte, sag mir die Wahrheit!“
Er nickte. „Da ist auch noch etwas. Ich bin mir selbst nicht darüber klargeworden. Voll nicht. Erst nach unserm Gespräch.“ Und dann erzählte er ihr von Roswitha.
Sabrina unterbrach ihn nicht. Sie hörte ihm nur zu. An das große Rad eines Traktors gelehnt, stand sie da und schaute ihn an. Aber in ihrem Gesicht widerspiegelten sich ihre Gedanken. Erst war sie erschrocken gewesen. Aber dann gewann ihr Mitgefühl für Roswitha die Oberhand. Und schließlich, als er fertig war, sagte sie:
„Du hast sie in mir gesehn. Gib’s zu! Du hast sie in mir geliebt. Und nun ist sie wieder da. Vielleicht wird sie sterben. Das hör’ ich aus deinen Worten heraus. Vielleicht hat sie net die Kraft, alles zu überstehn. Aber du wirst immer sie lieben. Du wirst sie mit allen Frauen, mit denen du zu tun hast, sehn. Sie werden Martina, Andrea oder sonst wie heißen, für dich aber immer Roswitha sein. Du wirst nie eine andre lieben, du hast nie eine andere geliebt, und sie hat wohl auch immer nur dich geliebt. Ich bin dir nicht böse. Nein, ich bin dir wirklich nicht bös’, auch wenn du das glaubst. Fahr hinauf zu ihr! Sie braucht dich.“
„Und du?“, fragte er nur. „Brauchst mich net?“
Sie schloss einen Augenblick die Augen und presste die Lippen fest zusammen. Doch dann sah sie ihn wieder an und sagte mit einem trotzigen Lächeln: „Net gar so sehr, wie du glaubst. Wirklich net. Ich kämpf mich schon durch.“
„Soll ich von hier weggehen“, fragte er leise, „mir eine andre Stellung suchen, dann brauchst mir net immer zu begegnen?“
Sie schüttelte heftig den Kopf und widersprach:
„Das darfst net tun. Der Vater braucht dich gar so sehr. Bleib! Bleib, dem Vater zulieb! Bleib mir zulieb! Ich bitt dich darum! Das mit uns beiden ist eine Sach’, das mit dem Betrieb eine andre. Papa hat noch nie einen Betriebsleiter gehabt wie dich. Bleib bei ihm! Und wenn ich eines Tages alles bekomm, dann brauch ich dich noch immer. Bitte, tu’s mir zulieb, wenn noch ein Funken Liebe in dir ist für mich!“
Er ging auf sie zu, nahm sie an den Schultern und küsste sie auf beide Wangen.
„Ist das ein Abschied?“, fragte sie leise, die sie sich zwingen musste, ihm nicht um den Hals zu fallen.
„Vielleicht. Ein Abschied unsrer Liebe.“
Diesmal sagte sie nichts. Sie sah ihn nur traurig an. Aber als er ihren Blick erwiderte, lächelte sie tapfer. „Schon gut. Geh zu ihr! Hilf ihr, damit sie leben kann!“
Er schaute ihr besorgt in die Augen. „Und du?“
Sie lachte. Es klang aber ein wenig zu schrill, um echt zu sein. „Ich werd halt auch damit leben müssen. Und mit der Zeit wird’s schon recht gut gehen. Mach dir keine Sorg um mich!“
Sie wandte sich um und verließ den Schuppen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Mit gemischten Gefühlen blickte er ihr nach.
Zwei Stunden später verließ er den Betrieb, um zu Roswitha zu fahren.
Das Wetter hatte sich verschlechtert. Gewitterwolken waren aufgezogen. Und obgleich es noch Nachmittag war, herrschte Dämmerlicht wie an einem frühen Winterabend.
Noch bevor er Solden erreicht hatte, schüttete es nur so vom Himmel. Blitze und Donnerschläge ließen die Erde erbeben.
Es war mit einem Male so dunkel wie in der Nacht. Die Scheibenwischer huschten hin und her, und trotzdem verschafften sie Timo Veith kaum Sicht. Das Bündel seiner Scheinwerfer tastete sich über die Straße. Timo fuhr langsam. Und als er Solden passiert hatte, wurde die Sicht noch schlechter. Aus dem Regen war Hagel geworden. Er trommelte auf das Wagendach. Doch Timo störte sich nicht daran. Er fuhr weiter und machte sich Sorgen und Roswitha. Alle seine Gedanken kreisten um sie.
Als er durch Rosenholz fuhr, in dem nur etwas mehr als dreißig Einwohner lebten, schoss das Wasser über die Straße, als sei dies jetzt ein Flussbett. Aus dem Poltzbach, der sonst friedlich talwärts floss, war ein reißender Strom geworden. Geröll wurde mitgerissen. Bretter, Äste, alles mögliche lag auf der Fahrbahn. Und noch immer wütete der Sturm, schüttete es vom Himmel. Zum Glück war aus dem Hagel wieder Regen geworden.
Nach St. Hildegard zu stieg die Straße leicht an und lag höher als der Bach. Aber immer wieder konnte Timo Veith im Licht seiner Scheinwerfer sehen, wie der Poltzbach bis an den Straßenrand reichte und gischtend und tosend talwärts schoss.
In St. Hildegard hatte sich die Straße stellenweise auch in einen Bach verwandelt. Aber mit langsamer Fahrt kam Timo voran. An einer Stelle, direkt hinter der Kirche, wurde vom Poltzbach sogar eine Brücke überspült und ein Teil des gemauerten Geländers war weggerissen.
Hinter der Brücke stand der Landrover der Gendarmerie quer auf der Straße.
Timo versuchte, um ihn herumzufahren. Aber das ging nicht. Er hupte, und als sich noch immer nichts rührte, stieg er trotz des strömenden Regens aus, lief zu dem Landrover hinüber und sah erst jetzt, dass jemand in ihm saß. Er erkannte trotz der schlechten Beleuchtung den Gendarmen Heitzinger, der die Segeltuchverkleidung mit dem Zelluloidfenster beiseite schob und Timo grimmig anschaute.
„Was ist? Warum sperren's den Weg?“, fragte Timo.
„Weil's kein Durchkommen net gibt. Ach Sie sind's, der Herr Veith. Ja, wo wollen’S denn hin, Herr Veith? Hinter Stunds ist eine Mur. Die Straße ist verschüttet. Sie kommen net durch, Herr Veith.“
„Dann fahr ich bis dahin und geh den Rest zu Fuß. Ich muss hinauf zur Baustelle, zum Ferdl-Doktor.“
„Aber was wollen'S da, Herr Veith? Sie kommen net durch.“
„Herr Heitzinger, ich muss durch. Ich muss. Sie wissen doch von der Roswitha Lienzer, dass sie droben liegt.“
„Natürlich weiß ich’s.“
„Ich muss zu ihr. Niemand kann sagen, ob sie morgen noch lebt.“
Heitzinger blickte Timo kurz an und sagte rasch entschlossen:
„Herr Veith, stellen Sie Ihren Wagen quer auf die Straßen, und dann steigen'S zu mir. Ich fahr Sie, so weit ich kann.“
„Danke, Herr Heitzinger. Danke“, rief Timo dem Gendarm zu, lief zu seinem Wagen zurück und tat, was ihm Heitzinger geraten hatte. Dann stieg er aus, lief zum Landrover, stieg ein, und Heitzinger fuhr los.
„Ein Hundswetter ist das! Ein verdammtes Hundswetter“, sagte Heitzinger immer wieder. Und Timo, der nun nicht fahren musste, hatte Gelegenheit, ein wenig zur Seite zu sehen und erkannte, wie schlimm dieses Unwetter wütete. Und noch immer kam es ohne Unterlass vom Himmel.
„Festgehängt hat es sich“, sagte Heitzinger. „Es kommt net aus, es hängt im Tal drin.“
Veith kannte das. Wie oft schon hatte er erlebt, dass ein Gewitter stundenlang im Rudeggertal getobt hatte und einfach aus den Bergen nicht herausfand.
Schon vor Stunds war Geröll auf die Straße gekommen, aber nicht so viel, dass Heitzinger mit seinem Landrover nicht darüber hinwegkommen konnte. In Stunds sah es dann schlimmer aus. Die Vorgärten des kleinen Ortes waren regelrecht verwüstet, Zäune lagen auf der Straße, Obstbäume waren angeknickt, und auch hier hatte der Poltzbach stellenweise die Straße überschwemmt und strömte noch immer von den Höhen herab, brachte Geröll mit, und die Macht seiner Flut zerschlug, was nicht niet- und nagelfest war.
Aber der Landrover des Gendarmen trotzte diesen Widrigkeiten. Sie fuhren weiter, kamen noch an der Schirrmühle vorbei, die wie ein Bollwerk von den tobenden Wassern umströmt den Gewalten trotzte.
Ein Stück hinter der Schirrmühle war es dann so weit. Ein Bergrutsch hatte die Straße völlig verschüttet. Von der Straße auf die überspülten Wiesen zu fahren, traute sich Heitzinger nicht. Er zweifelte daran, durchzukommen.
„Sehn’S, Herr Veith, sogar Telefonleitungen sind weg. Alles zerrissen. Alles kaputt.“
Umgeknickte Masten, zerrissene Leitungen, dort, wo die Mur heruntergekommen war, redeten eine eindringliche und überzeugende Sprache.
„Und der Funk? Wie ist es mit dem Funk?“ Veith deutete auf das Funkgerät im Landrover.
Heitzinger lachte zornig. „Da, hören’S selbst, Herr Veith.“ Er schaltete das Funkgerät an. Ein Krachen, ein Pfeifen war darin. Eine Verständigung schien unmöglich.
„Atmosphärische Störungen. Das Gewitter, Herr Veith“, sagte Heitzinger.
„Also dann, packen wir’s!“, meinte Timo und drückte die Tür auf. Der Wind heulte, und Timo musste sich regelrecht gegen den Sturm stemmen. Dann winkte er noch einmal dem Gendarmen zu, und der brüllte ihm nach:
„Gebens auf sich Acht, Herr Veith! Geben’S auf sich Acht!“
Timo winkte nur und kämpfte sich weiter.
Er kletterte über auslaufendes Geröll, und noch immer stand Heitzinger mit seinem Landrover da und schien den Weg dieses einsamen Fußgängers verfolgen zu wollen. Aber dann kam Timo auf der anderen Seite an. Mittlerweile war er völlig durchnässt. Der Lehm hing ihm bis an die Knie. Die Schuhe würde er wegwerfen müssen. Aber es kümmerte ihn nicht. Das Einzige, woran er dachte, war Roswitha.
Vielleicht, sagte er sich, ist dort oben alles kaputt. Hat das Unwetter die Baracken zerstört. Oder nur die Dächer abgerissen.
So eine Baracke, dachte er, ist kein Haus. So etwas trotzt dem Sturm nicht so sehr. Da hat er eine leichte Beute. Roswitha würde es das Leben kosten.
Die verrücktesten Gedanken stürmten auf ihn ein, während er sich weiter kämpfte, völlig durchnässt. Aber dieser selbe Regen spülte ihm auch den Schlamm wieder von den Hosen. Zum Glück war es wenigstens nicht kalt. Unter der nassen Kleidung dampfte Timos Körper. So weit und so hart hatte er lange nicht marschieren müssen wie diesmal.
Stellenweise war die Sicht so schlecht im peitschenden Regen, dass er nicht weiter als zehn Schritt sehen konnte. Aber er war auf der Straße, und der Regen focht ihn fast nicht mehr an. Auch der Sturm nicht, gegen den er sich stemmte.
Zum Glück war die Straße in Steegroden nicht überschwemmt. In dem kleinen Ort, der höher lag als der Bach, hatte nur der Sturm Verwüstungen angerichtet. Dachschindeln lagen auf der Straße, und auch hier Zäune umgestürzt, Äste abgeknickt, Blüten zerstreut von den Apfelbäumen wie Schnee.
Er erblickte keine einzige Menschenseele, und rasch hatte er Steegroden hinter sich. Jetzt ging es bergauf, die Serpentinen empor. Aber von der Baustelle sah er nichts. Auch nicht von der Talsperre.
Der Gedanke an die Staumauer verursachte ihm eine Gänsehaut auf dem Rücken. Wenn die nun dem Druck der Wassermassen nicht standgehalten hatte? Denn noch war sie nicht fertig. Vielleicht vermochte das Bauwerk ein solches Unwetter gar nicht zu überstehen? Und dann würde das bereits angesammelte Wasser als eine gewaltige Flut übers Tal schütten und alles wegschwemmen, was unterhalb stand. Ein entsetzlicher Gedanke.
Er keuchte, schwitzte aus allen Poren, als er den Weg mehr hinaufrannte als ging.
Er kürzte ab. Die Lastwagen fuhren die Serpentinen aus, aber er ging den geraden Weg, der steil bergan führte. Am liebsten wäre er geflogen, nur um schneller hinaufzukommen, um zu sehen, was mit den Baracken ist ... und was mit Roswitha ist. Um sie drehte sich alles.
Er musste auch an Sabrina denken. Ihre großmütige Art hatte ihn beschämt. Aber doch war er sich selbst und seine Gefühle klargeworden. Sie hat ja recht gehabt. Sabrina hatte ja das ausgesprochen, was wirklich in ihm vorging.
Ich habe wirklich Roswitha vor Augen gehabt, als ich Sabrina liebte. Immer ist es Roswitha gewesen. Wie konnte ich nur so blind sein, es selbst nicht zu erkennen? Und ich glaube, sogar Ferdl hat es gewusst, genau wie Sabrina es wusste ...
Immer noch zuckten Blitze vom Himmel. Und plötzlich mischte sich ein anderes Geräusch unter das Donnergrollen. Ein Geräusch, dass Timo Veith sehr gut kannte: das Geräusch einer Lawine!
Es klang, als würden Kohlen geschaufelt. Aber dazwischen mischte sich ein Dröhnen und Poltern, ein Rauschen, und dann bebte die ganze Erde.
Entsetzt sah sich Timo, der stehen geblieben war, nach allen Seiten um. Wo ist sie, dachte er? Woher kommt sie?
Und während sich am Horizont wieder ein Silberstreif an Helligkeit zeigte, erkannte Timo, wie diese Lawine von der Schwerdtner Alpe in die Schlucht zur Stundser Alpe herunterschoss, Bäume mitriss und mit Getöse ihre Straße zog, um mit einem urigen Gepolter in die Schlucht zu stürzen.
Es dauerte einige Minuten. Ergriffen von diesem Naturschauspiel stand Timo Veith wie gebannt.
Und als hätte sich das Gewitter mit diesem grausigen Vorfall verabschieden wollen, riss auf einmal die Wolkendecke auf, wo es eben noch wie Nacht gewesen war, wurde es heller, der Regen ließ nach, das Gewitter zog nach Süden zu in Richtung auf den Similaun ab.
Timo hastete weiter, keuchend, dampfend vor Hitze und völlig durchnässt, erreichte den ersten Absatz zur Höhe und konnte von hier aus die Baracken sehen. Und soweit er es erkennen konnte, standen sie alle noch. Nichts hatte sich verändert.
Es hörte auf zu regnen. Und mit einem Male strahlte die schon tief stehende Sonne wieder über das Tal. Gleißend hell, unwirklich fast. Ein Regenbogen bildete sich über der Kalkspitz Alpe, von der eben noch eine Lawine in die Schlucht geschossen war.
Je näher Timo den Baracken und der Krankenstation kam, umso deutlicher konnte er erkennen, dass alles noch heil war. Natürlich lag auch hier alles mögliche herum. Aber es gab hier oben keine Bäume, die umgerissen werden konnten. Und die Baracken waren zusätzlich durch Stahlseile im Fels verankert.
Als Timo die Baracken fast erreicht hatte, kam gerade jemand aus der Krankenstation heraus. Der Kreuzbechner war es, der Baustellensanitäter.
Er hielt der tief stehenden Sonne wegen die Hand schirmend über die Augen und blickte Timo entgegen, ohne ihn offenbar zu erkennen. Aber dann, als Timo noch näher heran war, wusste Kreuzbechner, wer da kam und rief: „Herr Veith, wo kommen Sie denn her?“
Timo Veith war viel zu sehr außer Atem, um sofort antworten zu können. Aber dann stand er vor Kreuzbechner, noch immer japsend um Atem ringend und keuchte:
„Alles ... alles in Ordnung hier oben? Alles mit Roswitha Lienzer ...“
„Aber ja. Freilich ist alles in Ordnung. Wo kommen’S denn her? Sind’S zu Fuß ...?“
Timo nickte. Er konnte nicht sagen, dass hinter Stunds ein Erdrutsch war. Dazu war er viel zu erschöpft. Er taumelte an Kreuzbechner vorbei auf die Tür zu, Kreuzbechner überholte ihn noch, öffnete ihm die Tür und rief ins Innere der Baracke hinein: „Der Herr Veith ist kommen. Zu Fuß. Ganz nass ist er.“
Da tauchte schon Ferdl Dammeier auf, sah den Freund fassungslos an und stellte dieselben Fragen wie Kreuzbechner.
Irgendwer reichte Timo eine Tasse heißen Kaffee, und er trank auch einen Schluck, und dann stand er vor Roswithas Bett, Dammeier neben ihm und natürlich Erika Meindl.
Obgleich es schon wieder so hell war, dass genug Licht durch die Fenster schien, brannte die Lampe noch im Raum. Niemand war auf den Gedanken gekommen, sie auszuknipsen.
Roswitha blickte verwundert auf Timo. Sie machte einen wachen, lebhaften Eindruck. Es ging ihr besser. Viel besser schon seit gestern. Irgendwer erklärte das auch. Timo hätte nicht sagen können, wer es war. Er sah nur Roswitha.
„Die Straße war verschüttet“, stieß er, noch immer atemlos, hervor. „Aber ich wollt’ zu dir. Ich hab mir Sorgen gemacht um dich, riesige Sorgen.“
„Aber warum?“, fragte Roswitha überrascht. „Mir geht es gut. Ich hab kaum mehr Temperatur.“
„Es geht ihr wirklich gut“, sagte Dr. Meindl. „Ich glaub, dass wir es schaffen.“
Und dann ließen sie Timo, so nass, wie er war, mit Roswitha allein. Niemand verlangte, dass er sich einen weißen Kittel umhängte oder sich umzog oder sich die Hände schrubbte. Er stand neben Roswithas Bett, und von ihm tropfte es herab. Sie sagte, er solle sich setzen, aber er stand nur da, als hörte er gar nicht, was sie da sprach. Er musste sie anschauen, immer wieder, und dann plötzlich sagte er:
„Wenn du wieder gesund bist, Roswitha, heiraten wir. Willst du mich?“
Sie sah ihn nur an und gab ihm keine Antwort. Aber ihre Augen waren ihm Antwort genug.
Sie hatten ihn allein gelassen mit Roswitha, und so tat er etwas, was ihm sein Freund, Ferdl Dammeier, nicht erlaubt hätte. Aber er musste es tun. Er konnte gar nicht anders. Er beugte sich über Roswithas Gesicht, und dann berührten seine Lippen die ihren. Bereitwillig, wie es ihm schien, erwartete sie seinen Kuss. Ein Kuss, der so war wie damals vor zwölf Jahren. Und es kostete ihn Überwindung, sich wieder von ihr zu lösen, sich aufzurichten, während sie ein wenig atemlos zu ihm aufblickte und ihn mit Glückseligkeit in den Augen anlächelte.
„Ich liebe dich“, sagte er zärtlich. Sie erwiderte so leise, dass er Mühe hatte, es zu hören: „O Timo, dass du das sagst, darauf hab ich immer gehofft. Ich lieb dich ja auch so ...“