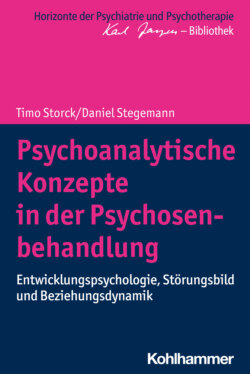Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Grundpfeiler der psychoanalytischen Theorie
ОглавлениеEin wesentliches Merkmal der psychoanalytischen Theorie ist der Einbezug eines dynamisch Unbewussten in die Theorie des Psychischen. Freuds Anliegen ist es, eine »Metapsychologie« zu formulieren, worunter er eine »hinter das Bewußtsein führende Psychologie« (Freud 1985, S. 329) versteht, also eine Psychologie, in der es konzeptuell ein Unbewusstes gibt, das nicht außer-psychisch ist. Freud will sich »achselzuckend über diese Idiosynkrasie der Philosophen hinaussetzen« (Freud 1925d, S. 57) und das Unbewusste ins Psychische einbeziehen2. Freud hält es für »eine unhaltbare Anmaßung zu fordern, daß alles, was im Seelischen vorgeht, auch dem Bewußtsein bekannt werden müsse« (1915e, S. 265). Dabei geht es im Besonderen um ein dynamisch Unbewusstes, also um ein Unbewusstes, das mit einem innerpsychischen Kräftespiel aus drängenden und verdrängenden Kräften im Zusammenhang steht. Zunächst konzipiert er dazu das sogenannte topische Modell des Psychischen, in dem dieses aus »Systemen« (Bewusst, Vorbewusst, Unbewusst) zusammengesetzt gedacht wird, später das Instanzen-Modell aus Ich, Es und Über-Ich (vgl. z. B. J. Sandler et al. 1997). In diesen Modellen werden psychische Konflikte konzeptualisiert.
Freud postuliert das Lustprinzip als Kern menschlicher Motivation (neben dem Realitätsprinzip, das letztlich aber nur eine auch sozial ausgerichtete Sonderform des Lustprinzips ist; Freud 1911b): Lust wird gesucht, Unlust vermieden. Lust bzw. Befriedigung empfinden wir Freud (1915c, S. 214) zufolge bei der »Herabsetzung« der Intensität eines Reizes, Unlust bei deren Ansteigen bzw. anhaltend hohem Niveau. Nun kann es Erlebniszustände geben, in denen das Motiv, Lust zu suchen, und das Motiv, Unlust zu vermeiden, gegeneinanderstehen. Es entsteht ein psychischer Konflikt: Eine Handlung oder Handlungsvorstellung verspricht Lust, zugleich aber auch unlustvolle Folgen, zum Beispiel Scham angesichts eigener Wünsche. Infolgedessen setzen Abwehrmechanismen ein, die
• sich gegen einen inneren Reiz richten,
• die Vermeidung unlustvoller Gefühle (Angst, Scham, Schuldgefühle) als Ziel haben und
• unbewusst wirken müssen, um ihr Ziel zu erreichen.
Durch die Abwehr wird etwas, durch Verdrängung, vom bewussten Erleben ferngehalten, aufgrund dessen »lustversprechender« Eigenschaften drängt es jedoch weiter ins Bewusstsein, so dass eine Umarbeitung, zum Beispiel eine Verschiebung oder eine Projektion, hinzutreten muss, damit es eine bewusstseinsfähige, aber »entstellte« Form der Vorstellung geben kann.
Ein solches Verständnis des Wirkens psychischer Konflikte ist nicht auf eine Theorie psychischer Störungen beschränkt, sondern wird in der Psychoanalyse zum wesentlichen Teil der Theorie des Menschen und seiner Entwicklung. Im Konfliktbegriff findet die Psychoanalyse ihre Theorie der speziellen Motivation (Storck 2018c): Einzelne psychische Zustände und Prozesse sind wesentlich davon gekennzeichnet, psychische Konflikte zu bewältigen. Das geht zumindest bei Freud (1900a, S. 607) so weit, dass er das Denken als solches als einen »Umweg« bezeichnet: Zwischen aktueller Wahrnehmung und Motilität schalten sich Erinnerungsspuren als Niederschlag vorangegangener lustvoller und unlustvoller Wahrnehmungen ein und hemmen u. U. einen unmittelbaren, primärprozesshaften »Erregungsablauf«. Für diese Hemmung ist bei Freud das Ich zuständig: Für Lust/Befriedigung wird ein Weg gesucht, der wenig Unlust mit sich bringt. Ein solches sekundärprozesshaftes psychisches Funktionieren kennzeichnet das Denken in seinen Grundzügen.
Lust und Unlust sind die basalen Erlebnisqualitäten, die sich dann in weitere Affekte ausdifferenzieren. Zunächst handelt es sich bei beiden aber um die qualitativen Erscheinungsformen von Erregung im Psychischen. Dabei kommt das Triebkonzept ins Spiel, hier im Sinne der metapsychologischen Schriften der 1910er Jahre. Freud (1915c, S. 214) kennzeichnet »Trieb« als einen »Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem«. Als »Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle« (1905d, S. 67) stellt er in seiner Quantität (als Trieb-Drang) für das Psychische das »Maß an Arbeitsanforderung« (Freud 1915c, S. 214) dar. Aufgrund von Erregungszuständen, die unsere Körperlichkeit mit sich bringt, sind wir dazu getrieben, uns einen psychischen »Reim« darauf zu machen, was in uns vorgeht. So drängen sich uns erste psychische Erlebnisformen gleichsam auf, innere Bilder von Zuständen und Interaktionen. Im Wesentlichen ist »Trieb« dann ein psychosomatisches Konzept, denn es bezieht sich auf eine Vermittlungsfunktion zwischen Körperlichkeit und Erleben. Es ist aber auch sozialisatorisch, denn die Zustände von Erregung (und Beruhigung) sind immer eingebunden in sinnliche Erlebnisszenen mit anderen. Der Grundgedanke, dass sich Erregung (also eine Quantität, die größer oder kleiner wird) sich in qualitativ bestimmtes Erleben umsetzt, führt zur Kennzeichnung der Triebtheorie als einer Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen. Sie zeigt an, wie Psychisches als solches motiviert ist (Storck 2018b).
Die psychoanalytische Theorie erschöpft sich nicht in der Konzeption motivationaler Konflikte, sondern schließt auch repräsentationale ein (Storck 2021a). Es können nicht nur Lust und Unlust oder widerstreitende Affekte miteinander in Konflikt stehen, sondern auch verschiedene Aspekte des Erlebens von Selbst und anderen. In der Psychoanalyse taucht die psychische Repräsentanz anderer als »Objekt« auf. Damit ist keine Vergegenständlichung gemeint, sondern der Terminus entsteht aus der Triebtheorie, in welcher das (Trieb-)Objekt als »das variabelste am Triebe« (Freud 1915c, S. 215) auftaucht, als das am stärksten von der Erfahrung abhängige an ihm. Die andere der Interaktion ist selbst im Triebkonzept immer mitgedacht, ebenso wie in der psychoanalytischen Theorie der Sexualität. Dezidiert taucht hier in der Psychoanalyse ein erweiterter Begriff von Sexualität auf (Freud 1905d, S. 35): Sexualität meint dabei die Empfindung von Lust bzw. Befriedigung auf der Grundlage der Körperlichkeit. Dann ist folgerichtig von einer infantilen Sexualität zu sprechen und das Verständnis von Sexualität über den Bereich des Genitalen hinaus auszudehnen. Vor diesem Hintergrund steht die Theorie der psychosexuellen Entwicklungsphasen. Wie unten ( Kap. 2.1.2) genauer ausgeführt werden wird, beginnen diese nicht erst mit der oralen Phase, sondern mit begrifflich bei Freud ungenau gefassten Phasen von Autoerotismus und (primärem) Narzissmus (z. B. Freud 1914c, S. 142).
In psychoanalytischer Betrachtung haben ödipale Konflikte eine wesentliche Funktion für die Entwicklung und Struktur des Psychischen. Für Freud (z. B. 1916/17, S. 342ff.) geht es dabei im Wesentlichen um die ins 5./6. Lebensjahr verortete Rivalität mit dem einen Elternteil um die Nähe zum anderen. Das wird gemäß der erweiterten Konzeption als sexuell bezeichnet, meint aber nur in seinen Abweichungen den Wunsch nach genitaler Sexualität. Freud beschreibt die Konstellation für Mädchen und Jungen bezüglich Vater und Mutter in allen Konstellationen (also auch die Wünsche des Jungen nach Nähe zum Vater und Rivalität mit der Mutter), allerdings findet es sich für den Jungen und dann in seiner »positiven« Form (also Rivalität mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil um die Nähe zum gegengeschlechtlichen) deutlicher ausformuliert. Es geht dem Jungen darum, den Vater als Rivalen an der Seite der Mutter zu beseitigen. Konflikthaft ist das zum einen aufgrund der Straferwartung durch den Vater, zum anderen aufgrund der Tatsache, dass der erfüllte Wunsch, der Vater möge »weg« und beseitigt sein, eben nicht nur lustvoll ist, sondern auch schmerzhaft: Würde der Vater tatsächlich von der Bildfläche verschwinden, wäre es ein Verlust – der geliebte Vater wäre verloren und dies auch als jemand, der die Nähe zur Mutter zu regulieren helfen könnte. Darin besteht der eigentliche ödipale Konflikt im Psychischen. Die Erfüllung der lustvollen Wünsche gegenüber der Mutter und der aggressiven gegenüber dem Vater würde Unlust nach sich ziehen: Angst vor unregulierter Nähe zur Mutter, Schuldgefühle und Straferwartung angesichts der Aggression und Schmerz/Trauer angesichts des verlorenen, ebenfalls geliebten und ersehnten Vaters. Die Lösung im Freud’schen Sinn (1924d) besteht in der Identifizierung: So zu sein wie der Rivale kann heißen, dass jemand einen selbst einmal so lieben wird wie die Mutter den Vater liebt. Da ödipale Wünsche und Konflikte in verschiedenen Konstellationen auftauchen, geht es ebenso um Identifizierungen mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil.
Es liegt auf der Hand, dass ein Erleben und Empfinden in Dreier-Konstellationen nicht erst im 5. Lebensjahr beginnt. Klein (1928) beschreibt »Frühstadien des Ödipuskonfliktes«, und in einer solchen Sicht geht es bereits in den ersten Stadien der psychischen Entwicklung darum, dass Zustände von Frustration oder von passagerer Abwesenheit einer Bezugsperson eingebettet sind in ein Beziehungsangebot von mehr als einer Person. Exploration als die relative Entfernung von einer Bezugsperson ist dann möglich, wenn
• diese einen »sicheren Hafen« bereitstellt, zu dem man zurückkehren kann und
• das Sich-Entfernen von ihr bedeuten kann, zu jemand anderem in Beziehung zu treten.
Dabei ist entscheidend, die Erfahrung zu machen, dass die Personen, zu denen jemand in Beziehung steht, auch zueinander in Beziehung stehen (z. B. bei Green 1975). Das wäre eine zeitgenössische Lesart der Freud’schen Rede von der Urszene. Während diese bei Freud (z. B. 1900a, S. 590f.) noch sehr konkret darauf bezogen ist, dass das Kind Mutter und Vater beim Geschlechtsverkehr sieht, ist das Wesentliche darin, dass Mutter und Vater »hinter verschlossener Tür« etwas miteinander teilen, von dem das Kind passager ausgeschlossen ist (so z. B. bei Britton 1998, S. 157ff.). Dann ist es ein Sinnbild dafür, in der Welt nicht nur andere, sondern auch deren Beziehungen zueinander zu finden. Auf diese Weise lassen sich ödipale Konflikte allgemein auf die Auseinandersetzung mit Generationen- und Geschlechtsunterschieden beziehen sowie auf die Auseinandersetzung damit, dass es in der Welt Beziehungen gibt, die andere miteinander haben, also ein Beziehungsgeflecht, anstatt dass alle Beziehungen ausschließlich von einem selbst wie in einem Sonnensystem »wegstrahlen«. In dieser Betrachtungsweise werden ödipale Konflikte auch maßgeblich für Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Eltern oder mit einem alleinerziehenden Elternteil aufwachsen, denn auch dann wird das Kind mit der Erfahrung konfrontiert sein, dass eine Bezugsperson noch auf etwas oder jemand anderes bezogen ist.