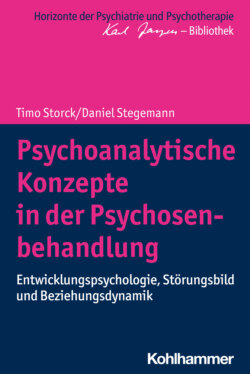Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.3 Methodologie des Verstehens
ОглавлениеDamit ist auch die Grenze des Verstehens und des Verstehbaren berührt. Für Jaspers habe die Psychoanalyse grenzenlos alles als verstehbar erachtet. Auch von innerhalb der Psychoanalyse wurde Kritik geäußert, so etwa von Thomä und Kächele (1973), die das Evidenzerleben, das auch von Lorenzer (1970) für das psychoanalytische Verstehen herangezogen wird, als unzureichend betrachten. Es müsste »extraklinisch« validiert werden. Mit anderen Argumenten spricht Bion (1991, S. 578) vom Verstehen als größtem Schreckgespenst, Lacan (1964, S. 14) von einer »hermeneutischen Vindizierung« (er gibt auch, gerade im Zusammenhang der Psychosen, den Hinweis, sich vor dem Verstehen zu hüten; Lacan 1955/56; Kap. 3.4.1), Fink (2010) ruft einen »Wider den Verstehenszwang« aus und Laplanche (1995, S. 617) postuliert »Hände weg von der Hermeneutik«. Dabei geht es darum, dass die Psycho-Analyse zerlegend versteht (also die Zusammensetzungen und Ablenkungen) statt Bedeutungen einzusetzen.
Hier allerdings die Psychoanalyse der Hermeneutik schlicht entgegenzustellen, greift zu kurz, denn es übersieht Positionen innerhalb der philosophischen Hermeneutik, von der die Psychoanalyse profitieren kann. Zunächst einmal liefert das »kanonische« Werk der philosophischen Hermeneutik des 20. Jahrhunderts, Gadamers (1960) Wahrheit und Methode, Anknüpfungspunkte, etwa wenn es darin heißt, dass Verstehen immer ein Andersverstehen sei, was neben der Kontextualität auch die Perspektivität des Verstehens unterstreicht. »[I]n jedem Augenblick, d. h. in jeder konkreten Situation« müsse »neu und anders verstanden werden« (a. a. O., S. 292). Ebenso wie Jaspers auf die Grenze des Verstehens hinweist, entwickelt Angehrn (2010) in umfassender Weise eine Art von Taxonomie des Nicht-Verstehens, indem er die Grenzen des Sinnverstehens diskutiert.
Der Gedanke des Negativen in der Hermeneutik wird psychoanalytisch von Küchenhoff & Warsitz (2017) aufgenommen, die betonen, dass psychoanalytisches Verstehen im Wesentlichen darin besteht, den Spuren des Abwesenden nachzugehen, also das zu verstehen, was in der Rede umkreist und nicht gesagt wird, sich aber gerade darin einem möglichen Zugang zeigt. Das Subjekt artikuliert sich nur »über den Selbstentzug der Worte, in denen es sich auszudrücken versucht« (a. a. O., S. 206). Ähnlich heißt es bei Lacan (1955/56, S. 137): »Der Zustand der Sprache zeichnet sich ebensowohl durch das, was in ihr abwesend ist wie durch das, was in ihr anwesend ist, aus.«
Das kann dazu führen, für psychoanalytisches Verstehen methodologisch (und klinisch) ein Zusammenwirken von Verstehen und Nicht-Verstehen in einer negativen Hermeneutik zu formulieren (Storck 2016). Methodologisch würde es zum einen um die Grenzen des Verstehens gehen, dann um das Entzogensein des zu verstehenden Sinns und schließlich um die Differenz derjenigen, die in der Analyse etwas verstehen wollen. Klinisch geht es um die Beachtung des Nicht-Verstehens oder Missverstehens, welches die Grundlage dafür liefert, über das wechselseitige Andersverstehen zu einem Veränderungsprozess zu gelangen, in dem eine Analysandin in ihrem Erleben die Möglichkeit erwirbt, alternative Formen des Selbstverstehens zu erlangen als die im Symptom erstarrten.