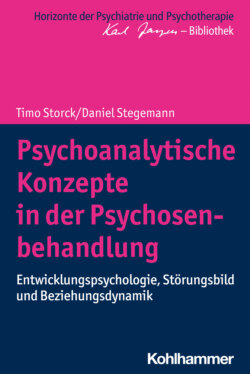Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Klinisches Verstehen
ОглавлениеMethodisch steht die Psychoanalyse dort vor ihrer größten erkenntnistheoretischen Schwierigkeit, wo es darum gehen soll, Unbewusstes zu verstehen, und zwar im Besonderen das dynamisch Unbewusste (das gerade nicht »außerbewusst« ist, wie Jaspers meint; Jaspers 1946, S. 452; dazu wäre kausales Erklären nötig; vgl. Jäger 2016, S. 23). Bei Jaspers heißt es allgemein: »Für den Inhalt der Vorgänge im Unbewußten können natürlich nur verstehbare Vorgänge im Bewußten die Anschauung geben« (Jaspers 1946, S. 451). Freud (1915e, S. 264) meint, man erkenne das Unbewusste »nur als Bewußtes, nachdem es seine Umsetzung oder Übersetzung in Bewußtes erfahren hat«.
Während es in Freuds Werk sehr prominent um (unbewusste) Bedeutungen geht, so finden sich doch nur wenige Bemerkungen zu einer Theorie oder Methodik des Verstehens. Freuds explizite Bemerkungen dazu beschränken sich im Grunde darauf, auf »symptomatische« Formen des Verstehen-Müssens in der Zwangsneurose oder im Wahn hinzuweisen oder herauszustellen, dass man nicht zu schnell verstehen, sondern ausreichend lang gleichschwebend aufmerksam bleiben solle (Freud 1916/17, S. 188). Eine eher versteckte Bemerkung Freuds (1950a, S. 457) weist auf das Verstehen als ein Zerlegen in einen verständlichen, »dem Ich aus eigener Erfahrung bekannten« Teil und einen übrigbleibenden, »unassimilierbaren« Rest hin.
Psychoanalytische Bedeutungstheorie hat ihre Stärke darin, sich an den Assoziationen zu orientieren statt an vorgefertigten, überindividuellen Bedeutungen. Das Wesentliche etwa an der Traumdeutung (für Freud 1900a, S. 613f.) immerhin via regia zum Unbewussten) ist nicht deren katalogisierbare Symbolik, sondern das, was der Träumenden in der analytischen Stunde dazu in den Sinn kommt. In der Tat hängt jede psychoanalytische Deutung in der Luft, solange sie nicht zwei Aspekte zentral berücksichtigt: erstens die assoziativen Verbindungen, zweitens die analytische Beziehung.
Freud (1910a, S. 30f.) benennt als Grundregel der Psychoanalyse als Behandlungsmethode, dass die Analysandin ihre freien Einfälle äußert, ohne eine Auswahl im Hinblick auf Sinn, Logik, Höflichkeit oder Kohärenz zu treffen. Diese so genannte freie Assoziation ist natürlich alles andere als frei, denn sie zeigt die Verbindungen innerhalb der Vorstellungswelt. Folgt die Analysandin der Regel der freien Assoziation, dann zeigen ihre Einfälle die Determiniertheit durch unbewusstes Material, dabei aber vielmehr die Ablenkungen und Zensurierungen als »das Unbewusste« als solches. Bedeutungspraktisch ist daran anknüpfend zu sagen, dass nicht einer Maßgabe von »A bedeutet B« gefolgt wird, sondern »Es ist bedeutsam, dass A auf B folgt« (d. h. dass beide miteinander in Verbindung stehen).
In einer analytischen Stunde soll der rationale Verstand relativ in den Hintergrund treten, so dass andere Aspekte deutlich werden, die das Erleben leiten. Meist wird das mit der Regressionsförderung in Verbindung gebracht und dies liefert die Begründung für das Couch-Setting in der Psychoanalyse, für die hohe Wochenstundenfrequenz und die abwartend-zuhörende Haltung der Analytikerin. All das soll es der Analysandin erleichtern, spontanen und u. U. irrationalen Erlebnisanteilen Raum zu geben sowie verinnerlichte Beziehungsmuster einzubringen (Storck 2021b).
Dazu gehört das, was sich »in der Übertragung« zeigt. Im Freud’schen Werk lassen sich zwei Bedeutungsebenen des Übertragungskonzepts unterscheiden (Storck 2020a): eine weiter gefasste und eine engere. In der weiter gefassten Konzeption (vgl. a. Bollas 2006) meint Freud (1900a, S. 568) mit Übertragung allgemein die Übertragung/Verschiebung der Intensität einer Vorstellung auf eine andere, »harmlosere«. Er vergleicht das mit dem »Tagesrest« im Traum, also denjenigen aktuellen Wahrnehmungen und Erlebnisbildern, die im Traum gleichsam die Bühne oder Kostümierung für andere Themen liefern. Übertragung ist hier das Mittel für ein entstelltes, verkleidetes Bewusstwerden. In der engeren Begriffsfassung (z. B. in Freud 1905e, S. 279f.) geht es dann konkreter um die Übertragung von Aspekten einer früheren Beziehung auf eine aktuelle, vor allem, aber nicht allein, die Beziehung zur Analytikerin. Das Konzept zeigt, wie sich der Niederschlag vorangegangener Beziehungserfahrungen immer im aktuellen Erleben von Beziehungen äußert. Dies wird in analytischen Behandlungen besonders genutzt und vertieft. Die Regressionsförderung soll es auf den Weg bringen, die Analytikerin im Lichte früher, internalisierter Beziehungserfahrungen zu erleben. Freud (1914g, S. 134f.) nennt diese Vertiefung der Übertragung in der Psychoanalyse das Herstellen einer Übertragungsneurose (den Begriff verwendet er mal, wie hier gemeint, behandlungstechnisch, mal nosologisch). Mit der Übertragungsneurose ist die Zentrierung der (neurotischen) Symptome auf die Analytikerin gemeint, was zum einen die weiteren Beziehungen der Analysandin vor entsprechenden Inszenierungen schützt, zum anderen erst dafür sorgen kann, dass in der Analyse etwas verändert werden kann: nämlich, weil es affektiv präsent und verstehbar wird (vgl. zur Übertragungspsychose Kap. 5.2).
Das klinische Verstehen in der Psychoanalyse ist dabei ein beziehungshaftes. Es wird nicht abstrakt verstanden, was bei einer Analysandin anderswo passiert, sondern das, was sich zwischen beiden Beteiligten zeigt – Übertragungsfiguren ebenso wie Aspekte der Gegenübertragung auf Seiten der Analytikerin. Übertragung und Gegenübertragung stehen dabei einander nicht gegenüber, logisch oder zeitlich, sondern sind Teil von Beziehungsszenen. Argelander (1967) oder Lorenzer (1970) haben das psychoanalytische Verstehen daher, dem logischen und psychologischen Verstehen zur Seite stehend, als szenisches Verstehen konzipiert. Während logisch verstanden wird, was eine Analysandin sagt, und psychologisch, wie sie es sagt und was es für sie bedeutet, wird szenisch verstanden, welche Art von Beziehung sich zwischen Analytikerin und Analysandin in Szene setzt.
Das ist die wichtigste Antwort auf die Frage danach, wie die Psychoanalyse das Problem des Verstehens von (dynamisch) Unbewusstem bewerkstelligen will. Es wird davon ausgegangen, dass eine Analysandin verschiedene »Szenen« in die Analyse hineinbringt: Szenen, über die sie aus ihrer Biografie, besonders der Kindheit, spricht, Szenen, die in ihrem aktuellen Leben eine Rolle spielen und letztlich auch Szenen, die sich zwischen ihr und der Analytikerin ereignen. Lorenzer (1970) geht davon aus, dass in diesen jeweils partikularen Szenen eine »Situation« oder »situative Gestalt« erkannt werden kann, eine Art von gemeinsamem Grundgerüst, das die jeweils einzelnen Szenen, zumal im Fall der Einengung des Erlebens im Rahmen einer psychischen Störung, trägt. Da die Analytikerin Teil einiger Szenen der Analysandin ist, kann sie ihre (Selbst-)Beobachtung (in) dieser Szene dazu nutzen, Verstehenshypothesen zu entwickeln, die dann, hypothetisch, etwas davon zeigen, was auch zwischen der Analysandin und anderen eine Rolle spielt.
So können nicht-triviale und nicht-beliebige Verstehenshypothesen gebildet werden. Teilt die Analytikerin sie ihrer Analysandin verbal mit, kann von einer Deutung gesprochen werden, deren Wert in der zeitgenössischen Psychoanalyse in allererster Linie darin liegt, dass und wie sich der gemeinsame Verstehensprozess danach weiterentwickelt. Psychoanalytisches Verstehen ist dabei also immer unabgeschlossen.