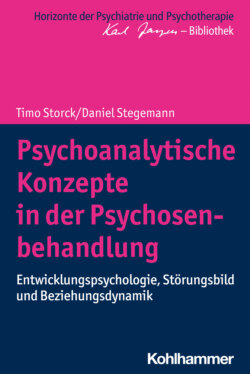Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Die Kritik Jaspers’ am psychoanalytischen Verstehen
ОглавлениеFür Jaspers (1946) gibt es zwei Formen subjektiver Methoden in der Psychopathologie: das statische und das genetische Verstehen (vgl. Heinz 2002, S. 38ff.; Jäger 2016, S. 23ff.; Bormuth 2018, S. 40ff.). Dabei gilt der vielzitierte Satz: »Durch Hineinversetzen in Seelisches verstehen wir genetisch, wie Seelisches aus Seelischem hervorgeht« (Jaspers 1946, S. 250). Kausales Erklären hingegen geschieht »[d]urch objektive Verknüpfung mehrerer Tatbestände zu Regelmäßigkeiten auf Grund wiederholter Erfahrungen« (a. a. O.). Im genetischen Verstehen können ein rationales Verstehen und ein einfühlendes Verstehen unterschieden werden. Letzteres führe »in seelische Zusammenhänge selbst« hinein (a. a. O., S. 253). Während die »Anerkennung der Wahrnehmungsrealität und Kausalität« die Voraussetzung der Naturwissenschaft sei, sei die Anerkennung der »Evidenz des genetischen Verstehens« – eine unmittelbare Evidenz, »die wir nicht weiter zurückführen können« und die »aus Anlaß der Erfahrung gegenüber menschlichen Persönlichkeiten gewonnen« werde – die »Voraussetzung der verstehenden Psychologie« (a. a. O., S. 252). Da allerdings eine Evidenz verständlicher Zusammenhänge nie beweise, dass ein Zusammenhang auch wirklich sei, sei Verstehen immer »mehr oder weniger ein Deuten«, so dass genetisches Verstehen »nicht zu Theorien« führe, sondern ein »Maßstab« sei, »an dem einzelne Vorgänge gemessen und als mehr oder weniger verständlich erkannt werden« (a. a. O.). Verstehende Psychologie führe daher nie zu »bewiesenen, sondern nur zu wahrscheinlichen Resultaten« (a. a. O., S. 260).
An der Psychoanalyse, in deren »Ursprung« für ihn bereits »der Teufel« steckt (in einem Brief an V. v. Weizsäcker von 1953; zit. n. Bormuth 2018, S. 15), kritisiert Jaspers zum einen deren Vorgehen als ein »Als-ob-Verstehen«, zum anderen hält er ihr vor, aus (pseudo-)verstandenen Zusammenhängen eine Theorie zu bilden, was nur durch kausales Erklären möglich wäre (vgl. zur Geschichte von Jaspers’ Psychoanalysekritik Bormuth 2018, dort auch zum historischen Verlauf zwischen 1913 und 1968; wir beschränken uns im vorliegenden Rahmen weitgehend auf die Kritik am Freud’schen Verstehensbegriff sowie der Theoriebildung).
Die Psychoanalyse ist für Jaspers ein »verwirrendes Durcheinander psychologischer Theorien« (Jaspers 1946, S. 299), als Lehre eine »Glaubensbewegung«, als Schule eine »Art von Sekte« (a. a. O., S. 646). Er wirft ihr vor, »Popularpsychologie« und ein »Massenphänomen« auf »dem tiefen Niveau der Durchschnittlichkeit« zu sein, die »mitschuldig« sei, »an der geistigen Niveausenkung der gesamten Psychopathologie« (a. a. O., S. 300). Zwar werde in ihr »verstehende Beobachtung« intensiviert (a. a. O., S. 300), jedoch in Form eines »als-ob-Verstehens« (a. a. O., S. 255). Es herrsche eine »entlarvende, negierende« »Grundstimmung des Dahinterkommens« und man werde »in eine Welt nicht nur unbewiesener, sondern nicht einmal wahrscheinlicher, ausgedachter, alle verstehbaren Erscheinungen hinter sich lassender Hypothesen geführt«. Die Psychoanalyse sei den Grenzen des Verstehens gegenüber blind geblieben: »Sie wollte alles verstehen« (a. a. O., S. 300ff.).
Jaspers (1946, S. 340) meint, man habe »vieles für verständlich erklärt, das es gar nicht ist« (vgl. zur psychiatrischen »Verständnislosigkeit« Schlimme 2008), und sein Vorwurf an die Psychoanalyse lautet, sie habe »durch Anwendung eines […] ins Grenzenlose führenden Verfahrens eigentlich beinahe alle Inhalte dieser Psychosen [Wahnideen bei Schizophrenen; d. Verf.] ›verstanden‹« (Jaspers 1946, S. 341). Dementsprechend scharf fällt sein Urteil aus. Die Schriften der Schüler Freuds seien dadurch, dass »ungefähr alles Seelische auf Sexualität in einem weiten Sinn« zurückgeführt werde«, »unerträglich langweilig«: »Man weiß immer schon vorher, daß in jeder Arbeit dasselbe steckt« (a. a. O., S. 453). Im Weiteren werden wir versuchen, Jaspers’ Kritik erkenntnistheoretisch aus der Perspektive psychoanalytischen Verstehens zu beantworten. Ein weiterer Aspekt ist in den kritischen Bemerkungen allerdings enthalten, den wir hier nur am Rande erwähnen können und der weniger leicht zu entkräften ist. Jaspers wendet sich deutlich gegen eine professions- oder institutionslogische Strategie des (vermeintlichen) Verstehens (vgl. ausführlich Bormuth 2018). In seinem Vorwurf an die Psychoanalyse ist nicht zuletzt enthalten, dass – berechtigterweise – der Eindruck entsteht, psychoanalytisches Verstehen bedeute, etwas einem Kanon von Lehrmeinungen einzugemeinden (Freuds eigene Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden gegen seine These der verdrängten Homosexualität am Grund der Paranoia ist ein Beispiel dafür), erst recht durch Freuds »Schüler«. Eine »korrekte« Deutung sollte sich hingegen nicht darüber begründen, dass es proklamiertem Wissen entspricht, sondern sich am Erleben eines Patienten orientiert. Bis heute erscheint an Jaspers Kritik daher der Hinweis wichtig, dass der Referenzrahmen des Verstehens nicht die Autorität Freuds oder seiner Theorie als solche sein darf, erst recht nicht im Hinblick auf Berufspolitik oder Institutionalität der Psychoanalyse. Ein zentraler Bereich, in dem die Psychoanalyse bis heute aus der Kritik Jaspers’ lernen kann, ist daher neben einer Institutionalismuskritik (nicht zuletzt im Kontext psychoanalytischer Aus- und Weiterbildung und darin besonders der Lehranalyse), die im Zentrum von Jaspers’ Psychoanalyse-Kritik nach dem zweiten Weltkrieg steht (Bormuth 2018)4, das Verhältnis von Verstehen und Deutung (vgl. Storck in Vorb.) (vgl. allgemeiner zu Jaspers’ methodologischer Psychoanalysekritik Warsitz 1990; zu Versuchen der »Verständigung über Unverständliches« Warsitz 2010; zur Frage des Verstehens und Nicht-Verstehens Kadi 2012).