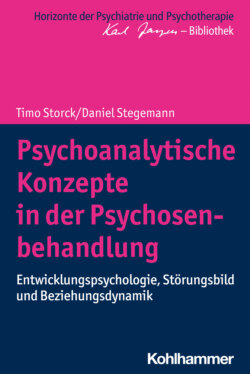Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.3 Genetische und neurobiologische Aspekte der Schizophrenie
ОглавлениеEin biopsychosozialer Blick auf psychotische Störungen ist unverzichtbar und damit auch der Einbezug neurobiologischer und -chemischer, populations- und molekulargenetischer Aspekte sowie prä- und perinataler Risikofaktoren (vgl. z. B. die S3-Leitlinie der DGPPN 2019 oder die evidenzbasierte Leitlinie der DGPs Lincoln et al. 2019, S. 30f.) Einen Überblick über biochemische bzw. neurophysiologische und -psychologische Befunde in der Schizophrenieforschung im historischen Verlauf gibt z. B. Rey (2011, S. 823ff.); vgl. aktuell auch Schlagenhauf und Sterzer (2020) für einen allgemeinen Überblick oder Heinz et al. (2018) zur Diskussion von predictive coding/processing unter kognitiver und neurowissenschaftlicher Perspektive, sowie Tebartz van Elst (2021) zu einer kritischen Revision des Konzepts Schizophrenie in neuropsychiatrischer Betrachtung.
Einigkeit dürfte hinsichtlich des neurobiologischen Befundes einer gestörten Erregungs-Hemmungs-Balance bestehen, der Befunde zur Rolle unterschiedlicher Neurotransmittersysteme (Dopamin, GABA, Glutamat) integriert (vgl. für den Einfluss von Glutamat z. B. von Haebler & Gallinat 2008) und eine Antwort auf das Auftreten von Positiv- und Negativsymptomatik der Schizophrenie ermöglicht (vgl. zur Diskussion einer gestörten Balance auf sowohl neuropsychologischer als auch psychoanalytischer Ebene z. B. Mentzos 2008). Ebenso wird die Theorie der aberranten Salienz herangezogen, um die subjektiv erlebte überwertige Bedeutungszuschreibung und die daraus gezogenen Schlüsse verständlich zu machen (Heinz & Schlagenhauf 2010), oder das Modell des predictive coding/processing, um Vorhersagefehler auf der Grundlage sensorischer Daten im Zusammenhang der Schizophrenie zu erklären (Sterzer et al. 2018). Es liegt eine Schwächung der konzeptualisierenden Komponente im Verhältnis zur sensualistischen vor.
Aus psychoanalytischer Richtung ist vor allem die Kennzeichnung der Psychose als »Psychosomatose des Gehirns« (Mentzos 2000) zu erwähnen. In neuerer Perspektive diskutieren Böker, Hartwich & Northoff (2016) systematisch eine »neuropsychodynamische« Perspektive in der Psychiatrie. Unter Rückgriff auf eine Reformulierung des Freud’schen Begriffs der Besetzung/Kathexis durch Northoff (2011) unterscheidet Hartwich (2016, S. 206ff.) verschiedene Formen der Besetzung. Dies wird explizit als ein neuropsychodynamisches Modell ausgewiesen, in dem das klassische Abwehrkonzept der Psychoanalyse (vgl. a. Hartwich & Grube 2015, S. 87ff.; Kap. 4.4.1) in Richtung von »Parakonstruktionen« reformuliert wird. Es soll zum Ausdruck kommen, dass das »kreative Wiederherstellungsprinzip« der Parakonstruktion »nicht nur auf psychodynamischer Ebene, sondern gleichzeitig auch auf somatischer (genetischer, neuronaler) Ebene aufzufassen ist«, wenngleich es nur zu »Partialkohärenzen« komme (Hartwich 2016, S. 210).