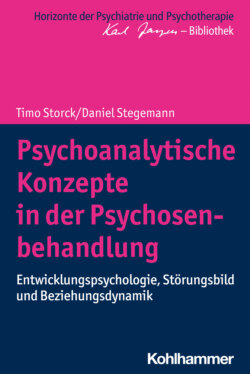Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.1 Zu Nosologie und Diagnostik
ОглавлениеKonzepte von Krankheit (Heinz 2014) oder Gesundheit (Heinz 2016) lassen sich umfangreich diskutieren. Eine Krankheit wird darüber definiert, dass sich pathologische/abweichende Veränderungen zeigen, die auf Krankheitsursachen zurückgeführt werden können und in Beeinträchtigungen in der Lebensführung und Teilhabe (beruflich, sozial, körperlich) führen. In der Regel ist dies verbunden mit einem subjektiv erlebten Leidensdruck. Für psychische Störungen entsteht die Besonderheit, dass in nosologischer Hinsicht bestimmte Phänomene als die Krankheit verstanden werden (vgl. Benecke 2019, S. 394), etwa das Zusammentreffen bestimmter vegetativer Phänomene mit dem Erleben von Panikgefühlen als Panikstörung. Während beispielsweise der grippale Infekt, der sich z. B. in Fieber zeigt, sich bestimmen und definieren lässt, ist die Panikstörung »nur« der Name für eine Gruppe von Symptomen und wirkt nicht ursächlich, so dass Krankheitserscheinungen entstünden.
Für Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit aus Sicht der Psychoanalyse (vgl. a. Heinz 2016, S. 63ff.) kann gesagt werden, dass weder das Fehlen von psychischen Konflikten noch das Fehlen unbewusster Erlebnisanteile als Kennzeichen von Gesundheit gelten kann. Vielmehr sind es die Möglichkeiten, interpersonelle und intrapsychische Konflikte auf adaptiv jeweils geeignete Weise zu bewältigen (statt in immergleiche, dysfunktionale Automatismen zu geraten), die psychische Gesundheit kennzeichnen. Während Freud die Möglichkeit, Einsicht in unbewusst konflikthafte Bedeutungen nehmen zu können, als wesentliches Ziel von Behandlungen formuliert hat, ist in heutiger Perspektive von Gesundheit als der Fähigkeit zu sprechen, sich das eigene Erleben innerer und äußerer (d. h. sozialer, interpersoneller) Zustände und Vorgänge mental vor Augen führen zu können (dafür also Erlebnisformen zu finden; Sprache, Bilder, Gefühle). Krankheit wäre dann eine Einschränkung dessen samt der Folgen für Verhalten und Lebensgestaltung, also eine Einschränkung im Erleben und/oder Handeln. Bezüglich des Leidensdrucks ist eine Perspektive sinnvoll, in der psychopathologische Symptome, so dysfunktional und mit schmerzlichen Folgen verbunden sie sein können, letztlich immer gegenüber etwas anderem (meist: einer intensiveren Angst) »das kleinere Übel« sind. Selbst die psychotische Angst, dass alles, was sich in der Welt wahrnehmen lässt, verfolgend-bedrohlich auf die eigene Person gerichtet ist, ist weniger ängstigend als das Erleben vollkommener Unverbundenheit, Inkohärenz und Bedeutungslosigkeit. In diesem Sinn sind psychische Störungen (und ihre Symptome) die Beantwortung eines »Leidensdruck«, sie sind durch diesen hervorgerufen und stellen eine Form der versuchten (»relativen«) Linderung dar – ohne dass damit in Abrede gestellt werden soll, dass psychopathologische Symptome jemanden »leiden« lassen. Die Störung besteht darin, für einen darunter liegenden Leidensdruck keine geeigneteren Formen der Bewältigung zu finden.
Für eine klassifikatorische Diagnostik ist auf die Hinweise der Behandlungsleitlinie einschließlich des SCID-5-CV-Interviews zu verweisen sowie auf die Bedeutung der desintegrierten Struktur in der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (Arbeitskreis OPD 2006). Psychoanalytisch spielt auch bezüglich der Psychose ergänzend dazu das szenische Verstehen und die Reflexion der Gegenübertragung (vgl. z. B. Matejek 1999) eine wichtige (aber nicht für sich stehende) Rolle in der Diagnostik sowie Indikationsstellung. Ein dreidimensionales Modell der Psychodynamik der Psychose in diagnostischer Hinsicht wird ferner von Mentzos (1999) vorgeschlagen. Auf einer ersten Dimension liegen Selbstpol und Objektpol. Auf einer zweiten Dimension verortet er eine Linie zwischen der dilemmatischen Konstellation der Schizophrenie (Selbstidentität) und der dilemmatischen Konstellation der affektiven Psychose (Selbstwert). Schließlich wird eine dritte Dimension zwischen den Polen Überstimulation und Unterstimulation aufgespannt. Jede psychotische Störung wird so psychodynamisch einordbar, zum Beispiel die von Überstimulation auf Seiten des Selbstpols gekennzeichnete schizophrene Störung eines Größenwahns (vgl. zur Rolle der psychodynamischen Perspektive in der psychiatrischen Diagnostik Küchenhoff 2006).
Fuchs (2015a) macht den Vorschlag, zwischen drei Aspekten psychiatrischer Diagnostik zu unterscheiden: einer positivistischen (3. Person), einer phänomenologischen (1. Person) sowie einer hermeneutisch-intersubjektiven (2. Person). Kürzlich haben ferner Sell et al. (2020) ein Studiendesign zur Entwicklung einer Typologie psychotischer Störungen auf psychoanalytischer Grundlage vorgelegt.