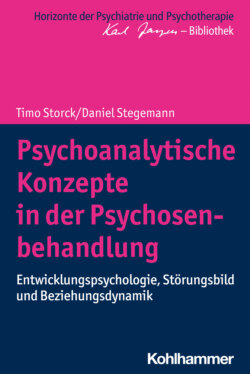Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Die psychoanalytische Entwicklungstheorie im Hinblick auf Körperlichkeit, Denken und Fühlen
ОглавлениеIm Weiteren stellen wir die psychoanalytische Entwicklungstheorie im Hinblick auf Körperlichkeit, Denken und Fühlen dar. Diese drei Bereiche werden die Grundlage dafür liefern, im Kapitel 3 die Konzeptualisierungen psychotischer Störungen einordnen zu können.
Am Beginn der psychischen Entwicklung steht auch aus Sicht der Psychoanalyse die sinnlich-körperliche Interaktion mit anderen, mit Merleau-Pontys (1964) Ausdruck: »zwischenleiblich«. Dabei ist es der Wechsel von Berührung und Nicht-Berührung, eingebettet in eine Erlebnisszene von Geruch, Stimme, Bewegung u. a., durch die und mit der Bezugsperson, der erste Erfahrung von »Kontakt an einer Grenze« mit sich bringt. Wenn Freud (1923b, S. 253) schreibt, das »Ich« sei »vor allem ein körperliches« bzw. die »Projektion einer Oberfläche«, dann verweist das darauf, dass sich die innere Repräsentation einer Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst zunächst bezüglich des Verhältnisses zwischen Körper und Umwelt zeigt.
Bei Freud findet sich der Ausdruck »Ich« in wechselnder Bedeutung, mal in der hemmenden Wirkung des Ichs auf primärprozesshafte Erregungsabläufe (z. B. Freud 1950a, S. 417), mal als das, worauf sich die Libido nach dem Abzug von den Objekten richtet (»narzisstische« bzw. Ich-Libido) (Freud 1917e) und mal als eine der Instanzen des Psychischen, die sich über ihre Funktionen (die Ich-Funktionen) bestimmt (Freud 1923b). Nach Vorschlägen H. Hartmanns (1956, S. 278) wird vom Ich als einer Organisation im Psychischen gesprochen, die durch bestimmte Funktionen gekennzeichnet ist, z. B. Realitätsprüfung, Kontrolle der Motorik u. a., während »Selbst« die psychische Repräsentanz der eigenen Person meint.
Freuds Rede vom Ich als einem körperlichen wäre daher im Grunde umzuformulieren zu: Das Selbst ist vor allem ein zwischenleibliches. Es bleibt aber der Gedanke bestehen, dass es die körperbezogene Erfahrung von Berührung als Kontakt an einer Grenze ist, welche die beginnende Repräsentation eines In-Beziehung-Stehens möglich macht, denn nur die basale Repräsentation einer Grenze kann es ja erst mit sich bringen, sich und jemand anderen als bezogen aufeinander, als in einer Beziehung stehend, zu erleben. Das ist keine momenthafte, punktuelle Erfahrung, sondern das Resultat eines Prozesses bzw. eines »Eingespieltseins« von Kind und Bezugspersonen in der frühen Entwicklung. So wird bei förderlichen Entwicklungsbedingungen eine Körperkontur internalisiert.
Das zeigt auch, wie in diesen frühen Entwicklungsstadien das Verhältnis zwischen Individuum und Umwelt auf der einen, und zwischen Psyche und Soma auf der anderen Seite miteinander verbunden sind (vgl. den Ansatz von Ferrari 2004 dazu). Beide wirken aufeinander: Ist etwa die Grenze zwischen Individuum und Umwelt unklar, wird das Verhältnis zwischen Psyche und Soma gestört sein, in einer Unterbrechung einer wechselseitigen Durchdrungenheit (vgl. Lombardi 2019).
Diese frühen Internalisierungsprozesse führen dazu, Vorstellungen vom Selbst-in-Beziehung zu verinnerlichen (statt abgegrenzter, isolierbarer Vorstellung von Selbst und Objekten). Kestenberg (1971) spricht von Organ-Objekt-Einheiten im Erleben, Aulagnier (1975) von Zone-Objekt-Komplementen, Winnicott (1960a, S. 587) bemerkt pointiert, so etwas wie den Säugling gebe es nicht (und meint damit: nicht losgelöst von der Beziehung zur Mutter im subjektiven Erleben), und Bion (1963, S. 53) konzipiert frühes Erleben als »Präkonzeptionen«, die auf eine »Realisierung« treffen, etwa die Empfindung, gestillt zu werden, die erst repräsentierbar macht, welches das Bedürfnis und die Vorstellung waren. In diesen Ansätzen wird das Erleben von Getrenntheit nicht vorausgesetzt, sondern als sukzessive Entwicklungserrungenschaft begriffen. Freud (1914c) beschreibt einen primären Narzissmus, der vor der Objektbesetzung liege (vgl. Heinz 2002), also so etwas wie die Besetzung des Selbst, bevor sich der Außenwelt zugewandt wird. Das ist erstens als Annahme an sich diskutabel, aber auch zweitens in sich logisch problematisch (vgl. Zepf 2006, S. 105ff.): Wie sollte vor einer möglichen Besetzung der Außenwelt, weil diese noch nicht als unterschieden auftauchen kann, das Selbst als abgrenzbar erlebt und dann besetzt werden können? Daher scheint es sinnvoller, primären Narzissmus oder primäres Identifiziertsein als etwas zu begreifen, in dem das Individuum gleichsam in einem »Selbst-Universum« erlebt. Alles ist eins und alles ist zum eigenen Erleben untrennbar zugehörig. Neben dem primären Narzissmus beschreibt Freud für die ganz frühe Entwicklung überdies den Autoerotismus, auch hier geht es um die lustvolle Besetzung des eigenen Körpers, vor der Besetzung der Objekte. Zwar gibt es Bemerkungen Freuds, dass der Autoerotismus am Anfang stehe und über das Stadium des primären Narzissmus hinweg zur Objektbesetzung gelangt werden könne (Freud 1911b, S. 296), aber auch solche, in denen die autoerotische Besetzung des eigenen Körpers es ist, das seinerseits als Übergangsstadium vom primären Narzissmus zur Objektbeziehung steht. Nimmt man die Gedanken eines frühen Erlebens im (primär-narzisstischen) »Selbst-Universum« hinzu, dann wäre die Besetzung des eigenen Körpers die beginnende Unterscheidung zwischen dem, der besetzt, und dem, das besetzt wird.
Psychoanalytische Ansätze betonen in der Regel die Erfahrung von Verlust oder Mangel in ihrer Bedeutung für die Entwicklung psychischer Repräsentanzen bzw. der Symbolisierung von Erfahrung. In der psychischen Entwicklung realisiert sich kein beständiges Ineinanderfallen von Bedürfnis und Befriedigung und auch keine permanente Anwesenheit einer Bezugsperson. Vielmehr wird es Momente erregungsvoller Spannung geben, ebenso wie passagere Abwesenheit, sowohl von Befriedigung als auch von der wahrgenommenen Bezugsperson3.
Das Kind macht die Erfahrung der vorübergehenden Abwesenheit der Mutter. Dass es eine alternative Beziehung gibt, die zum Vater, hat zwei wichtige Funktionen aus Sicht der psychoanalytischen Entwicklungstheorie: Zum einen kann eine Entfernung von der Mutter bedeuten, den Weg zum Vater zu finden (sich aus einer Beziehung lösen, kann heißen, zu einer anderen, hinzutretenden zu gelangen), zum anderen gibt der Vater der Abwesenheit der Mutter eine (psychische) Bedeutung. Es kann sich das Erleben entwickeln, dass die Mutter nicht schlicht »weg« ist, sondern beim Vater. Es können Bilder davon entstehen, was die primäre Bezugsperson tut und mit wem, wenn sie gerade nicht wahrgenommen wird; sie ist auf etwas oder jemanden bezogen. Das ist nun kein kleiner Entwicklungsschritt, denn er besteht darin, dass hier Abwesenheit in der Wahrnehmung durch Anwesenheit in der Vorstellung angereichert wird, in einer Art von Negation der Negation: »Mama ist nicht da« wird zu »Mama ist nicht nicht da«, psychisch ist sie »da«. Es wird vorstellbar, dass sie weiterhin existiert, erst dann kann sie vermisst, ersehnt oder ihr nachgelaufen werden. Es ist die Grundlage für Erinnerung, Erwartung, Fantasie u. a.
Darin bestehen die Grundzüge der Symbolisierung von Erfahrung und diese ist bereits früh »ödipal« bzw. triangulierend vermittelt; es bedarf dazu verlässlicher Beziehungsangebote und zwar von mehr als einer Beziehung sowie des Findens von Beziehungen in der Welt, also der Bezogenheit der anderen aufeinander (Green 1975).
Im weiteren Verlauf sind es Austauschprozesse zwischen dem, was als »innen« und dem, was als »außen« erlebt wird, welche die Vorstellungen vom Selbst und von den Objekten weiter gestalten. Freud spricht hier von einem »purifizierten Lust-Ich« (1915c, S. 228) (auch hier ist das Selbst als Ausdruck treffender) und meint damit, dass in der frühen Entwicklung alles Angenehme, Lustvolle, alle positiven Affekte als zum Selbst zugehörig erlebt werden und alles Frustrierende, Unlustvolle »ausgestoßen« wird. Klein (1935; 1946) hat herausgestellt, dass sich auf diese Weise Spaltungszustände und Spaltungsprozesse realisieren: Gut und schlecht werden getrennt gehalten. Damit stehen Prozesse von Introjektion und Projektion im Zusammenhang, es geht um die Frage, was »hineingenommen« und was »hinausgeworfen« wird. Beide Prozesse bedingen einander: Gegen die Internalisierung dessen, was jemandem in der Interaktion begegnet, kann man sich psychisch kaum »wehren«, erst recht nicht in der frühen Entwicklung, so dass es immer auch darum geht, innerlich etwas aufzurichten und dann in einen wechselseitigen Prozess einzutreten, was als dem Selbst zugehörig und was dem Objekt zugehörig erlebt wird. Dabei liegt auf der Hand, dass auch das Objekt, denn es ist die subjektive Repräsentanz des Gegenübers in Erfahrungen, zur psychischen Welt des Individuums gehört. »Projektion« ist ein innerpsychischer Vorgang, im Zuge dessen etwas nicht mehr als dem Selbst, sondern dem Objekt zugehörig erlebt wird, also etwa ein Gefühl, verfolgt zu werden (das möglicherweise Ausdruck von eigenen als übermäßig erlebten Nähewünschen oder Affekten sein kann).
Internalisiert werden nicht nur »Erlebnisbilder« von Beziehungen und anderen, mit dem Ergebnis internalisierter Repräsentanzen, sondern auch Prozesse, zum Beispiel die Affektregulierung. Hier wiederum kann statt vom Selbst vom Ich gesprochen werden, denn es geht um psychisches Vermögen, innere und äußere Wahrnehmungen zu regulieren, zu integrieren und sich zu vergegenwärtigen. Das lässt sich in seinen interpersonellen Wurzeln beschreiben, etwa über Bions (1959) Konzept der projektiven Identifizierung: Er geht davon aus, dass in der frühen Entwicklung diffuse, potenziell überwältigende Spannungs- bzw. Erregungszustände auftreten, die der Säugling bzw. das Kind sich im ganz eigentlichen Sinn »vom Leib halten« muss. In einer zugewandten frühen Beziehung können diese »projizierten« Zustände von der Bezugsperson wahrgenommen und aufgenommen sowie in der Folge reguliert werden. Bei Bion (1962) steht das im Kontext der sogenannten Alpha-Funktion, also des psychischen Vermögens, diffuses Material der körperlichen Erregung (»Beta-Elemente«) in Denkbares (»Alpha-Elemente«) umzuwandeln. Das Etwas-Loswerden-Wollen ist also immer auch Kommunikation eigener Zustände und die Suche nach Unterstützung bei der Bewältigung und Tolerierbarkeit. Gelingt dies nicht, wenn also die Bezugsperson sich nicht erreichen lässt oder keine Hilfe bei der Regulierung bietet, resultiert aus Sicht Bions (1959, S. 119) nicht Stillstand in der affektiven Kommunikation seitens des Säuglings oder Kindes, sondern ein immer »exzessiver« werdendes Bemühen darum, die Bezugsperson doch noch zu erreichen bzw. in diese einzudringen und sie zu kontrollieren (weil sie so sehr dafür gebraucht wird, das Überwältigende zu verdauen) (vgl. a. Frank & Weiß 2007) ( Kap. 3.1.3).
Bei Gelingen wird eine zunächst interpersonelle »Funktion«, nämlich die Regulierung von Spannungszuständen, sukzessive internalisiert (und zu einer »Ich-Funktion«). In anderer begrifflicher Sprache findet sich das Gemeinte in Kohuts (1971, S. 37ff.) Konzept des Selbstobjekts bzw. der Selbstobjekterfahrung ( Kap. 3.5.5). In bestimmten Phasen der psychischen Entwicklung wird das Gegenüber darüber erlebt, welche Funktion es für das Selbst hat. Beide Ansätze – Bions Gedanke der Alpha-Funktion und Kohuts Hinweis auf die Selbstobjekterfahrungen – weisen darauf hin, wie entscheidend die basale Unterscheidbarkeit zwischen Selbst und anderem ist, um auf psychische Funktionen zurückgreifen zu können.
Als letzten Bereich gehen wir auf einige Aspekte der Entwicklung des Affekterlebens ein (Überblick bei Zepf 2006). In Verbindung mit Säuglings- und Bindungsforschung sowie der auch nicht-psychoanalytischen Entwicklungspsychologie legen Arbeiten aus der Richtung der Mentalisierungstheorie (Fonagy et al., 2010; Taubner 2015; Kap. 3.5.8) den Akzent auf die markierte Affektspiegelung (Gergely & Watson 1996). Mit Mentalisieren ist gemeint, sich selbst und andere als getragen von inneren Zuständen (Affekte, Intentionen, Gedanken …) vorstellen bzw. sich selbst von außen und andere von innen betrachten zu können. Bei der markierten Affektspiegelung ist entscheidend, dass die Bezugsperson den Affekt des Kindes wahrnimmt, aufnimmt und »markiert« spiegelt. Das bedeutet, dass zum aufgenommenen Affekt, auch mimisch, etwas hinzugefügt wird, das kennzeichnet, dass die empathische Bezugsperson etwas mit dem Affekt des Kindes »anstellt«. So geschieht noch mehr als die interpersonelle Regulierung, denn es wird auch ein Modell dafür angeboten, wie man sich zu einem Affekt in Beziehung setzen kann. Andere zentrale Aspekte dieser Theorie betreffen die elterliche Feinfühligkeit, die neben der empathischen Beziehungsgestaltung auch einbezieht, sich das Baby und Kleinkind als Individuum mit inneren, psychischen Zuständen vorstellen zu können (»minding the baby«; Slade et al. 2005). Ebenfalls spielt das epistemische Vertrauen eine Rolle (Fonagy et al. 2019), das heißt die Erfahrung, dass der Weltsicht der Bezugspersonen grundlegend vertraut werden kann hinsichtlich deren Interpretation von Geschehnissen oder Beziehungen ( Kap. 3.5.8).