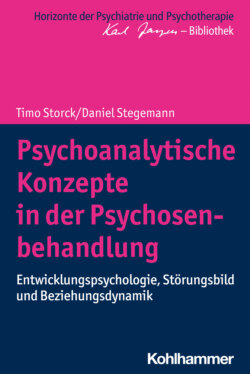Читать книгу Psychoanalytische Konzepte in der Psychosenbehandlung - Timo Storck - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.5 Fallbeispiel A.
ОглавлениеDer 17-jährige A. wird auf die geschlossene Station einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, nachdem er in der Innenstadt Passanten scheinbar grundlos angegriffen hat. Er ist voller Überzeugung, diese hätten schlecht über ihn gesprochen. Auch den hinzugerufenen Polizisten gegenüber sei er sehr provokant aufgetreten. Im Aufnahmegespräch zeigen sich bei ihm eine deutlich eingeschränkte Auffassung sowie stark eingeschränkte mnestische und Aufmerksamkeitsfunktionen. Sein formales Denken ist in Form von Verlangsamung, Umständlichkeit, Weitschweifigkeit, Neologismen und Inkohärenzen stark beeinträchtigt. A. ist im Affekt gereizt-disphor sowie wiederholt parathym. Seine Mimik ist verflacht, seine Körperhaltung wirkt bizarr und manieristisch, insgesamt ist er psychomotorisch verlangsamt. Er berichtet von Größenideen: »Ich bin der Auserwählte. Auf der Straße erkennen manche mich.« A. meint, von den Ärzten würden Informationen über ihn an die Polizei weitergegeben, und er deutet Gesten und Bewegungen der Behandelnden als »Zeichen« für ihn. Aussagen von Mitpatienten erlebt er bezogen auf sich bzw. seine Biografie.
Während der ersten Tage und Wochen entsteht der Eindruck von Ich-Störungen in Form von Gedankeneingebungen. A. meint, er könne andere Personen durch seine eigenen Gedanken beeinflussen und steuern, beispielsweise zu vereinbarten Treffpunkten bewegen. Ebenso kristallisiert sich deutlich ein ausgeprägtes, systematisiertes und nicht korrigierbares Wahnerleben heraus: A. meint, er sei ein respektiertes Mitglied eines Geheimbundes, dessen Handzeichen eines dauerhaft gebeugten Ringfingers als Zeichen von Loyalität und Zugehörigkeit gilt. Sein Geheimbund rivalisiert mit anderen Organisationen und hat Deutschland in verschiedene Territorien aufgeteilt.
Mit seinem muskulösen Körperbau, seiner hohen Anspannung, seinem paranoid wirkenden und starren Blick sowie einem häufig parathym erscheinenden Grinsen erscheint A. seinem Behandler unberechenbar und löst in der Gegenübertragung Angst aus sowie die Fantasie, von ihm spontan physisch angegriffen zu werden. Dies weitet sich aus zur Fantasie, A. könnte ihn nach Entlassung aufsuchen und bedrohen. Nach einiger Zeit der Behandlung findet sich bei A. eine aus einer Zahnbürste gebaute Stichwaffe.
Seine Eltern berichten von einer schleichenden Wesensveränderung seit Beginn der Pubertät. A. habe sich immer mehr im familiären Kontext zurückgezogen, sei im Affekt starr geworden und habe unter einer gedrückten Stimmung gelitten. Seine Konzentrationsfähigkeit lasse nach, er habe kürzlich zwei Mal den Herd in der Wohnung angelassen. Im Vergleich zur Kindheit sei er weniger empathisch. Sie würden ihren Sohn im Gespräch zunehmend skurril erleben. A. räume sein Zimmer nicht mehr auf, verweigere die Annahme von Essen, das seine Eltern zubereitet hätten, und nehme auch keine Gegenstände von ihnen an. Er falle zunehmend durch provozierende und sachaggressive Handlungen auf. So habe er kürzlich eine Tür eingetreten sowie einen Motorradspiegel zerschlagen. Seit dem 13. Lebensjahr konsumiere A. regelmäßig Cannabis.
A. ist das einzige Kind von Mutter (+39) und Vater (+41). Die kindliche Entwicklung erscheint in den Berichten der Eltern altersgerecht, sie beschreiben einen gesteigerten Bewegungsdrang und eine geringe Frustrationstoleranz im Kleinkindalter. A. habe sich immer gern in Gruppen aufgehalten, aber bis heute keine engen Freundschaften mit anderen Kindern aufgebaut; auch habe er außerhalb der Primärfamilie kein enges Verhältnis zu Familienangehörigen. Seine schulischen Noten seien gut gewesen, aber er leide an einer Dyskalkulie und sei phasenweise leicht ablenkbar gewesen. Ab dem 12./13. Lebensjahr hätten die Konflikte zwischen A. und seinen Eltern zugenommen, er sei zunehmend oppositionell aufgetreten und habe sich immer mehr verschlossen und entzogen. Gegen Ende der achten Klasse auf dem Gymnasium seien leichte Notenverschlechterungen beobachtbar gewesen, mit Abschluss der zehnten Klasse habe A. aber mit einer Durchschnittsnote von 1,6 seinen mittleren Schulabschluss erreicht. Ab der elften Klasse habe er zunehmend unentschuldigt gefehlt und sich schlechter konzentrieren können. Nach einem wiederholten Schuljahr sei er wegen unentschuldigter Fehlzeiten schließlich der Schule verwiesen worden.
In den Elterngesprächen zeigt sich für den Hauptbehandler die Auffälligkeit, dass die Eltern von A. oft auf rein somatische Aspekte der Behandlung zu sprechen kommen, es ihnen schwerfällt, eine emotionale Perspektive auf die Erkrankung einzunehmen und sie kaum wie ein glückliches Paar wirken. Die Mutter wirkt subsyndromal depressiv, der Vater tritt mit einer passiv-aggressiven Grundhaltung auf. In der emotionalen Reaktion in den Elterngesprächen wechseln sich für den Behandler Mitgefühl und Ärger ab, er fühlt sich von Seiten der Eltern wiederholt idealisiert. Auffällig erscheint auch, dass angemessene Autonomie- und Loslösungsschritte A. im späteren Verlauf der Behandlung von den Eltern tendenziell als drohende Verschlechterung der psychotischen Symptomatik wahrgenommen werden.
Nach einiger Zeit der insgesamt fast sechs Monate andauernden multimodalen Behandlung erscheint A. »berechenbarer« und absprachefähig und er wirkt in Mimik und Körperhaltung »menschlicher« auf seinen Behandler. Sein Misstrauen nimmt deutlich ab und er teilt sich seinem Behandler persönlicher mit. Im Zuge dessen wird es leichter, Wahninhalte gemeinsam zu hinterfragen, auch da A. zugewandter und schwingungsfähiger wird und sich bei ihm eine beginnende Krankheitseinsicht entwickelt. A. selbst thematisiert nun adäquater altersgerechte aktuelle und vergangene Konflikte zwischen ihm und den Eltern. Er kann realitätsgerechter über »Überwachung« oder »übertriebene Angst« um ihn seitens der Eltern sprechen. Im Gegenübertragungserleben wird die Angst durch Sympathie ersetzt, einschließlich einer Fantasie, sich mit A. gegenüber den Eltern solidarisieren zu wollen.
Anhand der kurzen Vignette können zwei Aspekte beginnend diskutiert werden: zum einen allgemein eine Perspektive auf psychotische Symptome als Ausdruck einer Störung des Denkens und des Ichs, zum anderen die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Verstehbarkeit.
In erster Linie zeigt sich im Blick auf die Erkrankung A.s die Störung des inhaltlichen und des formalen Denkens. Er entwirft ein überwertiges Wahn-»System«, in dem es um Bedrohung, Überwachung und Besonderheit geht. In dieses fügen sich alle Beobachtungen ein, etwa Gesten von Menschen, denen er begegnet. Sein Denken ist verlangsamt oder umschweifig, Aggression ist unintegriert, Affekte allgemein parathym. Hinsichtlich der Ich-Störung zeigt sich, wie wenig »Inneres« umgrenzt ist: A. kann durch seine Gedanken andere Menschen steuern.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit spielt in zweierlei Weise eine Rolle. Zum einen ist das Wahnsystem hochkohärent, alles ist darin eingefügt. Für A. ist verständlich, warum andere Menschen bestimmte Gesten machen und auch alles andere, was er denkt, fühlt und wahrnimmt. Sinnverstehen ist hier auf die Spitze getrieben, es wird alles verstehbar und ist gegenüber den Wahnideen und Ängsten sinnvoll. Zum anderen wirft das die Frage danach auf, in welcher Weise A.s Wahnerleben seinerseits verstehbar ist. (Psychoanalytisches) Verstehen sollte hinsichtlich seiner logischen Struktur nicht in überwertiger Weise in die Nähe eines Wahnsystems rücken, in dem sich einer bestimmten Verstehenshypothese alles unterordnet. Der Weg psychoanalytischen Verstehens sollte daher den Weg vom Beziehungserleben aus nehmen – hier das eigene Bedrohtheitserleben des Behandlers. Das ist, was einfühlbar ist bzw. sogar etwas, gegen dessen Einfühlen man sich kaum wehren kann. Verstehbar sind dann: Angst, das Gefühl von Bedrohtheit oder der Eindruck einer (relational) unberechenbaren Welt. Hinzu kommt u. U. die Vorstellung, überwacht zu werden oder keinen Schritt tun zu können, ohne sanktioniert oder gar liquidiert zu werden. Das ist es, worin sich der Behandler einfühlen kann. Erst hierüber kann ein Begreifen erfolgen, nämlich dass der Wahn A.s sekundär eine Systematisierung einer primär unberechenbaren Welt schafft, in der die Elemente von Überwachung, Enge und verhinderter Autonomie auf Elemente der Primärbeziehungen verweisen könnten (ebenso wie der Kontext einer Behandlung auf einer »geschlossenen« Station es tut).