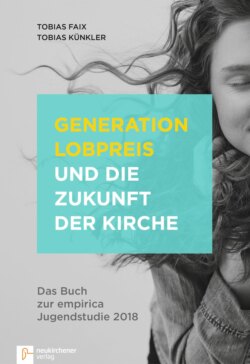Читать книгу Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche - Tobias Faix - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIn unserer Studie wollten wir nicht nur wissen, was und wie hochreligiöse Jugendliche glauben, sondern auch wie sie ihren Alltag gestalten und wie beides miteinander zusammenhängt. Welche Rolle spielt der Glaube in ihrem Alltag? Inwiefern ist das Verhalten der Jugendlichen in alltäglichen Situationen von ihrem Glauben angeleitet? Im Normalfall gibt es hier eine andere entscheidende Einflussgröße, die man „Lebenswelt“ oder teils auch „Milieu“ nennt. Hier erhebt man neben Daten zum sozialen Hintergrund (Aus welcher Schicht stammen die Jugendlichen?) und ihrer Bildung bzw. Bildungsorientierung auch zahlreiche Daten zu Werten, Grundhaltungen, Mentalitäten sowie ihrem Freizeitverhalten als auch zu Einstellungen und Überzeugungen zu zahlreichen Aspekten. Auf diese Weise kann man mittels statistischer Analysen „Gruppen Gleichgesinnter [...], die jeweils ähnliche Werthaltungen, Prinzipien der Lebensgestaltung [und] Beziehungen zu Mitmenschen und Mentalitäten aufweisen“13 entdecken.
Aus welchem Milieu stammt die Generation Lobpreis ?
Wir wissen, dass sich Jugendliche tendenziell mit Jugendlichen zusammentun, die ähnlich ticken beziehungsweise einen ähnlichen Habitus aufweisen (wie man soziologisch formulieren würde). Die Lebenswelt, die man mit dem Großteil seiner Gleichaltrigen teilt, gestaltet somit als stärkste Einflussgröße den Alltag. Sie ist nicht einfach nur durch einen ähnlichen Geschmack und einen ähnlichen Stil bestimmt, sondern hängt auch stark damit zusammen, woher die Jugendlichen kommen (Kommen sie eher aus einer unteren oder einer oberen Schicht? Sind sie in einem eher bildungsfernen oder -nahen Haushalt aufgewachsen?) und wohin sie sich aktuell im sozialen Raum orientieren. Die Fragen, die wir uns von Beginn an stellten, lauten: Wie verhalten sich Lebenswelt und Glaube bei hochreligiösen Jugendlichen zueinander? Prägt das Milieu den religiösen Lebensstil der Jugendlichen oder ist dieser unabhängig von der Herkunft? Bilden hochreligiöse Jugendliche gar ein eigenständiges Milieu, das sich hinsichtlich der Lebens- und Glaubenspraxis signifikant von den Ergebnissen anderer Jugendstudien unterscheidet? Die Beantwortung dieser Fragen setzt voraus, die Milieuzugehörigkeiten hochreligiöser Jugendlicher zu verstehen und mit ihrem Glauben in Zusammenhang zu bringen.
In den aktuellen Sinusjugendstudien (siehe Grafik) werden sieben solcher jugendlicher Lebenswelten unterschieden. Die einzige, in der für einige Jugendliche Glaube und Religion eine tendenziell positive Rolle spielen, ist die der bürgerlich-konservativen Jugendlichen. In einem Satz werden sie portraitiert als „die familien- und heimatorientierten Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und Verantwortungsethik“. Diese haben eine mittlere bis hohe Bildung und ihre normative Grundorientierung ist ein Mix aus traditionellen und modernen Werten. Zusammen mit dem prekären Milieu, das (vielmehr) durch eine niedrige Bildung gekennzeichnet ist, stellen sie die jugendliche Lebenswelt mit den tendenziell traditionellsten Werten dar. Die Kirche stellt im Leben dieser Jugendlichen einen festen Anlaufpunkt dar, der ihnen soziale Kontakte und Sicherheit bietet.
Die Sinusjugendstudien machen keine genauen Aussagen über evangelische hochreligiöse Jugendliche, jedoch erhält man den Eindruck, dass diese fast ausschließlich aus dem bürgerlich-konservativen Milieu kommen. Eine Ausgangshypothese unserer Studie war, dass diese Diagnose zu vereinfacht ist und wir aus eigenen Beobachtungen schätzen würden, dass die Lebenswelt- und Milieuorientierung
der evangelischen hochreligiösen Jugendlichen vielfältiger ist – dass es also auch evangelisch hochreligiöse Expeditive und evangelisch hochreligiöse experimentalistische Hedonisten gibt. Um hierzu eine Aussage zu machen, sammelten wir auch Daten über den sozialen Hintergrund, die Bildung sowie über Wertorientierungen und Mentalitäten bzw. sogenannte Alltagsästhetiken.
Da die Sinusstudien von einem Marktforschungsinstitut durchgeführt werden und sie daher ihr genaues methodisches Vorgehen nicht offenlegen, konnten wir die Lebensweltzugehörigkeit nicht eins zu eins messen. Wir konnten jedoch mittels einer Reihe von anderen etablierten Vorgehensweisen Indikatoren erfassen, die uns hier ein begründetes und fundiertes Urteil erlauben.14
Beginnen wir zunächst mit den Fragen, die uns etwas über die soziale Herkunft der Jugendlichen verraten. In welchem Elternhaus sind sie groß geworden und wo im sozialen Raum ist dieses zu verorten? Ist das Elternhaus tendenziell eher als bildungsnah oder bildungsfern zu charakterisieren? Es ist in Jugendstudien nicht einfach, auf diesem Gebiet gesicherte Erkenntnisse zu erlangen. Nicht nur müsste man den Jugendlichen hierzu sehr viele Fragen stellen (was zur Folge hätte, dass man für andere wichtige Fragen keinen Platz bzw. keine Zeit mehr hätte), vielmehr wissen Jugendliche oft über diese Fragen nicht oder nur vage Bescheid (was zum Beispiel die Höhe des Haushaltseinkommens angeht). In vielen Studien hat sich jedoch die Antwort auf eine einfache Frage als sehr guter Indikator für die Bildungsorientierung des Elternhauses insgesamt erwiesen: „Wie viele Bücher haben deine Eltern?“
Es zeigt sich, dass fast die Hälfte der hochreligiösen Jugendlichen angibt, dass ihre Eltern sehr viele Bücher zu Hause haben. Knapp 77 Prozent geben an, dass ihre Eltern viele oder sehr viele Bücher haben.
Gut die Hälfte (52 Prozent) geben zudem an, dass ihr Vater einen höheren Schulabschluss hat (also Fachabitur, Abitur oder Erweiterte Oberschule [DDR] 12. Klasse).
40 Prozent geben das auch für ihre Mütter an. In 47 Prozent der Fälle haben die Mütter jedoch einen mittleren Schulabschluss. Die Eltern der evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen haben im Durchschnitt somit deutlich höhere Schulabschlüsse als die Eltern der gleichaltrigen Vergleichsgruppe aus der Shell Jugendstudie, wie die unten stehende Grafik zeigt.
Auch bezüglich der eigenen Schulabschlüsse bei den befragten Jugendlichen, die nicht mehr in der Schule sind, zeigt sich das gleiche Muster. Sie besitzen ebenfalls eine viel höhere Bildungsnähe als in einer für das Alter in Deutschland repräsentativen Vergleichsgruppe. Hier wird es sogar noch deutlicher, da die Jugendlichen mit Hochschulreife unter den evangelischen hochreligiösen Jugendlichen mehr als doppelt
so häufig wie im bundesdeutschen Durchschnitt vertreten sind (45 Prozent zu
21 Prozent).
Fasst man hier verschiedene Variablen zusammen und deutet diese vor dem Hintergrund des fachlichen Wissens, ergibt sich bezüglich der Schichtzugehörigkeit des Elternhauses der Jugendlichen folgendes Bild:
Die größte Gruppe der evangelischen hochreligiösen Jugendlichen stammt aus der Oberschicht (41 Prozent) bzw. zu einem sehr großen Teil (89 Prozent) mindestens aus der mittleren Mittelschicht. Das Ergebnis liegt nicht weit entfernt von den religiösen Jugendlichen, trotzdem hat es uns in dieser Eindeutigkeit ziemlich überrascht.
Werte-Orientierungen
Ein weiterer wichtiger Baustein der Lebenswelten von evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen ist ihre Werteorientierung. Um diese zu messen und etwas darüber auszusagen, wie sie sich zur Werteorientierung heutiger Jugendlicher allgemein verhalten, haben wir uns an den Ergebnissen und Messmethoden der Wertestudien von Klages und Gensicke orientiert, die bereits seit Ende der 1970er-Jahre im Einsatz sind und auch in den Shell Jugendstudien Anwendung finden. Klages und Gensicke zufolge sind Werteorientierungen „individuelle Präferenzen, nach denen Menschen in einem übergreifenden Lebenskontext ihre Wahrnehmungen und ihr Handeln ausrichten. Wertevorstellungen sind sozial vorgeformt, weil Menschen gesellschaftlich geprägte Wesen sind, und sie haben soziale Konsequenzen.“ 15 Hier wird zunächst die Wichtigkeit von Einzelwerten erhoben. In einem zweiten Schritt werden diese mittels statistischer Analysen zu ähnlichen Werten zusammengefasst, und in einem dritten Schritt werden unterschiedliche Wertetypen unterschieden.
In der Tabelle ist zu sehen, welche Werte bei den jeweiligen Wertetypen unter- oder überdurchschnittlich ausgeprägt sind. Nach der Shell Jugendstudie 2015 ist die größte Gruppe in Deutschland (12–25 Jahre) die der aufstrebenden Macher, der 32 Prozent aller Jugendlichen angehören. Unter den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen ist der Wertetypus der aufstrebenden Macher nicht nur am stärksten vertreten, sondern mit 40 Prozent deutlich überrepräsentiert. Dies ist der Typus, dem die Wertesynthese gelingt, das heißt alle drei – teils eher gegensätzlichen – Wertedimensionen sind bei ihm überdurchschnittlich ausgeprägt:
die Wertedimension „Tugend und Sicherheit“, die aus „Gesetz und Ordnung respektieren“, „Fleißig und ehrgeizig sein“ und „Nach Sicherheit streben“ besteht;
die Wertedimension „Idealistische Werte“, die aus „Phantasie und Kreativität entwickeln“, „Sozial Benachteiligten helfen“, „Andere Meinungen tolerieren“ und „Sich politisch engagieren“ besteht;
die Wertedimension „Hedonistische und materielle Werte“, die aus „Das Leben voll genießen“, „Hohen Lebensstandard haben“, „Sich gegen andere durchsetzen“ und „Macht und Einfluss haben“ besteht.
In der Shell Jugendstudie werden sie treffend beschrieben: „Erhöhte materielle Ansprüche verbinden sich bei ihnen mit einem ausgeprägten Bedürfnis, kreativ zu sein, und mit der Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement. Dieses Profil ist zugleich mit einer hohen Akzeptanz der gesellschaftlichen Spielregeln verbunden und mit einer starken Betonung der Tüchtigkeit. Auch das Bedürfnis nach Sicherheit ist hoch.“16 Aufstrebende Macher werden sie deshalb genannt, da sie weder zu den sozial etablierten noch den eher prekären Jugendlichen gehören, sondern eher den „Typus des sozialen Aufsteigers“17 repräsentieren. Trotz großer Bildungsnähe ist also davon auszugehen, dass viele der evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen nicht aus Elternhäusern stammen, die bereits seit Langem in der Oberschicht oder oberen Mittelschicht etabliert sind, sondern aus Elternhäusern, die in diese Schichten aufgestiegen sind.
Nach den „Aufstrebenden Machern“ ist unter den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen mit 29 Prozent der Wertetypus der „Unauffällig Zögerlichen“ am zweithäufigsten vertreten. Auch dieser Wertetypus ist im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt bei den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen überdurchschnittlich stark vertreten. Mit 24 Prozent ist er dort von vieren der drittgrößte Wertetypus. Interessanterweise stellen die „Unauffällig Zögerlichen“ das genaue Gegenteil der „Aufstrebenden Macher“ dar: Alle Wertedimensionen sind bei ihnen unterdurchschnittlich stark ausgeprägt. Drittgrößter von vier Wertetypen ist mit
22 Prozent der Typus der „Pragmatischen Idealisten“. Im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt (25 Prozent) ist dieser leicht unterrepräsentiert. „Pragmatische Idealisten“ vertreten stark überdurchschnittlich idealistische Werte („Phantasie und Kreativität entwickeln“, „Sozial Benachteiligten helfen“, „Andere Meinungen tolerieren“, „Sich politisch engagieren“) und stark unterdurchschnittlich hedonistische und materielle Werte. Die Wertedimension „Tugend und Sicherheit“ ist bei ihnen leicht überdurchschnittlich ausgeprägt.
Deutlich am geringsten unter den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen ausgeprägt sind mit neun Prozent die „Robusten Materialisten“, bei denen die hedonistischen und materiellen Werte („Das Leben voll genießen“, „Hohen Lebensstandard haben“, „Sich gegen andere durchsetzen“, „Macht und Einfluss haben“) stark überdurchschnittlich ausgeprägt sind, die anderen Werte hingegen unterdurchschnittlich – idealistische Werte meist stark unterdurchschnittlich. Mit 19 Prozent stellen sie zwar auch im bundesweiten Durchschnitt der Shell Studie die kleinste Gruppe unter den vier Wertetypen dar, bei den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen sind die „Robusten Materialisten“ mit neun Prozent im Vergleich aber stark unterdurchschnittlich vertreten.
Mit Blick auf die Sinus-Jugendmilieus zeigt die mit 40 Prozent größte Gruppe unter den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen, die „Etablierten Macher“, eine große Nähe zu den „Adaptiv-Pragmatischen“ auf, die ebenfalls für eine starke Wertesynthese stehen. Sie stellen die neue Mitte unter den Jugendlichen dar und vertreten damit den Mainstream der heutigen Jugendgeneration, der im folgenden Exkurs genauer beschrieben wird.
Der neue Mainstream der heutigen Jugendgeneration
Bei der heutigen Jugendgeneration ist eine starke Gegenwartsorientierung festzustellen. Zum einen gibt es einen Bedeutungsverlust der Vergangenheit, da man sich aufgrund des beschleunigten sozialen Wandels immer weniger an der Vergangenheit und den dort gemachten Erfahrungen orientieren kann. Zum anderen gibt es aber in einer postmodernen Gesellschaft auch einen eklatanten Mangel an gesellschaftlich positiven Visionen für die Zukunft. In diesem Sinne bleibt nichts anderes als die Gegenwart und ein gewisser Pragmatismus sowie ein mindestens moderater Hedonismus, welche sich als Kernwerte durch diese Generation ziehen.
Das Mehr an Möglichkeiten führt zugleich zu einer gewissen Orientierungslosigkeit und dies wiederum zu einem „Regrounding“. Das heißt, Jugendliche suchen in einer sich rapide wandelnden Welt nach Halt, nach Entlastung und nach Zugehörigkeit.18 Halt findet man jedoch vor allem in primären, also familiären Beziehungen, Beziehungen zu Freundinnen und Freunden sowie zu Partnerinnen und Partnern. In Zeiten, in denen alles in Bewegung ist und nichts sicher erscheint, sind diese primären Beziehungen im Vergleich zu früher von besonders großer und existenzieller Bedeutung. Sie sind das Einzige, was einigermaßen Halt und Beständigkeit verspricht. Für nicht wenige Jugendliche sind diese primären Beziehungen auch die Hauptquelle für Sinn und Bedeutung.19
Ein weiterer, direkt aus den heutigen Lebensbedingungen ableitbarer Aspekt, ist erlebter Druck. So berichtet eine große Mehrheit der Jugendlichen, dass sie mächtig unter Druck stehen. Sie erleben und berichten von Leistungs-, Bildungs-, Zeit- und Flexibilitätsdruck. Sie wissen, dass sie ihr Leben selbst managen müssen. Eine gewisse Angst vor gesellschaftlichem Abstieg oder davor, an den Rand der Gesellschaft katapultiert zu werden, ist Normalität. Zugespitzt gesagt, müssen die Jugendlichen immer mehr Entscheidungen bei gleichzeitig mehr Optionen treffen. Dabei können sie angesichts einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft immer weniger voraussagen, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben werden, müssen aber immer stärker Verantwortung dafür übernehmen. Denn Misserfolg oder Scheitern ist nach der Logik der individualisierten Leistungsgesellschaft unmittelbar bedingt durch schlechte Entscheidungen und/oder individuelle Fehler. Schuld ist immer der Einzelne. War früher Arbeitslosigkeit in gewissem Sinne kollektives Schicksal einer ganzen Klasse, so ist es heute Einzelschicksal und wird auf das Fehlverhalten der arbeitslosen Individuen zurückgeführt. Eine große Bank warb vor einigen Jahren mit dem Slogan: „Erfolg ist die Summe deiner Entscheidungen.“ Karl-Heinz Rummenigge formulierte ähnlich: „Erfolg ist die Summe aller Anstrengungen.“ Diese Logik bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass Misserfolg das Ergebnis von falschen Entscheidungen und zu geringer Anstrengung ist. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum eine individualisierte und beschleunigte Multioptionsgesellschaft beim Einzelnen Druck produziert.20
Wie oben schon angedeutet, ist die heutige Jugendgeneration eher pragmatisch und entideologisiert. Man konsumiert möglicherweise bewusst (kauft Bio- oder Fairtrade-Produkte), jedoch übt man keine globale Konsumkritik oder möchte gar das System ändern. Entscheidend für (politischen) Aktivismus ist die Logik der Machbarkeit, das heißt das Verfolgen unmittelbar umsetzbarer Ziele. In der neuen Shell Jugendstudie zeigt sich ein leicht angestiegenes politisches Interesse, zugleich gehen die politischen Aktivitäten aber eher zurück. Zwar ist die Mehrheit mit der Demokratie in Deutschland zufrieden, zugleich sind die Jugendlichen äußert politikverdrossen und bringen Politik und Parteien kaum Vertrauen entgegen.21
Dieser Pragmatismus und diese Entideologisierung zeigen sich jedoch nicht nur in politischen Präferenzen, sondern ganz grundlegend bilden sich in der heutigen Jugendgeneration neue Wertesynthesen, die nicht mehr der Logik des „Entweder-oder“, sondern dem Anspruch auf ein „Sowohl-als-auch“ verpflichtet sind. Sowohl für Vertreter*innen alter, traditionell-konservativer als auch für Vertreter*innen neuer liberal-progressiver Werte erscheinen diese neuen Wertekonfigurationen oft widersprüchlich und inkohärent.22
So ist diese Jugendgeneration auf der einen Seite hyperindividualistisch, was sich unter anderem in der weiter sinkenden Bedeutung traditioneller Gemeinschaftsformen zeigt. Auf der anderen Seite gibt es eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft und den oben schon aufgezeigten hohen Stellenwert primärer sozialer Beziehungen. Ein neuer Grundwert ist zudem die „flexicurity“, also die ideale Mischung aus Flexibilität (flexibility) und Sicherheit (security), die in fast allen Lebensbereichen gesucht wird. Exemplarisch sei dies nur an einem Ergebnis der neuen Shell Studie gezeigt. Jugendliche wollen geregelte Arbeitszeiten, die aber kurzfristig an eigene Bedürfnisse angepasst werden können, sowie die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit – zumindest dann, wenn sie eigene Kinder bekommen.23
Auf der einen Seite ist die heutige Jugendgeneration recht selbstbewusst. In der Arbeitswelt verlangen sie früh Mitsprache, da sie von klein auf Partizipation gewohnt sind. Zudem sind sie kritisch gegenüber traditionellen Autoritäten eingestellt und einen eher wertschätzenden Umgang sowie Kommunikation auf Augenhöhe gewöhnt. Daher verlangen sie auch oft flache Hierarchien, und es wird ihnen nachgesagt, dass sie nicht nur gewohnt sind, Feedback zu bekommen, sondern auch (ungefragt) Feedback zu geben. Parallel zum gesteigerten Selbstbewusstsein ist diese Jugendgeneration aber hochgradig angepasst. Sie ist pragmatisch gewohnt, das Kleine im Hier und Jetzt zu verbessern (z. B. über Feedback), gleichzeitig liegt es ihr fern, das Große und Ganze („das System“, „die Gesellschaft“) zu verändern. Dies zeigt sich auch darin, dass nicht wenige der Jugendlichen ehrenamtlich und/oder sozial engagiert sind. Zugleich ist dieses Engagement für sie ein selbstverständlicher Teil ihrer Selbstoptimierung, das heißt, sie wissen, dass es sich auch im Lebenslauf auszahlt. Sie sind leistungsorientiert und suchen gleichzeitig neue Formen von Entschleunigung.
Alltagsgestaltung und ästhetische Orientierungen
Neben der Bildungsnähe oder -ferne und den Werteorientierungen ist für die Zugehörigkeit zu Milieus und Lebenswelten ein weiterer Aspekt zentral: die sogenannten alltagsästhetischen Schemata. Soziale Zugehörigkeit drückt sich heute nicht mehr alleine durch berufliche Zugehörigkeit und den entsprechenden Status aus, sondern immer mehr über Alltag und Freizeit. In der Art und Weise, wie Menschen ihre Freizeit gestalten und an welchen Maßstäben sie sich dabei orientieren, drücken sie zugleich aus, wo sie sich soziokulturell verorten. Die am intensivsten erforschte und gängigste Unterscheidung dreier alltagsästhetischer Schemata ist die des Soziologen Gerhard Schulze. Diese drei Schemata sind keine einander ausschließenden Stilmuster, sondern, ähnlich wie die Wertedimensionen, miteinander kombinierbar. Sie spannen einen mehrdimensionalen Raum auf, in dem eine Person verortet werden kann.24 Entscheidend für die Schemata ist es, welche Lebensphilosophie jemand vertritt, wodurch und wie ein Mensch sich Erlebnisse schafft und diese genießt und schließlich, von wem oder wovon er sich abgrenzt, also welches „ästhetische Feindbild“ jemand hat. Unterschieden werden können:
Das Hochkulturschema: Hier gibt es eine Präferenz für „anspruchsvolle“ und als „kulturell wertvoll“ definierte Angebote. Es dockt an die ästhetischen Vorlieben der bürgerlichen Orientierung und klassischen Hochkultur an (in Abgrenzung zu bloßer Unterhaltungskultur, wie sie beispielsweise in der Abgrenzung von E- zu U-Musik gängig ist). Das Hochkulturschema ist aufgrund seiner langen Tradition sozial am klarsten ausgearbeitet, verliert Schulze zufolge aber zunehmend seine Funktion bei der Etablierung sozialer Hierarchien. Durch seine Popularität hat es viel von seiner Exklusivität eingebüßt und steht immer weniger für die Zugehörigkeit zu „besser gestellten“ Kreisen. Die Nähe oder Distanz zu diesem Schema hat kaum noch etwas mit den verfügbaren ökonomischen Ressourcen zu tun, ist aber nach wie vor bildungsabhängig. Zentral für jeglichen Genuss sind die Zurücknahme des Körpers bzw. eine gewisse Vergeistigung (psychische Erlebnisqualitäten stehen im Vordergrund). Jedoch grenzt sich hier nicht nur das Geistige gegenüber dem Körperlichen ab, sondern auch das Kultivierte gegenüber dem Barbarischen und das Gebildete gegenüber dem Ungebildeten. Angestrebt werden stets eine gewisse Perfektion sowie eine Vereinigung von Gegensätzen.25
Das Trivialschema: Hier gibt es eine Präferenz für ästhetische Angebote, die auf eine „heile Welt“ zielen und umgangssprachlich dem Kitsch nahestehen. Entscheidend ist, dass die Angebote leicht zugänglich sind, anstrengungslosen Genuss versprechen und ihre Nutzung keine besonderen kulturellen Kompetenzen erfordern. Der Körper und die Befriedung körperlicher Genüsse stehen hier stärker im Vordergrund, zugleich sind Gemütlichkeit, geselliges Miteinander, Einfachheit, Wiederholung und Vertrautes hoch im Kurs. Abgegrenzt wird sich gegen alles, was zu fremd und exzentrisch scheint. Angestrebt wird hingegen eine Kultur der schönen Illusion von harmonischer Gemeinschaft, Angenommen-Sein und „Happy Ends“.26
Das Spannungsschema: Hier gibt es eine Präferenz für ästhetische Angebote, die durch Intensität und Abwechslungsreichtum gekennzeichnet sind. Das Spannungsschema ist historisch das jüngste der drei Schemata. Auch hier spielt der Körper eine zentrale Rolle, jedoch geht es vor allem um Ausdruck mithilfe des Körpers, intensive Reize, Spannung und Abwechslung. Abgegrenzt wird sich von allem, was langweilig, spießig, veraltet und angepasst erscheint. Alles ist hier auf das Individuum ausgerichtet, auf dessen Selbstentfaltung und Stimulation.27
Alle drei alltagsästhetischen Schemata sind bei den evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen tendenziell mittel ausgeprägt. Am stärksten ausgeprägt (mit 3,5 von 7 jedoch genau mittel ausgeprägt) war das Schema von Spannung und Aktion, das sich aus der Zustimmung zu den Aussagen „Ich probiere gerne Neues aus“, „In meiner Freizeit tue ich gerne Dinge, die aufregend sind“, „Ich gehe gerne feiern und tanzen“ und „Mein Leben gefällt mir dann besonders gut, wenn ständig etwas los ist“ ergibt. Mit 3,4 von 7 fast genauso stark (bzw. mittelstark) ausgeprägt ist das Schema der Trivialität. Das heißt, die Zustimmung zu folgenden Aussagen war ungefähr gleich groß: „In meiner Freizeit mag ich es harmonisch und gemütlich“, „Ich fühle mich sehr mit meiner Heimat verbunden“, „Mir sind bodenständige und bewährte Dinge lieber als etwas Ausgefallenes“, „Ich kann nichts mit Kunst anfangen, mit der man sich lange beschäftigen muss, bevor man sie versteht“.
Mit 3,2 von 7 im Vergleich am geringsten ausgeprägt ist das Schema von Hochkultur und Reflexion, die durch Zustimmung zu folgenden Aussagen gekennzeichnet ist: „Ich beschäftige mich gerne mit Dingen, die mich gedanklich herausfordern“, „Ich lese gerne schwierige und anspruchsvolle Bücher“, „Kunst und Kultur sind wichtige Themen für mich“, „Ich informiere mich darüber, was in Politik und Gesellschaft vorgeht“.
In der fast gleichstarken Ausprägung aller drei Schemata lässt sich wieder ein gewisser Hang zur Synthese vom scheinbar Widersprüchlichen ausmachen. Deutlich wird das auch, wenn man sich die Tabelle entlang der Zustimmung zu den Einzelaussagen anschaut. Am stärksten ist die Zustimmung zu drei Aussagen, die jeweils für eins der drei Schemata stehen: „In meiner Freizeit mag ich es harmonisch und gemütlich“ (3,9 – Trivial), „Ich probiere gerne Neues aus“ (3,9 – Spannung und Aktion), „Ich beschäftige mich gerne mit Dingen, die mich gedanklich herausfordern“ (3,8 – Hochkultur und Reflexion).
Auch hier zeigt sich eine gewisse Nähe zu den adaptiv-pragmatischen Jugendlichen. Die verhältnismäßig geringe Ausprägung von Hochkultur und Reflexion und die verhältnismäßig starke Ausprägung des Trivialschemas ist angesichts der großen Bildungsnähe erstaunlich und weist darauf hin, dass der Großteil der evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen auch eine Nähe zu den bürgerlich-konservativen Jugendlichen aufweist.
Zwischenfazit
Wichtig ist, dass bezüglich aller drei Aspekte – soziale Herkunft/Bildungsnähe, Werteorientierung und Alltagsästhetik – das Antwortverhalten der befragten evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen unglaublich homogen war. Sie zeichneten sich also durch eine sehr große Ähnlichkeit aus. Die größten Unterschiede gab es bei den Werteorientierungen, nur leichte Unterschiede kamen bei den Alltagsästhetiken vor, wenige bei der Bildungsnähe des Elternhauses. Unsere Ausgangshypothese, dass die Lebenswelt- und Milieuorientierung evangelischer, hochreligiöser Jugendlicher vielfältig und heterogen ist, wurde somit deutlich widerlegt. Nach Logik der Sinus-Milieus lässt sich die Mehrheit der evangelischen, hochreligiösen Jugendlichen irgendwo zwischen den bürgerlich-konservativen und den adaptiv-pragmatischen Jugendlichen verorten. Wie verhalten sich Lebenswelt und Glaube bei den hochreligiösen Jugendlichen also zueinander? Es ist davon auszugehen und bezüglich der weiteren Ergebnisse zu überprüfen, dass das Milieu der Jugendlichen ihren religiösen Lebensstil prägt und dieser nicht unabhängig von der Herkunft ist. Zumindest in Bezug zu den hier besprochenen Aspekten bilden evangelisch hochreligiöse Jugendliche kein eigenständiges Milieu, das sich hinsichtlich der Lebens- und Glaubenspraxis signifikant von den Ergebnissen anderer Jugendstudien unterscheidet. Doch trifft dies auch auf andere Aspekte wie den Glauben zu? Das steht auf einem anderen Blatt und wird im Weiteren ausführlich behandelt.