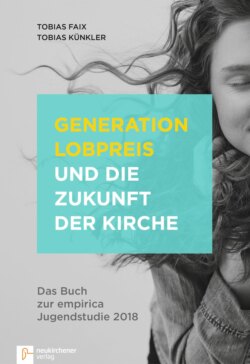Читать книгу Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche - Tobias Faix - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTyp 5: Die Ganzheitlichen
Portrait Lea*
* Das Foto zeigt nicht die interviewte Person; Foto © Markus Mainka | Fotolia.com
Lea ist 22 Jahre alt und kommt aus Minden. Sie fühlt sich ihrer evangelischen Kirchengemeinde zugehörig, hat ein Studium der Religionspädagogik absolviert und ist gerade Mutter geworden. Glaube bedeutet für sie „Leben, Vertrauen, Gemeinschaft leben oder auch die Liebe leben, weil Gott ist für mich die Liebe. Aber auch die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit der Natur und dem Menschen oder mit Gott durch die Menschen und sein Umfeld.“
Ihre Familie spielt für ihren Glauben eine „sehr große“ Rolle, da sie in „einer sehr ökumenischen Familie aufgewachsen ist, die aber den Glauben sehr lebendig gelebt hat“ (Vater evangelisch, Mutter römisch-katholisch). „Ich bin von klein auf jedes Jahr, seit meiner Geburt, nach Taizé gefahren. Das hat mich auch geprägt.“ Groß geworden ist sie vor allem mit einem sehr „eigenbestimmten Glauben“. Ihre Eltern haben ihr den Glauben „eigentlich eher vorgelebt und mich dann eher mal gefragt, wie ich das selbst sehe“. In Bezug auf den Glauben haben sie ihr „nie was vorgeschrieben“, jedoch erlebt es sie so, dass „Gott für uns immer da war und seine schützende Hand auch über uns gehalten hat“.
Geprägt haben Lea Erlebnisse in ihrem Glauben, „wo ich das Gefühl hatte, die hat mir Gott geschickt“. Ihre Vorbilder im Glauben sind unter anderem der Benediktinermönch David Steindl-Rast, Augustinus und „meine Eltern, auch Freunde“. „Mit solchen Vorbildern“ kann sie auch am besten über ihren Glauben sprechen sowie mit ihrem Freund. Ihr Glaube schenkt ihr „irgendwie meine Lebensfreude“, „er schenkt mir einen Sinn im Leben und auch die Möglichkeit, die Welt bestimmt wahrzunehmen, den Menschen mit einem bestimmten Menschenbild gegenüberzutreten. Weil er mir die Gewissheit gibt, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Dadurch kann ich auch in den anderen Menschen Gott begegnen und gegenübertreten. Das zum einen, zum anderen ist Gott für mich auch überall und um mich herum, auch in der Natur […] Gott ist in dem Gänseblümchen am Straßenrand. Gott ist in dem Lächeln von dem Menschen, der mir gerade entgegenkommt. Gott ist in der Liebe, wo sich zwei Menschen begegnen. Ja, wo zwei oder drei Menschen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube, dass Gott überall ist im Alltag, in allem, was Gott geschaffen hat. Aber die Frage ist: Kann ich ihn überhaupt richtig wahrnehmen? Und das muss ich mir auch immer wieder neu verinnerlichen, weil, es lohnt sich, Gott wahrzunehmen, weil es so eine Freude, ja ein Glück schenkt, so eine innere Liebe und einen inneren Frieden und dadurch auch ein Vertrauen. Ja, das fühlt sich manchmal so an, also wäre man verliebt.“
Lea mag gerne Taizé-Gesänge und Lobpreismusik, auch das persönliche Gebet ist ihr sehr wichtig. Dafür nimmt sie sich alle paar Tage eine Zeit, in der sie Gott dann dankt und ihm sagt, wie wichtig er für ihr Leben ist. Außerdem bittet Lea ihn, dass er auch bei den Menschen in ihrem Umfeld sein möge. Besonders wichtig in ihrem Glauben ist eine „Ikone des Friedens“, bei der „Christus und sein Freund Mena“ abgebildet sind. Für sie drückt sie aus, dass das, was „wir mit dem, was wir schon vom Evangelium verstehen oder auch praktisch leben, für andere ein Segen werden können, und das finde ich immer wieder einen schönen Gedanken, und jedes Mal, wenn ich die Ikone sehe und auch an ihr vorbeigehe oder einen ganz kurzen Blick drauf werfe, werde ich wieder gesegnet und das hat mich zum Beispiel irgendwie begleitet“.
Gemeinde ist für ihren Glauben „ganz wichtig“, „weil davon ‚ernähre‘ ich mich auch, ich bin auch einfach ein Typ, der viel in der Gemeinschaft lebt“. Gottesdienste sind für sie „immer wieder eine schöne Erinnerung daran, Gott im Leben wahrnehmen zu können und das dann auch wieder weitergeben zu können, das heißt, sich gesegnet zu fühlen, und dass man für andere auch ein Segen sein kann. Gottesdienste können einen mal ansprechen und halt Erinnerung sein, aber manchmal können sie auch sehr enttäuschend sein, wenn sie einen mal nicht ansprechen.“ Lea ist jedoch überzeugt, dass überall, wo man Gottes Wirklichkeit wahrnimmt und mit Gott kommuniziert und mit ihm in Verbindung ist, auch „das ganze Leben ein Gottesdienst“ ist. Auch Gemeinschaft mit anderen Christen hat für sie „eine ganz große Bedeutung“, weil „durch die Gemeinschaft, durch dieses Leben in der Gemeinschaft, lebt für mich auch Gott und wird auch Gott lebendig“. Dreimal die Woche arbeitet sie mit Teenagern und hat so die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Außerdem macht ihr diese Arbeit an sich sehr viel Spaß, sie mag es, Menschen zu helfen. Wichtiger als bestimmte Angebote, die in der Jugendarbeit unbedingt vorkommen sollten, empfindet sie es, „den Jugendlichen mit einer ganz bestimmten Haltung gegenüberzutreten: dass ich von denen lernen möchte und dass ich der bin, der von ihnen lernen kann, also wertschätzend und einladend. Und die Angebote sollten den Rahmen dazu bilden.“ „[…] was die Jugendlichen gerade so wirklich interessiert, das muss ich die Jugendlichen vor Ort fragen.“
Mit Blick auf die Zukunft denkt sie, dass „so, wie mein Leben sich wandelt“, „genauso wird mein Glaube auch mit mir gehen und sich in dem Sinne weiterentwickeln“. „Wenn wir stehen bleiben und irgendwas einfriert, dann stagnieren wir und dann haben wir wie einen Eisbrocken, der kann ganz leicht, wenn man mit dem Hammer draufhaut, zersplittern. Wenn das Wasser aber flüssig ist und es ein weiterer Fluss ist, dann kann man dann mit einem Hammer gerne drauf rumhauen, das Wasser bleibt beständig und geht dadurch nicht kaputt und so muss der Glaube auch wandelbar sein und wie ein lebendiges Wasser fließen.“
Lea kennt viele Menschen, die unterschiedliche Glaubens- und Frömmigkeitsstile haben und hat daher schon viele unterschiedliche „Glaubenssprachen gehört“, „also dass manche andere Wörter im Reden über den Glauben verwenden“. Sie kennt sowohl „ganz viele Atheisten“ als auch „befreundete Muslime und Hinduisten“ durch eine Auslandserfahrung. Mit diesen erlebt sie in der Gemeinschaft Momente „wo ich sagen würde, ja, das ist für mich auch Gott, diese Freude und Lebensfreude“. Dieser „interreligiöse und interkulturelle Dialog“ ist für „ihren eigenen Glauben ganz essenziell“, „also im Englischen kommt das viel besser raus, dort sagt man ‚to share communion with others‘. Eucharistie und Kommunion bedeutet ja auch im Deutschen, nicht nur vom Englischen her, Gottes Gemeinschaft teilen miteinander und ich glaube zwar für mich auch unabhängig vom christlichen Glauben.“
Auch wenn Lea weiß, dass Mission anders verstanden werden kann, so assoziiert sie damit doch vor allem bestimmte Erfahrungen im freikirchlichen Bereich. Dort hatte sie einige gute Freunde, mit denen es „wenn es mal nicht um Glauben ging, total schön“ war. Wenn es jedoch um Glaubensfragen ging, und Diskussionen darum wurden oft initiiert, dann machte sie die Erfahrung, dass „der Glaube abgesprochen wurde, weil Christ sein bedeutet ja: das und das glaubt ein Christ, und wenn diese Aussage nicht so geglaubt wird, dann ist man kein Christ“. Sie hatte somit das Gefühl, dass diese „Freunde“ sie zu deren Glauben „sozusagen zu überreden“ versuchten, was „sehr wehgetan hat, eben weil es auch meine Freunde waren“. „Das hat mich echt unter Druck gesetzt, und das fand ich nicht fair und verletzend, ja, so habe ich Mission erfahren.“
Allgemeine Beschreibung der „Ganzheitlichen“ (Typ 5)
In einigen Aspekten ähneln die „Ganzheitlichen“ den „Höchstleistern“. Neben überdurchschnittlichem Engagement zeichnen sie sich durch eine überdurchschnittlich hohe Gemeindebindung und einen unterstützend erlebten Glauben aus.
Zwar bestehen sie vornehmlich aus Hochreligiösen (knapp 90 Prozent) – in Bezug auf diese bilden sie insgesamt die zweitgrößte Gruppe –, jedoch ist ihr Glaube nicht exklusiv. In der Art und Weise ihres Glaubens unterscheiden sie sich somit deutlich von den „Höchstleistern“ beziehungsweise den gesamten Typen 1–4. Während bei diesen der Einfluss des christlichen Glaubens in der Erziehung überdurchschnittlich ausgeprägt war, ist er bei den „Ganzheitlichen“ nur durchschnittlich stark ausgeprägt: mit 3,4 von 5 (5 = sehr hoch) aber immer noch stark.
Ihre unterschiedliche Art und Weise des Glaubens zeigt sich auch in einer offeneren Sexualethik und einem progressiveren Bibelverständnis – beides haben sie mit den Typen 6–8 gemeinsam. Bei diesen sagt mit etwa zwei Drittel eine deutliche Mehrheit, dass nichts Eindeutiges über Sex vor der Ehe in der Bibel steht. Insgesamt interpretiert zudem nur eine Minderheit (zwischen 21 und 37 Prozent), dass Homosexualität in der Bibel eine Sünde ist. Es kommt zudem zu höheren Antworthäufigkeiten in der Kategorie „Zu Homosexualität steht nichts in der Bibel“. Entsprechend zeigen die Typen 5–8 alle eine deutlich höhere Akzeptanz homosexueller Lebensweisen als die Typen 1–4. Über zwei Drittel der Typen 5–8 geben an, dass homosexuelle Personen „ohne jede Einschränkung in der Gemeinde bleiben und mitarbeiten“ dürfen. Auch alle anderen Einschränkungen werden deutlich seltener genannt.
Die „Ganzheitlichen“ sind mit 60 Prozent der 14- bis 19-Jährigen nach den „Erlebnisorientierten“ der jüngste und nach den „Sozialpolitischen“ der weiblichste Typus. Sie fühlen sich überdurchschnittlich oft einer evangelischen Kirche (zu 73 Prozent; nach den „Erlebnisorientierten“ der zweithöchste Wert) und/oder einem CVJM (zu
50 Prozent) zugehörig.
Ihr Glaube wird überdurchschnittlich durch Lobpreismusik/Worship (71 Prozent von ihnen geben dies an; dies ist der höchste Wert aller Typen), „christliche Freizeiten“ (63 Prozent), das „persönliche Gebet“ (61 Prozent) und die „Mitarbeit in der Gemeinde oder Diakonie“ (44 Prozent) gestärkt.
Die Häufigkeit des Bibellesens, des persönlichen Gebets und des Gottesdienstbesuchs ist aber nur durchschnittlich ausgeprägt. Dies bedeutet trotzdem, dass eine deutliche Mehrheit von ihnen mindestens einmal pro Woche in der Bibel liest, fast zwei Drittel mindestens einmal pro Tag beten und ca. die Hälfte von ihnen mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst besucht. Trotzdem gibt es hier deutliche Unterschiede zu den sehr hohen Werten der Typen 1–4. Sie besuchen dabei Gottesdienste, die meist als „modern“, „offen-spontan“, „für Jüngere“, „lebensnah“ und „zum Mitmachen gehalten“ charakterisiert werden, worin sie sowohl den „Höchstleistern“ als auch den „Erlebnisorientierten“ ähneln.
Ganzheitlich sind sie darüber hinaus in ihren Wünschen für einen Gottesdienst. Sie erwarten dort sehr häufig sowohl eine Fokussierung auf Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist als auch Hilfe für Alltägliches und die Lebensführung sowie Teilnahme, Modernität und Gemeinschaft. Auch hier lassen sich Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten zu den „Höchstleistern“ erkennen. Letzteres tun sie auch in ihrem Gottesbild, da die Aussagen: „Gott hat einen Plan für mich“, „Gott greift in mein Leben ein“, „Gott lässt mir meinen freien Willen“ und „Gott hat Jesus gesandt, um mich zu erlösen“ allesamt häufiger als im Durchschnitt genannt werden. Der einzige Unterschied zu den „Höchstleistern“ ist, dass sie der Aussage „Vor Gott bleiben meine Sünden nicht verborgen“ unterdurchschnittlich oft zustimmten.
In ihren Gebetsthemen wird das Gegenteil des eher egozentrischen Musters von „Ambivalenten“ und „Unauffälligen“ sichtbar. Sie bitten überdurchschnittlich oft
für andere Menschen und bringen Gott Dankbarkeit und Verehrung entgegen, während sie unterdurchschnittlich häufig für sich selbst bitten sowie darum, nicht den Glauben zu verlieren.
In Bezug auf ihre Alltagsästhetik sind sie mit den „Erlebnisorientierten“ der einzige Typus, bei dem die Dimension „Spannung und Action“ überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Als einziger Typus ist bei den „Ganzheitlichen“ zudem das Interesse an „Hochkultur und Reflexion“ überdurchschnittlich ausgeprägt. Bezüglich ihrer Werteorientierung ist der ohnehin am stärksten in der Stichprobe vorkommende Typus der „Aufstrebende Macher“ stark ausgeprägt, bei dem alle Wertedimensionen starke Zustimmung erhalten und zu einer Wertesynthese verschmolzen werden.
„(Aufstrebende) Macher“ sind sie auch bezüglich ihres überdurchschnittlich hohen Engagements in überdurchschnittlich vielen Partizipationsarten. In beiden Aspekten haben sie nach den „Höchstleistern“‘ die höchsten Werte. 42 Prozent von ihnen engagieren sich mehr als einmal die Woche ehrenamtlich im christlichen Kontext. Besonders in der Arbeit mit Teenagern (hier haben sie den höchsten Wert), aber auch in der Friedens- und Umweltarbeit sind sie überdurchschnittlich engagiert, unterdurchschnittlich hingegen nur im Bereich Mission und Evangelisation. Mit Ausnahmen von „Anerkennung und Bestätigung bekommen“, sind alle Arten der Motivation bei ihnen überdurchschnittlich ausgeprägt. Neben ansonsten durchschnittlichen Werten in der Auskunftsfähigkeit, können sie anderen ihren Glauben überdurchschnittlich gut verständlich erklären. Auch in den Aufgaben der Kirche tritt nur ein Wert überdurchschnittlich hervor: das Gespräch mit Vertretern anderer Religionen zu suchen.
Zwei Drittel von ihnen können sich vorstellen später in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit mitzuarbeiten. Dies ist gemeinsam mit den „Erweckten“ der höchste Wert. Bezüglich einer möglichen späteren Tätigkeit als Pfarrer*innen sind sie die noch unentschiedenste Gruppe (die meisten Angaben bei „vielleicht“).