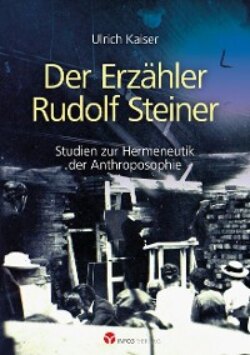Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 11
Der Stachel des Wissenschaftsanspruchs
Оглавление»Die Suche nach Gewissheit ist eine der gefährlichsten Irrtumsquellen, weil sie mit der Behauptung einer höheren Art von Erkenntnis verbunden ist.«4
» … wenn man glaubt, solch ein Arkanum, das nur andere kennen, existierte, dann sind Forschung und Erfindung wie gelähmt: man wagt nicht mehr, allein einen Schritt zu tun.«5
Widersprüchlich ist, dass Anthroposophie Wissenschaft sein möchte, aber sich in ihren Aussagen auf die Darstellung nur einer Person zu verlassen scheint. Und dass diese Darstellung nicht selten den Rahmen dessen überschreitet, was wir als Wissenschaft gewohnt sind anzusehen. Rudolf Steiner, diese Person, greift Themen der Esoterik in einer Weise auf, die oft den uns geläufigen Vorstellungshorizont überschreitet. Er spricht zwar öffentlich, spricht immer wieder in akademischen Kreisen, spricht aber in der Hauptsache vor seinem eigenen Publikum, Mitgliedern der Theosophischen, später Anthroposophischen Gesellschaft, ihm zugewandten Menschen. Der Großteil seines Werkes ist ein Mündliches. Nur 45 der mehr als 350 Bände seiner »Gesamtausgabe« sind Schrift, das Übrige sind Nachschriften von Vorträgen ohne Zahl, situativ und frei gehalten, im Fluss, mit Sorgfalt zwar, aber letztlich unvollkommen festgehalten. Die praktischen Felder, in die er intervenierte, sind vielfältig, erstaunlich. Kein Spezialistentum. Wie sieht da Vertiefung aus? Sein Publikum erzeugt das Bild einer weltanschaulichen Gruppierung, »den Anthroposophen«, welche sich mit den Inhalten der »Geistesforschung« tendenziell doch eher im Sinn religiöser Überzeugung oder persönlicher Vertrautheit als distanzierter, parteiloser Erkenntnis auseinandersetzen. Oder gibt es da Unterschiede?
Anthroposophie, so wurde gesagt, sei letztlich »Bildungsreligion.«6 Religion mag auf Bildung gründen oder in ihr münden, bleibt aber Religion, ist nicht Wissenschaft. Deren Besonderheit, so wäre zu vermuten, bestünde im fleißigen Studium einschlägiger Bücher und Vortragsnachschriften des Meisters, die den gebildeten Blick auf das Übrige bestimmten und den internen Kanon wenn nicht zweifelsfrei, so nur zweifelnd am richtigen Verständnis der kanonischen Texte prägten. Die Welt als ein großer Zusammenhang, dessen erlebte Einheit sich aus diesen und nur diesen Anregungen speiste. Eine Bildungsreligion, auf der quasi-religiösen Überzeugung aufruhend, dass dies alles, was Steiner sagte, auf jeden Fall richtig sei, auch da, wo es sich nicht unmittelbar nachvollziehen ließe. Eine dogmatische Haltung schließlich, die nicht selten die Form der Besserwisserei oder des elitären Gebarens annähme. Ein Wissens- und Wissenschaftsanspruch, der seinerseits nicht ernstzunehmen sei, wenn er tatsächlich sich auf dies Bild beschränkte und es nicht differenzierter und reichhaltiger gezeichnet werden müsste.
Im Verlauf ihrer Geschichte wurden Wissenschaften immer wieder durch individuelle Personen geschaffen, geprägt und entwickelt. Oft entstanden in der Folge oder der Gegenwart charismatischer Lehrer wie Platon oder Pythagoras Schulen. Denkgewohnheiten oder -stile prägten den Forschungsansatz von Generationen, bis neue Voraussetzungen an die Stelle von älteren traten. Heute ist es weniger die Einzelperson als die Forschergruppe, die am Wissen arbeitet. Labore und Diskursgemeinschaften sind für den Erkenntnisfortschritt verantwortlich. Zwar bewirken gerade die Naturwissenschaften einen enormen Einfluss auf unsere Lebensverhältnisse, aber sie sind hochgradig spezialisiert, allgemein kaum nachvollziehbar und in der Bevölkerung, die sie angeht, findet sich bestenfalls noch rationale Skepsis und erwägendes Prüfen, mehr aber Misstrauen und unwillige Abkehr oder übermütiger Sarkasmus.
Ein Jahrhundert zuvor, in der Wirkenszeit Steiners, war auch der Wissenschaftsbetrieb patriarchalisch und autoritär geprägt und Personen des öffentlichen Lebens – ob in der Wissenschaft oder Politik – wurden gerade da, wo das demokratische Bürgertum erstarkte, nach dem Muster des Genies wahrgenommen und bewertet, freilich im Sinne einer Vielfalt der Genies, nicht im Sinne einer »Singularität von Führerschaft, « die im Rückblick die Deutung des Führerbegriffs einseitig bestimmt.7 Qualität und Gewinn von Wissenschaft wurden nicht gleichgesetzt mit elitärer Sterilität und die bürgerliche Kultur förderte deren Popularisierung immens.8 Insbesondere Naturkunde zeigte sich entwicklungsoptimistisch und weltanschauungsaffin.9 Die Grenzen zwischen strenger Wissenschaft und Weltanschauung, die auch der Lebensorientierung diente, waren durchlässig oder wurden nicht gesehen, später aber, im Angesicht ihrer Folgen, kritisch beurteilt10 und früh schon war man bemüht, im Bereich der Wissenschaft Unterscheidungen zu treffen wie die zwischen »streng« und »exakt«.11 Der Maßstab der Strenge wäre mehr und schlösse anderes ein als bloß die Exaktheit, zum Wohle der von ihr bearbeiteten Natur. Noch Jahre zuvor, in der Zeit Steiners, und im Sinn ihrer Bildung, ist selbst Naturwissenschaft nicht von dem, was wir heute grob Kulturwissenschaft nennen, zu trennen. Steiners Begriff von Naturwissenschaft ist großenteils der Begriff Goethes. Erst Max Weber weist in seinem Vortrag »Wissenschaft als Beruf« (1918)12 nachdrücklich auf die geforderte Weltanschauungsabstinenz des wissenschaftlichen Habitus hin, der eine Distanz auch zur Kunst mit einschließt. Doch gerade an Goethes Naturforschung wäre zu differenzieren. Desavouiert ein Pionier der Quantenphysik und Nobelpreisträger wie Max von Laue (1879–1960) Steiners Akasha-Erzählungen mit guten Gründen als fantastisch, 13 so bleibt sein Hinweis darauf, dass dessen wissenschaftliches Vorbild Goethe ohnehin überholt sei, pauschal und fordert erst recht heute genauere Unterscheidung, die das Urteil zumindest mit wissenschaftlicher Absicht in die Revision fordert: was physikalische Optik und biologische Evolutionslehre bei Goethe angeht, bleibt erneut zu prüfen.14
Es sind die Umstände von Steiners Sozialisation als Autor, als Redner, als Disputant, als Lehrer, als Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften vor 1900, die so aussehen. Vom Goetheforscher und vielseitig gebildeten Kulturredakteur, vom Autor philosophischer Schriften wurde Steiner nach 1900 überraschend Lehrer und Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und begann eine Karriere, die bis heute ihre Wirksamkeit zeigt. Zweierlei hat sich aber geändert: Erstens: Die Wissenschaften selber sind diskursiver, rationaler aber auch lebensferner geworden. Geändert hat sich der Stil des Umgangs mit Wissen, das sich von der Alltagserfahrung entfernt, aber doch auf sie wirkt. Zweitens ist Steiners Werk nicht mehr die Sache seiner persönlichen Wirksamkeit, sondern ergibt sich aus den Spuren in Schriftform, künstlerischen Gestaltungen und immensen praktischen Anregungen, die er hinterlassen hat und ist damit bei sich auflösenden Traditionen dezentrisch geworden. Und so muss die Substanz seines Werks unter neuen Voraussetzungen neu geschöpft werden.
In der Diskursgemeinschaft der Anthroposophen – all jener, die sich mit dem Werk Steiners mit Engagement beschäftigen – kann es nicht lediglich um die Deutung von Steiners Werk und der Welt aus dessen Perspektive gehen. Sie muss sich öffnen. Bei allem Anspruch auf neutrale Nachvollziehbarkeit ist das Wissen der Anthroposophie immer interessiert an Entwicklung und Veränderung. Insofern kann dieses Wissen kein registrierendes, kein summatives, kein zu referierendes Wissen bleiben. Immer geht es zugleich um Bildung, Selbst-Bildung, Verwandlung, Überschreitung, ja, Neuschöpfung. Anthroposophie verändert und sie muss sich ändern, um ihren Impulsen treu zu bleiben. Ihr Wissenschaftsanspruch setzt zu Verwandlung an, fordert diese und setzt sie paradox voraus. Eine prekäre Situation. Worin also besteht dieser Eigensinn, der Wissenschaft zu sein beansprucht, aber mit Wissenschaft oft nicht konform ist? Zumindest in dreifacher Hinsicht überschreiten Steiners Aussagen das uns geläufige Areal der Wissenschaftlichkeit.