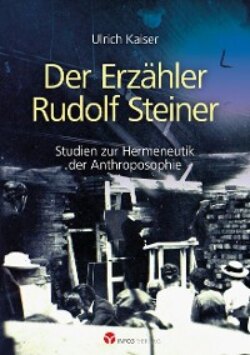Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 22
Begriffssprache gegenüber »blindem Dogmenglauben«
ОглавлениеVom Januar bis zum Mai 1904 veröffentlicht Steiner in seiner theosophischen Zeitschrift »Luzifer-Gnosis« Schriften aus dem Nachlass des Philosophen Paul Asmus (1843–1876), die er von dessen Schwester Martha Asmus (1844–1909) erhalten hatte.50 Steiner war mit Martha Asmus gut befreundet. Beide nahmen Leitungsfunktionen im Giordano Bruno-Bund wahr und sie gehörte zu den wenigen, die Steiner auch nach jenem denkwürdigen kontroversen Vortrag, in dem er die scholastische Philosophie als Monismus darstellte – den Atheismus seines Umfeldes also mit der Philosophie der katholischen Kirche in Verbindung brachte – in Schutz nahmen.51 Die Texte des idealistischen Philosophen Paul Asmus nun erschienen genau in dem Zeitraum in Steiners Haus-Zeitschrift, in dem er seine ersten theosophischen Vorträge zu esoterischen Themen wie »Atlantis« und »Akasha-Chronik« gehalten hatte und kurz bevor er darüber in der Zeitschrift in großen Teilen in narrativem Stil zu publizieren begann.
Steiner legte seinem theosophischen Publikum die Schriften dieses Philosophen sehr ans Herz, weil das von ihm praktizierte Denken nicht nur Grundlage spiritueller Erkenntnis sei, sondern vor allem auch zwei typische theosophische Gefahren vermeiden helfe:
»Solches Denken allein kann innere, selbstsichere Festigkeit und Forschergewissheit geben, die den Theosophen zwischen der Skylla einer nebelhaften Schwärmerei und der Charybdis eines blinden Dogmenglaubens hindurchleiten in die hellen Lichthallen der Weisheit« (GA 34, 492).
Mit dem hehren Pathos auf die bestimmt von allen Theosophen angestrebten »Lichthallen der Weisheit« verbindet sich der pragmatisch-aufklärerische Duktus Steiners, der an die eigenständige und selbstständige Erkenntnis appelliert, vor Gefahren der »nebelhaften Schwärmerei« und des »blinden Dogmenglaubens« warnt und eine bodenständige Arbeitshaltung empfiehlt:
»Heute fordert das Denken Bequemlichkeit, und zum Verstehen von Paul Asmus’ Ideen ist volle arbeitende Hingabe erforderlich. Doch der Theosoph weiß, dass nicht die Forschung sich nach dem Menschen, sondern der Mensch sich nach der Forschung zu richten habe, und dass nur volle Hingabe an ihre Forderungen zur Erkenntnis führen kann« (ebd., 489, Hervorhebungen im Original).
Steiner führt das abstrakte, kritische, begriffliche Denken sogar drastisch als eine notwendige Bedingung für Theosophie an:
»Wer dazu nicht gelangen kann, bleibt entweder in den Fesseln einer trüben Mystik hängen, […]; oder aber er muss sich mit einem bloßen Glauben an die theosophischen Dogmen begnügen.« (ebd., 492, Hervorhebungen im Original)
Die »Forderung nach Erkenntnis« wird angesichts der ganz anders wirkenden Inhalte, die neben diesen philosophischen Texten noch in der Zeitschrift stehen, vor eine Probe gestellt. Wie verhält sie sich gegenüber »Mitteilungen« über »Unsere atlantischen Vorfahren«, die weitgehend narrativ gehalten sind und die um 1900 naturwissenschaftlich noch recht unscharf bekannte Vorgeschichte in einer ganz eigenen Bilderwelt und Terminologie vorstellen? Angesichts der publizistischen Vorgehensweise Steiners entsteht der Eindruck, begriffliche und narrative Darstellungsweisen sollen sich gegenseitig ergänzen oder »durchwachsen«. Steiner baut offenbar auf ein Wechselverhältnis.