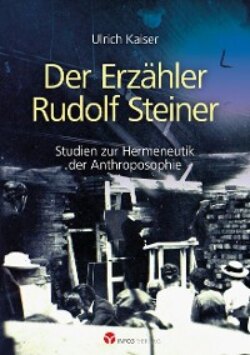Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 30
Lob der Hypothese
Оглавление»Gewiss, jeder kann das nachprüfen … Da werden gewiss mancherlei Irrtümer drinnen sein, selbstverständlich, aber das ist genauso wie bei anderen Forschungen.«85
Im Umgang mit dem Werk Rudolf Steiners sind es oft unausdrückliche Konzepte, die unsere Rezeption leiten. Ein solches Konzept ist das des »Hellsehens«. Damit ist etwa gemeint, dass Steiner mehr und anderes sieht oder weiß als wir selber und dass wir uns deshalb auf Steiners »Mitteilungen« oder »Angaben« als eine besondere Wissensquelle beziehen können. Dieses Wissen ist unantastbar, weil wir selber als Rezipienten nicht mitvollzogen haben, wie es zustandekommt und über die entsprechenden Wahrnehmungen nicht aus eigener Hand verfügen.
Das unmittelbare Vorbild von Steiners Wissensgenerierung scheint die spiritistische Seance zu sein, also eine quasi experimentelle Situation, in der alles, was an Übersinnlichem mitgeteilt wird, in genauer Analogie erscheint zur sinnlichen Welt oder mehr noch: als sinnliche, materielle Wirkung verstanden wird. Hierin liegt das naturalistische Missverständnis, das auch dann noch wirksam sein kann, wenn man sich dem spiritistischen Konzept fern fühlt. Übersinnliches wird dann mit Sinnlichem gleichgesetzt und Steiner verkommt so zum Lieferanten von »Mitteilungen« aus der »geistigen Welt«.86
Um dieses Missverständnis zu vermeiden möchte ich dem Konzept des »Hellsehers« dasjenige des »Geistesforschers« gegenüberstellen. Der Forscher, das versteht sich, wird nicht unvermittelt zu seinen Tatsachen kommen wie der Hellseher. Er wird vielmehr einen vermittelten Prozess durchlaufen, in dem deutlichere Erkenntnisse undeutliche ersetzen; der von Revisionen, Geduld, Studium, Hoffnungen und Enttäuschungen durchzogen sein wird; ein Prozess überdies, der sprachlich oder zumindest symbolisch vermittelt ist und der deshalb auch der Deutung bedarf und somit Mehrdeutigkeiten und Perspektivität einschließt. Auch hier spielt als Erfahrungsprinzip die »Schau« eine unverzichtbare Rolle. Aber sie ist unreduzierbar eingebettet in den Forschungsprozess im Sinne der jeweiligen Überschreitung des diskursiven Vorgehens und des Rückbezugs auf dieses. Im Unterschied zum Hellseher arbeitet ein Forscher mit Hypothesen.
Wenn ich den Typus des Geistesforschers im Folgenden anhand von Steiners Verwendung des Begriffs der Hypothese erläutere, dann treten vor allem drei Konsequenzen in Erscheinung. Zunächst wird die jeweilige und nicht bloß an den Forscher delegierte Erfahrungsbezogenheit aller geisteswissenschaftlichen Aussagen angesprochen: Hypothesen sind keine simplen Mitteilungen, sondern zu bestätigende, nachzuvollziehende und in diesem Sinn problematische Aussagen. Sodann wird ihr unsicherer und provisorischer Status deutlich: Hypothesen sind keine unverrückbaren Grundsätze, sondern immer vorläufige, unsichere und revidierbare Aussagen. Und schließlich wohnt ihnen ein mehr oder weniger subtiler Aufforderungscharakter inne. Er sagt: Überprüfe uns, mache mit uns Erfahrungen, verlasse dich nicht auf uns! Hypothesen sind also auch performativ. Es sind sensible Behauptungen, deren Status sich als unsicher und irritierbar, deren Eigenart sich als erfahrungsoffen und empfänglich zeigt. Im semantischen Feld, das sich für die Übersetzung des Ausdrucks »Hypothese« anbietet, bevorzuge ich damit das Wort Behauptung mit seiner willentlichen Komponente. Die ebenfalls mögliche, eher »apollinische« Rede von Annahme oder unbewiesener Voraussetzung zeigt diese Komponente weniger.87 Sie wird indessen in der zeitgenössischen Literatur in Steiners Umfeld bevorzugt.88 In der dynamischen Willensbezogenheit tritt kontrastiv ein für Steiner spezifischer Zug zum Vorschein.
In der folgenden Darstellung und Diskussion der Funktion der Hypothese im Werk Steiners werfe ich zunächst einen Blick in die Entstehungsgeschichte der Steiner’schen Theosophie nach der Jahrhundertwende, innerhalb derer der Begriff der Hypothese als hermeneutisches Angebot in Erscheinung tritt. Von da aus verfolge ich einige prägnante Verwendungen des Begriffs in seinem Werk zwischen der frühen Goethe-Edition und späten Vorträgen. Dann erprobe ich den Begriff der Hypothese an einem Beispiel, dem theosophischen Topos »Lemurien«. Zum Abschluss führe ich aus, dass in den von Steiner beschriebenen drei spirituellen Erkenntnisstufen »Imagination«, »Inspiration« und »Intuition« das hypothetische Moment erscheint und dass es in diesem subtilen Kontext auch einer Hermeneutik des Irrtums bedarf.