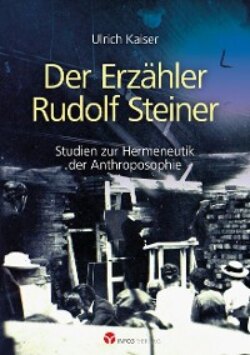Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 24
»Kleider und Hüllen vom Wesen der Sache.« (Marie von Sivers)
ОглавлениеNur einige Monate nach dem besprochenen Brief holt Steiner die vermutlich versäumte Antwort auf die Frage von Martha Asmus an anderer Stelle nach. In einer »privaten Lehrstunde« in Berlin-Schlachtensee vom 7. Juli 1904 schließt er an eine esoterische Betrachtung zu den drei (symbolisch-mythologisch zu verstehenden) Elementen Feuer, Luft und Wasser und den Begriffen des Seins, des Lebens und des Bewusstseins eine kleine Methodologie der theosophischen Dogmatik an, die wie eine systematisch entwickelte Antwort auf die Frage von Martha Asmus wirkt.
Zugleich macht er an dieser Stelle deutlicher, was er noch 1892 mit der gegenüber dem Pionier der Theosophie in Deutschland, Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846–1916), luftig hingeworfenen Metapher von einer »geistigen Schwimmkunst« (GA 30, 511) praktisch meinen könnte. Hatte Steiner an dessen Buch »Das Dasein als Lust, Leid und Liebe«55 vor allem auszusetzen gehabt, dass Hübbe-Schleiden darin »Bilder« und »Sache« verwechsle (GA 30, 511), so stellt er andererseits Bilder als notwendige Mittel dar, die, tätig ergriffen, zu spiritueller Erfahrung hinführen. Dafür nutzt er die mit dem Element des Wassers verbundene Metaphorik, mit der er ein distanziertes, mäßig engagiertes Klassifizieren einerseits einer tätigen und existenziellen Auseinandersetzung mit Esoterik andererseits gegenüberstellt. Die Tiefe des Wassers sowie das Schwimmen (im Sinne des Einsteigens: in das Element und den Verlust des festen Bodens sowie die Notwenigkeit, tätig zu sein) sind dabei Leitmetaphern.56
»Die intuitive Weisheit des Orients strömt in einem tiefen Bette. Nur der Forscher, der sich in das für die Erkenntnis gefährliche Element wagt, kann den Grund erreichen … Man kann ohne geistige Schwimmkunst bei dem Werke auskommen. Das Wasser der mechanischen Naturerklärung, zu dem der Verfasser … uns führt, reicht kaum bis an die Knöchel« (GA 30, 511).
Die damit verbundene qualitativ-dynamische Metaphorik des Flüssigen und der Bewegung wird Steiner in dem Moment, in dem er selber nun auf das theosophische Gedankengut zurückgreift, explizit wieder aufnehmen. Allerdings bleibt die Leitmetaphorik hier nicht das Wasser, an dieser Stelle wird es das Feuer.
Der Inhalt der besagten esoterischen Stunde ist von einer ihrer drei Teilnehmerinnen, Marie von Sivers (1867–1948), der wesentlichen Initiatorin von Steiners theosophischer Arbeit und seiner späteren Frau, 57 in stichwortartigen Notizen aufgezeichnet worden. Wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung gebe ich sie in einem größeren Auszug wieder.
»Wir haben uns bemüht, von den verschiedenen Standpunkten den Dingen nahezukommen und Begriffe flüssig zu erhalten, anzuheften an die Dinge. In jeder Form des Begreifens nur eine Hülle für das Wesen zu sehen, ist ein wichtiger okkulter Satz. Das Wesen muss in uns leben. Wir müssen uns fortwährend Kleider und Hüllen vom Wesen der Sache machen, uns aber bewusst sein, dass in diesen Hüllen und Kleidern das Wesen der Sache gar nicht enthalten ist. In dem Augenblick, wo wir eine Ausdrucksform für das innere Wesen der Sache gefunden haben, haben wir das Esoterische exoterisch gemacht. Niemals kann also das Esoterische anders mitgeteilt werden als in exoterischer Form. Bilde fortwährend Formen des Begreifens, aber überwinde zugleich immer diese selbstgeschaffenen Formen des Begreifens …
Es ist unmöglich, in einer Dogmatik-Lehre das Um-und-Um einer Wahrheit zu sehen; die Dogmatik ist nur der zweite Moment. Erst wenn man sie überwunden hat, hat man die Wahrheit der Dinge selbst eingesehen. Daher der wichtige Satz: Der Mensch muss, um die Wahrheit zu erkennen, dogmatisieren, aber er darf nie im Dogma die Wahrheit sehen.
Und damit haben wir das Leben des Wahrheit suchenden Menschen, der das Dogma umschmelzen kann im Feuer des Begriffs. Daher schaltet der Okkultist in freiester Weise mit dem Dogma« (GA 89, 253 f.).
Aus dieser kleinen »Dogmatik-Lehre«, die einerseits theosophische Dogmen fordert und sie andererseits als sekundär situiert, hebe ich die folgenden Merkmale hervor:
1. Zunächst wird auf die Beweglichkeit und in eins damit auf die Mehransichtigkeit (d.h. umgekehrt immer auch Perspektivität) einer esoterischen Darstellung hingewiesen; eine Aussage (genauer: ihr Gehalt) ergibt sich nur aus dem Durchgehen durch einzelne Standpunkte oder Ansichten. Die qualitativen Metaphern »flüssig« und »umschmelzen« deuten auf substanzielle Beweglichkeit und Metamorphose hin. (Vgl. meine Ausführungen zum Unterschied von Definieren und Charakterisieren in der Einleitung)
2. Zwischen der symbolischen Ausdrucksform oder dem Dogma und dem damit intendierten Prozess, dem Wesen, besteht eine Differenz und sogar Distanz. Sie dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Anders gesagt: Theosophische Dogmen oder Aussagen sind nicht mit (der) Wahrheit identisch, wenn sie auch in einem heuristischen Bezug zu ihr stehen. Wahrheit steht zunächst lediglich für Differenz gegenüber dem Dogma.
3. Das Verhältnis zu den einzelnen Dogmen ist eines der De-Konstruktion: Sie sollen einerseits gebildet, konstruiert werden, andererseits aber auch fortwährend überwunden, d. h. destruiert werden.58 Das Verhältnis zu den Dogmen ist in bestimmtem Sinn ambivalent und paradox.
4. Der Umgang mit der Dogmatik geschieht denkend – nicht »schwärmerisch« oder »gläubig« (s.o.). Darauf deutet die Metapher vom »Feuer des Begriffs«. Das Feuer verrichtet Arbeit und verwandelt Substanzen durch einen längeren Prozess, ganz anders als der ephemere »Blitz«, der für momentane Einsicht steht und der natürlich auch in solchen zusammenhängen prominent ist, etwa in Platons siebtem Brief.
5. Die Beziehung zum Dogma ist eine freie; die Geltung des Dogmas darf insofern nicht vorausgesetzt werden.
6. Es gibt im Prinzip keine esoterische Form; alle Ausdrucksformen sind bereits exoterisch. Von daher und aus Punkt 4 ergibt sich, dass das Verhältnis von Denken und symbolischem Gewand demjenigen von Esoterik und Exoterik entspricht, die damit notwendig aufeinander bezogen bleiben. Esoterik und Exoterik sind ineinander verwunden.
7. Esoterik wird nicht institutionell verstanden, sondern individuell und persönlich, wie bereits 1892 in der Hübbe-Schleiden-Rezension: »Vertiefung in sein Inneres« (GA 30, 511). Sie, die persönliche Vertiefung, ist der Angelpunkt, nicht die Institution.