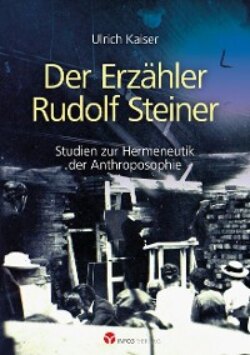Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 36
Revisionen, Unklarheiten, offene Forschungsprozesse
ОглавлениеIn den wenigen öffentlichen, nicht speziell vor theosophischem Publikum gehaltenen Vorträgen, in denen er das Thema aufgreift, grenzt Steiner die theosophische Variante der Erdgeschichte ausdrücklich von derjenigen Haeckels ab, sieht bei Haeckel aber auch eine sachliche Bestätigung für die theosophischen Aussagen. In den öffentlichen Vorträgen ist der Tonfall weniger stimmungsvollmystisch, sondern nüchtern-diskursiv: »Wir werden … zu der Behauptung geführt, dass wir naturwissenschaftlich die frühesten Entwicklungsstadien des Menschen wahrscheinlich nicht mehr nachweisen können, vermutlich weil die Gebiete der Erde, auf denen sich der Mensch von heute damals entwickelt hat, von den Fluten des Ozeans bedeckt sind. Nur auf ein Gebiet weist uns die Naturwissenschaft immer wieder hin. Das ist das Gebiet im Süden von Asien, im Osten von Afrika und hinunter nach Australien. Ernst Haeckel vermutet, dass dort ein uralter, untergegangener Kontinent zu suchen ist und dass sich die Zwischenstufen zwischen Tier und Mensch dort einmal entwickelt haben. Er nennt diesen Kontinent Lemurien« (GA 54, 134) [1905]. »Die Naturwissenschaft gibt diesen Kontinent, der etwa an der Stelle des heutigen Indischen Ozeans lag, zu, obwohl sie als Bevölkerung auf demselben nicht Menschen annimmt, sondern niedere Säugetiere« (GA53, 300) [1905].
Noch 1910, als Haeckel seine Theorie bereits wieder zurücknimmt (vgl. Abbildung II), ist beiläufig bei Steiner immer noch vom »alten Lemurien« die Rede, »wie es die heutige Naturwissenschaft ja auch nennt« (GA 119, 146). Und noch 1924 setzt Steiner vor Arbeitern am Goetheanumbau die Landbrückenhypothese voraus (GA 354, 62 f., 65 ff.), allerdings geht es Steiner hier darum, im Prinzip deutlich zu machen, dass sich die Erdoberfläche in großen Zeitabschnitten bewegt und nicht statisch ist. Steiner greift zur Erläuterung auf das zurück, was ihm naturwissenschaftlich zur Verfügung steht: die Vorstellung, dass sich die Erde an unterschiedlichen Stellen hebt und senkt, dass Kontinente überflutet werden, weil sie sich senken und andere sich aus dem Meer heben.
Gleichwohl inszeniert er schon 1923 ansatzweise und in einer durchaus waghalsigen Variante101 die von Alfred Wegener (1880–1930) erstmals im Herbst 1911 erwogene, ab 1912 publizierte, aber erst sehr viel später anerkannte Idee der Kontinentalverschiebung, eine neue Hypothese, welche die Landbrückentheorie ablöst (GA 349, 204 f.; GA 347, 145; vgl. GA 300c, 42 f.). 1919 interessiert er sich bereits wertschätzend für Wegener. Steiner erweist sich als progressiv und sensibel für einen sich ankündigenden, eingreifenden Fortschritt in den Naturwissenschaften – und zwar früher als viele Fachleute der Zunft, 102 belässt aber in seinen Erzählungen die Details einer ungezügelten Phantasie, die man sich gewissenhafter wünschen würde. Hier waltet die pragmatische Haltung des Redners vor, der irgendwie in der Richtung richtig, aber sehr unpräzise erzählt.
Abbildung I: Tafel XV aus der 7. Auflage von Haeckels »Natürliche Schöpfungsgeschichte« von 1879 [1. Aufl. 1868]; in den folgenden Auflagen wird das Paradies ins eurasische Festland versetzt und die Landbrückentheorie aufgegeben. Siehe Abbildung II.
Abbildung II: Tafel XXX in der 11. »verbesserten« Auflage von Haeckels »Natürlicher Schöpfungsgeschichte« von 1911: die Landbrückenhypothese wird im Bild fallengelassen, wenn sie auch im Text (bis zur letzten Ausgabe) im Prinzip aufrechterhalten wird. Dort heißt es jetzt: »Wenn wir dieses Lemurien als Urheimat annehmen wollten, so ließe sich daraus am leichtesten die geografische Verbreitung der verschiedenen Menschenarten durch Wanderung erklären. Indessen sind in letzter Zeit gegen diese, auch von mir früher vertretene Hypothese erhebliche Bedenken, besonders von geologischer Seite geltend gemacht worden« (S. 757).
Steiner weiß indessen – sich des unterschiedlichen Publikums wohl bewusst – zwischen einer naturwissenschaftlichen Hypothese und einer geisteswissenschaftlichen Schilderung klar zu unterscheiden. Dennoch werden aber besonders in seinen mündlichen Darstellungen die Ebenen allenthalben vermischt, wenn er sich auf theosophische Narrative bezieht, die wenig skrupulös als »Wahrheiten« geschildert werden. In der Tendenz will Steiner seelische, spirituelle Vorgänge schildern. Er legt Wert darauf, dass es sich zugleich um reale, keineswegs bloß symbolisch gedachte Vorgänge handle, »dass ich Lemurien für eine richtige Ortsbestimmung und kein Symbol halte« (GA 21, 4l ff.). Wie aber, wenn seine Geisteswissenschaft nachhaltig etwas behauptet, das den naturwissenschaftlichen Tatsachen nur als vorübergehende Hypothese bzw. nach heutigem Wissensstand nicht entspricht – wie der »Kontinent Lemuria«? Hier ist die aktuelle naturwissenschaftliche Aussage überzeugend, die theosophische oder »geisteswissenschaftliche« ist es nicht.103