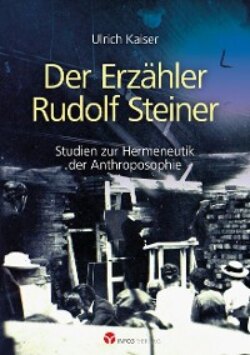Читать книгу Der Erzähler Rudolf Steiner - Ulrich Kaiser - Страница 16
Überblick über dieses Buch
ОглавлениеDie Gesamtheit dieser Studien gliedert sich in drei Teile, die wiederum zusammen fünf Grundbegriffe bzw. Begriffsfelder entfalten. Der erste Teil widmet sich den beiden Grundbegriffen Dogma und Hypothese. Der zweite, mittlere Teil stellt einen Begriff bzw. eine Denkform dar, mit der sich ein Einstieg in esoterisches Denken vollzieht. Er steht in der Mitte dieser Studien und verbindet sich mit einem exemplarischen, stärker historisch orientierten Text zu Max Dessoir, der die schwierige Situation beleuchtet, eine einerseits souverän-kritische und zugleich verstehende Haltung zu entwickeln und durchzuhalten. Der dritte Teil stellt zwei neuere kulturwissenschaftliche Forschungsfelder vor, das der Performativität und das der Narrativität, die, im Unterschied zu den Begriffen Dogma und Hypothese, erst in den letzten Jahrzehnten Teil einer allgemein kulturwissenschaftlichen Forschung geworden sind. Sie werfen ein spannendes, aktuelles Licht auf Steiners Werk und ermöglichen ein neues Verständnis.
Die Begriffe Dogma und Hypothese stehen zueinander komplementär, insofern sich Dogma auf überliefertes Lehrgut richtet und einen freien oder weniger freien Umgang nach sich zieht. Im Gegensatz zum Dogma ist die Hypothese von vornherein erfahrungsorientiert, sie muss nur in ihrem vorläufigen Charakter ernstgenommen werden. Während das Dogma vergangenheitsorientiert ist und sich eher mit Texten beschäftigt, ist die Hypothese an der je zukünftigen Erfahrung interessiert und hat ihre eigentliche Domäne in der Natur. Gleichwohl verbinden sich beide darin, dass erfahrungsgeleitete genauso wie überlieferungsorientierte Erkenntnis tendenziell Horizontüberschreitung, Neues, Verwandlung, Entwicklung bedeuten können. Die Hypothese könnte dem Dogma zeigen, dass es eine vorläufige Funktion hat, prinzipiell hinfällig ist und erfahrenden Nachvollzug fordert; das Dogma würde der Hypothese erklären, dass sie Studium und Wissen voraussetzt und – wie es selbst – behauptet, aber dabei enorm sensibel sein muss.
Auch wenn der von Steiner als Selbstbezeichnung gebrauchte Begriff des »Hellsehers« vermuten lässt, dass es sich bei Theosophie und Anthroposophie um vorwiegend erzählerische, mitteilende Texte und Kontexte handelt, ist doch der Einstieg in die Theosophie für den Philosophen Rudolf Steiner fundamental eine Transformation des Denkens. Deshalb ist es wichtig, Denkformen zu erkunden, die spezifisch anthroposophisch sind bzw. die Steiners denkerische Transformation der Theosophie vor allem in den ersten Jahren aufzeigen. Insofern handelt es sich bei dem Kapitel über die Umkehr als Denkform um eine Studie zu Steiners »bricolage«32 im Aneignungsprozess der Theosophie, die ich im engeren Sinn als Arbeitsbegriff »kohärente Verformung« nenne. Umkehr ist hier ein Übergangsbegriff, der noch in der Philosophie wurzelt und zwar interessanterweise im künstlerischen Denken von Novalis, aber bereits ein das Begriffliche überschreitendes Denken ist und im spezifischen Sinn esoterisch wird, d. h. sich von der Sinneserfahrung in anderer Weise ablöst als der Begriff es tut. Während Dogma und Hypothese noch herkömmliche Begriffe sind, ist es die Umkehr nicht mehr. Hier wird es qualitativ übergängig. Die Studie zeigt indirekt auch, inwieweit der Ausdruck des »Hellsehens« eine terminologische Randerscheinung und unreflektierte Übertragung aus dem Kontext des Spiritismus auf den des esoterischen Denkens darstellt. Areale des »Hellsehens« wären als im engeren Sinn narrative Mitteilungen in Steiners Werk einzugrenzen und ins Verhältnis zu setzen zum Bereich der »Geistesforschung« oder der »Geheimwissenschaft«, die auf esoterischem Denken aufruht. »Das Denken des Geheimwissenschafters [sic]«, so Steiner in einem seiner frühen esoterischen Vorträge, »ist ein anderes, es ist ein solches, das Einheiten ergreift, große Zusammenhänge auf einmal überschaut, es ist durchlebte Erfahrung, ein Schauen von höheren Wirklichkeiten. Der Mensch macht sich einen gemeinschaftlichen Begriff aus Einzelheiten. Der Geheimwissenschaftler bekommt einen intuitiven Begriff auf einmal durch innere Erfahrung und ist nicht darauf angewiesen, soundso viele einzelne Erfahrungen zu machen.«33 Mit dieser typologischen Unterscheidung, die das intuitive Denken dem empirischen gegenüberstellt, haben wir es zum einen genauer mit der Charakterisierung eines Übergangsfeldes zu tun, und zum anderen mit einer anfänglichen Erläuterung von Steiners Methode überhaupt. In diesem Feld ist Umkehr ein zentraler – oder möglicherweise der zentrale – Begriff.
Der Beitrag zu Max Dessoir und Rudolf Steiner, ein Exkurs in historischer Hinsicht, zeigt an einem prominenten Beispiel die Schwierigkeiten und Missverständnisse, die zwischen akademischer Forschung und anthroposophischem Selbstverständnis entstehen können. Es geht darum, sie besser zu verstehen: Kritik ist legitim und nötig, aber was sind ihre Grundlagen und Kriterien? Die dichte und gleichwohl verfehlte Auseinandersetzung zwischen Dessoir und Steiner ist in ihrer Detailliertheit selten und lehrreich. Ungesehen ist bislang, dass Dessoir mit seiner Typologie des »magischen Idealismus« den Ansatz der Esoterikforschung im Sinn von Antoine Faivre vorweggenommen hat. Dessoirs Provokation verdanken wir überdies das Buch »Von Seelenrätseln« (GA 21), zumindest in dieser Gestalt, in dem Steiner im Jahr 1917 eine grundlegende Neuorientierung seines Ansatzes vornimmt und das Verhältnis der Anthroposophie zu den akademischen Wissenschaften innovativ konzipiert.
Performativität und Narrativität ihrerseits sind in sich aufeinander bezogene Forschungsfelder (für die einen) oder Betätigungsfelder (für die anderen). Als mittlerweile gut etablierte kulturwissenschaftliche Konzepte geben sie uns Mittel an die Hand, genauer zu verstehen, was sich in und mit(hilfe) von Steiners Werk abspielt. Sie machen nämlich die ursprüngliche Verwindung von Tun und Verstehen, von Denken im Handeln und Handeln im Denken in Steiners Werk nachvollziehbarer als veraltete binäre Konzepte wie Theorie und Praxis oder theoretischer Überbau und machpolitische Basis. Sie sind deshalb wie kaum andere kulturwissenschaftliche Ansätze geeignet, das Eigene von Steiners Werk mit wissenschaftlichen Mitteln zugänglich und sichtbar zu machen.
Während sich die Performativitätsforschung mehr auf die Handlungsweisen im Sprechen verlegt, richtet die Narrativitätsforschung ihren Blick stärker auf die Genese von Sinnzusammenhängen in den sprachlichen Äußerungen. Anthroposophie ist immer schon Performativität und Erzählung. Sie verlangt einen freien Umgang mit dem Dogma und übt im Blick auf das umfangreiche Werk Steiners die immer neu sich vergewissernde Selbstdisziplin hypothetischer Erfahrungsoffenheit.
Dürfte das Feld des Performativen zumindest im exemplarischen Sinn ausreichend dargestellt sein, bietet das Feld des Narrativen eine größere Zahl an Bezugspunkten und Motiven. Das Kapitel »Der Erzähler Rudolf Steiner« hat, mehr als die anderen, den Charakter eines Werkzeugkastens und der gedrängten Ansammlung von Motiven, die, bei reichhaltig vorliegender Forschungsliteratur im weitläufigen Umfeld, nach einer systematischen Ausarbeitung rufen, die aber den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Auch das Thema des Erzählens aus der Akasha-Chronik, wozu andererseits kaum Forschungsliteratur existiert, steht hier als Torso. An diesen Stellen sollte die Arbeit weitergehen.34 Dagegen ließ sich der Beitrag zu Goethes »Märchen« gut in die reichhaltige und ergiebige Forschungsliteratur einbetten und kann in seiner Thesenhaftigkeit für sich stehen. Und zwar auch als Ausgangpunkt für die weiter zu stellende Frage, wie »Märchen« und »Akasha-Chronik« ineinander vermittelt sind.35