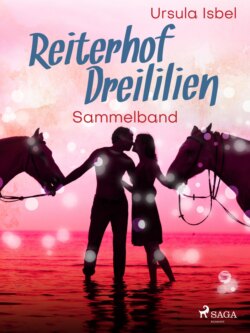Читать книгу Reiterhof Dreililien Sammelband - Ursula Isbel - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеUm Marnie nicht zu stören, ließen wir uns im Hintergrund nieder, dicht an der Stallmauer. Von dort konnten wir ihre Box im Auge behalten, waren aber von Marnie nicht zu sehen.
„Es würde sie beunruhigen, wenn wir zu nahe bei ihr sitzen würden“, erklärte Jörn leise. „Viele Stuten mögen das nicht. Wenn sie sich beobachtet fühlen, kann’s passieren, daß sich die Geburt um Stunden verzögert, und das wäre nicht gut.“
Er hatte eine Klemmlampe mit ziemlich schwacher Glühbirne mitgebracht, die er an der Querlatte eines Pfostens befestigte. Sie verbreitete mildes, gedämpftes Licht. Die Stallbeleuchtung hatten wir nicht eingeschaltet.
Lange Zeit war es still im Stall bis auf das friedliche Atmen der Pferde, ein gelegentliches Prasseln von Streu, leichtes Scharren an den Boxwänden oder das mechanische Wischen eines Schweifes, denn das Licht hatte die Fliegen munter gemacht. Draußen in der Sommernacht zirpten die Grillen um die Wette.
Jörn saß neben mir auf einem dreibeinigen Hocker, den Kopf gegen die Mauer gelehnt. Er hatte die Augen geschlossen. Das buntgewebte Stirnband, das er wie so oft umgebunden hatte, um sein langes Haar aus der Stirn zu halten, ließ ihn trotz der blonden Haare wie einen schlafenden Indianer aussehen.
Ich War voller Anspannung – nicht nur wegen des Fohlens, das vielleicht in dieser Nacht zur Welt kommen sollte. Es war auch eine ganz neue Erfahrung, mit Jörn hier Wache zu halten, so ganz allein mit ihm zu sein in diesem alten Gewölbestall zwischen den Pferden. Noch vor wenigen Monaten hätte ich mir so etwas nie träumen lassen, als mein Leben noch aus Straßen und Verkehrslärm, Schule, Kino, Discos, flüchtigen Freundschaften und einer Mietswohnung in einem großen Haus bestand.
Der Mond stand hinter den Stallfenstern und beleuchtete die sternförmige Zeichnung auf Hazels Kopf. Ich hörte Jörn leise sagen: „Nell? Fragst du dich manchmal auch, was das alles für einen Sinn hat?“
„Was meinst du?“ Überrascht sah ich ihn an.
„Das alles.“ Er machte eine weit ausholende Handbewegung. „Daß wir uns abstrampeln . . . mit den Pferden, die Sache mit der Reitschule, tagtäglich all die Arbeit, die Prüfungen in der Schule; das Leben überhaupt . . .“ Er stockte. „Während in der Zwischenzeit ein paar Politiker über unsere Köpfe hinweg über Krieg oder Frieden entscheiden. Und während sie vielleicht gerade über unser Schicksal entscheiden, sitzen wir hier und warten auf ein Fohlen, machen Pläne, versuchen, unser Leben zu leben . . .“ Er starrte vor sich hin.
Ich sagte erschrocken: „Aber was Sollen wir denn anderes tun? Wir können doch nicht einfach wie hypnotisierte Kaninchen herumsitzen und warten, ob eine Katastrophe passiert. Wir müssen das Nächstliegende tun – uns um uns selbst kümmern, um Leute, die uns wichtig sind, um die Pferde, um Dreililien. So wahnsinnig und verantwortungslos werden die Politiker doch nicht sein, daß sie einen Atomkrieg heraufbeschwören, Jörn! Sie wissen doch; daß das das Ende wäre, daß sie so einen Krieg nicht nur auf Deutschland oder Europa beschränken könnten. Sie würden die ganze Erde verseuchen und sich damit selbst auch vernichten! Denk an Hiroshima, was diese vergleichsweise kleine Bombe bewirkt hat – das können sie doch nicht vergessen haben!“
Im gedämpften Schein der Lampe sah er mich eindringlich an. „Du darfst nicht mit ihrer Vernunft oder Menschlichkeit rechnen, Nell. Sicher müssen wir an das Nächstliegende denken, an die Menschen und Tiere, die uns etwas bedeuten, die uns brauchen, an unsere eigene Zukunft, unsere Umwelt – aber wir dürfen die Verantwortung für diese Welt nicht einfach abgeben wie Kinder an ihre Eltern, die denken: Sie werden’s schon richtig machen. Sie haben es doch jahrhundertelang nicht richtig gemacht.“
„Aber was können wir denn tun?“ Ich beugte mich vor und sah ihm in die Augen. Dabei merkte ich, daß er vor Erregung zitterte. Dieses Gespräch machte mir Angst. Irgendwo spürte ich, daß Jörn recht hatte, und doch wollte ich eigentlich lieber nichts von all dem wissen, wollte weiter in meiner heilen Welt leben, glücklich und unbeschwert sein hier auf dem Land mit ihm und Matty, meinem Vater und Kirsty, den Pferden und der Natur.
Jörn nahm meine Hand in die seine und sagte leidenschaftlich: „Was wir tun können? Wir müssen mitmachen, wenn die Leute demonstrieren und den Politikern klarmachen, was der größte Teil des Volkes, vor allem die Jugend, will – was wir wollen, Nell! Der Frieden ist etwas, worum es sich zu kämpfen lohnt; und er ist nicht selbstverständlich!“
Ich hatte mich Jörn noch nie zuvor so nahe gefühlt wie in diesem Augenblick. Noch immer hielt er meine Hand fest in der seinen. Mein Herz klopfte so heftig. Ich dachte: Er hat ja recht! Man muß etwas tun – nicht immer nur die anderen; jeder einzelne, auch ich!
„Im Oktober ist in München eine große Friedensdemo“, sagte er leise. „Kommst du mit, Nell?“
Es war wie ein Geschenk – daß er mich fragte und mich dabeihaben wollte bei einer Sache, die ihm wichtig war.
„Ja“, sagte ich. „Natürlich komme ich mit.“
Er ließ meine Hand los. Erst jetzt hörten wir die Geräusche aus Marnies Box.
Rasch sahen wir auf. Marnies Kopf tauchte über der Holzwand auf. Sie zitterte. Ich sah Schweiß auf ihren Nüstern glitzern.
Jörn erhob sich leise. Er bewegte sich sehr behutsam, ging in die Sattelkammer, holte Desinfektionsmittel und Bandagen. Einen Eimer voll Wasser hatte er schon vor Marnies Boxtür bereitgestellt.
Ich blieb sitzen, um die Stute nicht zu beunruhigen, und sah ihm zu. Jörn goß etwas von dem Desinfektionsmittel ins Wasser, nahm einen neuen Schwamm aus einer Zellophantüte und öffnete die Boxtür.
„Was machst du jetzt?“ flüsterte ich.
Er drehte sich um. „Ich muß ihr die Geschlechtsteile waschen“, erwiderte er leise und ohne Verlegenheit. „Sie müssen desinfiziert werden, weißt du. Dann wird am Schweifansatz eine Bandage angelegt, damit nach der Geburt kein Schmutz in die Gebärmutter kommt.“
Im milden Licht der kleinen Lampe beobachtete ich, wie er mit gezielten, ruhigen Handgriffen arbeitete. Die Stute hatte den Kopf nach hinten gedreht und sah ihm unverwandt zu, ließ jedoch alles mit sich geschehen, als wüßte sie, daß es zu ihrem Besten war. Sie zitterte noch immer, und ihre Ohren spielten unruhig.
Plötzlich trat Jörn zurück. Die Stute stieß einen seltsamen Laut aus, halb Schnauben, halb Wiehern. Sie ließ sich in die Streu nieder. Ein Gefühl sagte mir, daß es jetzt soweit war.
Jörn winkte mir zu. Auf Zehenspitzen schlich ich von der Seite her näher, so daß Marnie mich nicht sehen konnte. Zwischen ihren Hinterbeinen erschienen zwei dünne, ausgestreckte Fohlenbeine. Dann zeigte sich der Kopf.
Jörn kniete nieder. Neben dem Eimer lag ein Stück Seife in einer Schale; er nahm es und tauchte die Hand in den Wassereimer, seifte sie ein. Nun war der Pferdekopf ganz herausgetreten.
Atemlos sah ich zu, wie Jörn die Haut der mütterlichen Scham, die über das Fohlen gespannt war, mit der flachen Hand in Richtung Stute zurückschob. Dann zog er am linken Vorderbein des Fohlens, das noch nicht ganz so weit herausstand wie das rechte, bis beide Hufe auf gleicher Höhe waren.
„Bring mir den Apothekerkasten – schnell!“ zischte er mir zu.
Ich rannte in die Sattelkammer. Mit vor Aufregung zitternden Fingern öffnete ich den Wandschrank. Der Apothekerkasten war groß und schwer; ich schleppte ihn zu Marnies Box.
Da war das Fohlen schon aus dem Mutterleib, lag auf der Streu, nur noch durch die Nabelschnur mit der Stute verbunden – ein braunes Häufchen mit überlangen Beinen, verklebt und erschöpft. Doch es atmete schon, und Marnie leckte es liebevoll und gründlich ab.
„Es ist ein Stutfohlen“, sagte Jörn atemlos. „Zum Glück heil und gesund. Alles ist leicht und gutgegangen.“
Einige der anderen Stuten waren aufgewacht und sahen mit erhobenen Köpfen und gespitzten Ohren zu uns herüber. Hazel wieherte unterdrückt, Joschis Kopf tauchte über der Trennwand zur Nachbarbox auf.
Dann standen die beiden auf, Marnie rasch und ohne Schwierigkeiten, ihr Fohlen taumelig, unterstützt von der Nase der Mutter. Jörn beobachtete sie genauso gespannt wie ich. Er murmelte: „Da – jetzt ist die Nabelschnur durchgerissen. Prima, dann brauche ich sie nicht mehr zu durchtrennen. Wir haben zwar immer abgekochten Bindfaden im Apothekerkasten, um die Nabelschnur abzubinden, aber die Natur kann so was doch besser. Jetzt muß ich Jodtinktur haben, Nell. Sie ist in dem orangefarbenen Fläschchen.“
Ich bückte mich, fand das Fläschchen nach einigem Suchen, vergewisserte mich im trüben Licht, daß auch wirklich Jodtinktur auf dem Etikett stand, und wollte es Jörn geben. Er aber schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er, „behalte es. Du mußt mir helfen. Ich spreize den Nabel des Fohlens auseinander, und du tropfst etwas von der Jodtinktur in die Nabelöffnung. Die Desinfektion des Nabels ist nämlich sehr wichtig.“
Er faßte das Fohlen mit sanftem, aber festem Griff und legte es auf den Rücken in die Streu. Marnie senkte den Kopf. Ihre Nüstern waren dicht neben Jörns Oberarm, als er den Nabel des Neugeborenen mit beiden Händen behutsam auseinanderzog.
Ängstlich kniete ich neben ihm nieder. Ich hatte so etwas noch nie in meinem Leben gemacht. Flüchtig fragte ich mich, was mein Vater gesagt hätte, wenn er mich hier in Marnies Box gesehen hätte. Doch dann konzentrierte ich mich voll darauf, einen kleinen Teil der Jodtinktur in die Nabelöffnung zu träufeln, bis Jörn sagte: „Das reicht. Alles in Ordnung. Ich brauche jetzt ein paar Tücher, um dem Kleinen den Schleim aus dem Maul und den Nüstern zu wischen, damit es richtig atmen kann. Im Korb neben dem Hocker sind saubere Papiertaschentücher. Bringst du sie mir?“
Ich nickte nur. Als ich mit den Taschentüchern kam, stand das Fohlen schon wieder auf den Beinen. Liebevoll und vorsichtig wischte ihm Jörn die Nase sauber. Dann rieben wir das Fohlen gemeinsam mit Strohwischen trocken.
Wir schwitzten beide heftig. Die Fliegen begannen immer lästiger zu werden, aber wir hatten keine Zeit, sie richtig abzuwehren.
„Mal sehen, ob das Fohlen das Euter von selbst findet“, sagte Jörn und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. „Wenn nicht, müssen wir ihm dabei helfen. Sonst kann’s passieren, daß es Fohlenpech bekommt.“
„Fohlenpech?“ wiederholte ich erschrocken.
„Ja. Das ist so was Ähnliches wie Darmverschluß. Dann müßte man einen Einlauf mit lauwarmem Seifenwasser machen, und das ist kein Vergnügen.“
Gespannt beobachteten wir Marnie und ihr Kleines. Das Fohlen rührte mich zutiefst – es wirkte so hilflos und unschuldig. Und der Blick seiner übergroßen, glänzenden Augen war ungemein sanft und verwundert.
„Aber wie ist das denn in der Natur?“ fragte ich. „Da ist ja auch keiner da, um bei der Geburt zu helfen und dafür zu sorgen, daß das Fohlen weiß, wo es trinken soll. Es kann auch niemand einen Einlauf machen.“
Jörn lächelte. „Pferde, die schon seit Jahrhunderten von Menschen gezüchtet werden, sind keine Naturwesen mehr“, erklärte er dann. „Das ist wie bei uns Menschen – wir kommen ja auch nicht mehr ohne Geburtshilfe aus. Eigentlich ist eine Geburt die natürlichste Sache der Welt, aber für uns zivilisierte Leute und die Tiere, die wir halten, ist eine ziemlich schwierige Sache daraus geworden. Das, was du heute nacht erlebt hast, war eine sehr einfache Geburt. Es gibt Pferde – vor allem besonders hochgezüchtete – , bei denen das Abfohlen zur Knochenarbeit wird. Es ist oft ein harter, anstrengender Kampf, schon mehr eine Operation als ein natürlicher Vorgang, und leider kommt es dabei nicht selten vor, daß das Fohlen stirbt.“
Marnies Fohlen jedenfalls lebte und war gesund; und es hatte das Euter seiner Mutter selbst gefunden. Es trank. Andächtig sahen wir zu.
Eine leichte Geburt! dachte ich und sagte unwillkürlich: „Dabei fand ich schon, daß du wild geschuftet hast.“
Er sah mich von der Seite an und lächelte wieder. „Das ist nur, weil es deine erste Fohlengeburt war. Da kommt einem alles schwierig und aufregend vor, auch wenn’s nur die üblichen Handgriffe sind. Wenn du noch ein paarmal zuschaust und mithilfst, kannst du das notfalls bald auch allein.“
Jörn wirkte so zufrieden und gelöst wie nur selten. Ich merkte, daß er glücklich war. Wir waren beide glücklich in dieser Stunde.
„Das ist jedesmal ein gutes Gefühl“, sagte er leise. „Das Gefühl, etwas Wichtiges geschafft zu haben, verstehst du?“
Ich nickte. Unser Gespräch von vorher fiel mir wieder ein; ein seltsames Gespräch für eine Nachtwache im Pferdestall. Und doch, vielleicht gar nicht so seltsam, wenn man bedenkt, daß wir hier ja auf die Geburt eines neuen Lebewesens gewartet hatten.
Das Fohlen hatte zu trinken aufgehört. Unsicher stand es auf seinen dünnen Beinen da und sah sich um. Marnie leckte ihm zärtlich das Maul.
„Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, daß das Kleine nicht die Boxwände ableckt“, murmelte Jörn. „So ein Neugeborenes ist noch nicht widerstandsfähig gegen Krankheitskeime.“
„Wie soll es denn heißen?“ fragte ich. „Weißt du schon einen Namen für Marnies Fohlen?“
Unsere Blicke trafen sich. „Ich glaube, wir werden es Nell nennen, weil du geholfen hast, es zur Welt zu bringen“, sagte Jörn dann. „Es ist ein schöner Name für ein Pferd, finde ich.“ Leise fügte er hinzu: „Und nicht nur für ein Pferd.“