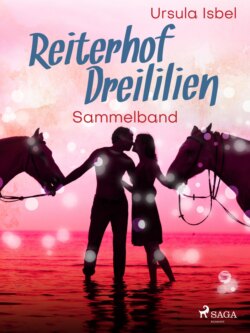Читать книгу Reiterhof Dreililien Sammelband - Ursula Isbel - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
18
Оглавление„Eigentlich finde ich Nells Idee gar nicht so schlecht“, sagte Jörn langsam und musterte mich fast überrascht, als hätte er mir nicht zugetraut, daß auch ich einmal einen brauchbaren Einfall hatte.
Ich erwiderte ziemlich spöttisch: „Ja, ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn!“ Und wir wechselten einen Blick und wußten nicht recht, ob wir lachen oder uns streiten sollten.
„Seid bloß friedlich“, sagte Carmen besänftigend. „In die Haare kriegen könnt ihr euch ein andermal. Also, ich halte Nells Vorschlag auch für gut. Was meinst du, Matty?“
Matty machte ein zweifelndes Gesicht. „Mit einem Reitschulbetrieb hat noch keiner Reichtümer verdient“, sagte er.
„Wir wollen ja gar keine Reichtümer verdienen“, wandte Jörn ein. „Es geht doch nur darum, daß wir genug Geld zum Leben haben und wenigstens noch einen Pferdepfleger bezahlen können. Etwas anderes will Vater ja gar nicht.“
Wir saßen auf der Schwammerlwiese im Kreis beisammen wie ein indianischer Kriegsrat. Joschi wanderte noch mit Sattel und schleifenden Zügeln am Zaun entlang und fraß von dem fetten Gras. Carmen hatte sich nicht Zeit genommen, die Stute abzusatteln und auf die Koppel zurückzubringen, als Matty und ich erschienen waren, um meinen Vorschlag zu besprechen.
„Einen Pferdepfleger, ja“, sagte Matty. „Aber womit sollen wir einen Reitlehrer bezahlen? Könnt ihr mir das sagen?“
„Ihr könnt doch selbst Reitunterricht geben“, meinte Carmen. „Das tut ihr ja jetzt schon.“
„Und was ist mit der Schule?“ fragte Jörn. „Sollen wir die sausen lassen? Ich stehe kurz vor dem Abitur, und Matty hat’s gerade noch geschafft, versetzt zu werden. Wir tun jetzt schon zu wenig für die Schule.“
Einige Zeit herrschte betretenes Schweigen, Mein schöner Plan, die Pferde zu retten, indem auf Dreililien eine Reitschule eröffnet wurde, war bei näherem Hinsehen offenbar doch nicht so vollkommen, wie ich geglaubt hatte. Trotzdem war ich nicht bereit, ihn so rasch aufzugeben.
„Es muß ja nicht unbedingt ein perfekter Reitlehrer mit abgeschlossener Ausbildung sein, der ein dickes Gehalt verlangt“, sagte ich schließlich. „Es gibt doch sicher eine Menge Leute, die großartig reiten können und einen Job suchen . . .“
Noch während ich das sagte, kam mir eine neue Idee. Ich sprühte an diesem Tag förmlich vor Einfallsreichtum – das passiert mir eigentlich immer nur dann, wenn ich glaube, in einer ausweglosen Lage zu sein.
„Hört mal“, fuhr ich hastig fort, „in München gibt’s so eine Art alternative Stadtzeitung. Sie erscheint alle zwei Wochen und ist voller Kleinanzeigen. Da suchen ziemlich viele Leute nach einem Job – junge Leute hauptsächlich, die gerade arbeitslos sind oder keine Lust haben, irgendwo in einem Büro oder in einer Fabrik zu arbeiten. Wir könnten doch mal versuchen, da eine Anzeige aufzugeben! Vielleicht meldet sich jemand, der pferdenärrisch ist und obendrein gut reiten kann. Jemand, der froh ist, wenn er auf dem Land leben und mit Pferden arbeiten kann und eine kostenlose Unterkunft hat.“
Ich verstummte und holte Luft. Jörn und Matty sahen mich nachdenklich an. Carmen nickte heftig und sagte: „Genau! Jemand, der mit wenig Geld zufrieden ist, wenn er eine Arbeit findet, die ihm Spaß macht. So was gibt es doch sicher!“
„Vielleicht“, murmelte Matty, und zum erstenmal an diesem Tag erschien ein Hoffnungsschimmer auf seinem Gesicht. „Ich jedenfalls würde sofort zugreifen, wenn ich in der Stadt wäre und so eine Anzeige lesen würde!“
„Ich auch“, sagte Jörn. „Ist doch klar.“
Carmen strahlte so, daß sie richtig hübsch aussah. „Na also! Man braucht ja auch nicht jeden Tag Reitunterricht zu geben, sondern vielleicht dreimal wöchentlich, vor allem an Samstagen, da haben die Leute Zeit und würden bestimmt bis aus Rosenheim hierherkommen!“
„Ich finde, wir sollten nur Reitunterricht für Jugendliche anbieten“, sagte Jörn. „Erwachsene Reiter stellen oft eine Menge Ansprüche, was die Ausbildung betrifft.“
Ich stimmte eifrig zu. „Genau! Kinder und Jugendliche bis sechzehn oder siebzehn, würde ich sagen. Und im Sommer könntet ihr doch Reiterferien anbieten! Ein paar Wochen Ferien auf dem Land mit Verpflegung und Unterkunft und Reitunterricht, das wäre sicher sehr zugkräftig! Die Leute würden aus ganz Deutschland zusammenströmen, ich schwör’s euch!“
Matty sah nicht besonders begeistert aus. Wahrscheinlich behagte ihm die Vorstellung nicht, eine schnatternde Schar Halbwüchsiger wochenlang täglich im Haus und im Stall zu haben und sich mit ihnen herumplagen zu müssen. Doch er sagte kein Wort. Sicher wußte er auch, daß das viel besser war, als die Pferde weggeben zu müssen.
„Nicht schlecht“, sagte Jörn. „Aber wer soll für die Gäste kochen und die Zimmer saubermachen? Meine Mutter bestimmt nicht, die kommt schon mit unserem Haushalt nicht klar. Und unsere Putzfrau würde sicher sofort kündigen, wenn sie davon erfährt. Eine Köchin und ein Zimmermädchen können wir uns aber bestimmt nicht leisten.“
„Ach was, im Dorf läßt sich schon eine Frau finden, die im Sommer mal ein bißchen Geld dazuverdienen will. Das ist sicher nicht schwierig“, sagte Carmen zuversichtlich. „Ich finde Nells Idee einfach prima, und ihr habt hier schließlich alles, was dazugehört: Pferde, ein großes Haus und eine schöne Umgebung. Da gibt’s doch nicht viel zu überlegen!“
„Für uns vielleicht nicht“, sagte Jörn und seufzte. „Aber warten wir erst mal ab, was Vater zu allem sagt.“
„Wenn wir ihm alles so erklären, wie wir es jetzt besprochen haben, wird er sich die Sache vielleicht doch ernsthaft überlegen“, sagte Matty unerwartet. „Es macht ihm ja selbst auch zu schaffen, daß er die Pferde nicht halten kann. Er liebt sie wohl auf seine Art . . . er ist nur so bitter und mutlos geworden seit seinem Unfall.“
„Vielleicht können wir ihn überzeugen – vielleicht versucht er’s wirklich“, meinte Jörn, doch es klang nicht allzu hoffnungsvoll. „Am besten warten wir bis zum Abend damit. Er sitzt heute über seinen Geschäftsbüchern, da läßt man ihn besser in Ruhe, bis er fertig ist.“
Matty nickte. „Mir wär’s lieber, wir könnten mit ihm reden, aber du hast schon recht. Ich weiß bloß nicht, wie ich es bis zum Abend aushalten soll.“
Ich wußte es auch nicht. Vor Nervosität und Anspannung hatte keiner von uns rechte Lust, irgend etwas zu unternehmen. Carmen mußte nach Hause, um bei der Heuarbeit zu helfen, und wir versprachen, sie abends noch anzurufen und ihr zu erzählen, was Herr Moberg zu unserem Vorschlag gesagt hatte.
Die Mittagszeit war längst vorüber, als Carmen endlich losradelte. Jörn, Matty und ich gingen in den Stall, sattelten Joschi ab und brachten sie auf die Koppel zurück.
Erst später, als ich an die Gartenpforte des Kavaliershäusls kam, fiel mir ein, daß ich Matty und Jörn über all der Aufregung nichts von Herrn Alois erzählt hatte.
Die Haustür öffnete sich, und Kirsty erschien auf der Schwelle. Ihr Gesicht strahlte. Ich bemerkte eine Bewegung hinter ihr und sah, daß Herr Alois sich wieder aufgerappelt hatte. Er wirkte zwar etwas taumelig wie jemand, der nach langer Krankheit zum erstenmal wieder das Bett verläßt. Doch er stand immerhin auf seinen vier Pfoten und wedelte zu meiner Begrüßung sogar leicht mit dem Schwanz.
Ich ging in den Hausflur, kniete nieder und streichelte ihn. Seine Augen waren noch trüb, wie von einem Schleier überzogen, und seine Nase war warm, aber Kirsty sagte glücklich: „Der Tierarzt ist vor zwei Stunden hiergewesen, Nell. Herr Alois hat die Krise überstanden. Ohne dich hätte ich’s nicht geschafft, ihm die Milch einzuflößen – und das hat ihm das Leben gerettet.“
Ich legte meine Wange an den Kopf des Hundes und dachte: Bei ihm haben wir’s geschafft, er ist außer Gefahr. Aber wie ist es mit den Pferden – wird auch da alles gut werden? Und ich merkte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen.
Kirsty sah nicht, daß ich weinte. Ich ging ins Badezimmer und wusch meine Augen mit kaltem Wasser. Als ich in die Küche kam, stand sie am Herd und briet Kartoffelpuffer.
„Wir haben schon gegessen, aber du bist sicher hungrig“, sagte sie.
Ihr zuliebe aß ich zwei von den Kartoffelpuffern und dazu ein bißchen Apfelmus, obwohl ich eigentlich keinen Hunger hatte. Mein Magen war wie zugeschnürt. Vater tauchte auf, mit schmutzigem Gesicht und zerrissener Arbeitshose, die Hemdsärmel hochgekrempelt. Als er an meinem Stuhl vorüberkam, strich er mir übers Haar.
Das hatte er lange nicht mehr getan. Ich dachte, daß ich jetzt hätte glücklich sein können, wenn die Sache mit den Pferden nicht gewesen wäre.
Ich sagte nichts von allem zu Vater und Kirsty. Was mit Dreililien, Jörn, Matty und den Pferden zusammenhing, war noch immer ganz allein meine Angelegenheit; meine Privatsache, die ich mit niemandem teilen wollte.
Später nahm ich mein Tagebuch, zog mich damit auf die Bank unter der Eiche zurück und schrieb alles nieder, was mir in den Sinn kam – von Jörn und Matty und den Pferden, und wie wichtig es mir erschien, aber auch von Kirsty und unserem nächtlichen Kampf um das Leben ihres Hundes, von meiner veränderten Einstellung zu ihr und der Wendung, die mein Leben genommen hatte.
Erst da fiel mir der alberne Wahrsagerzettel vom Volksfest wieder ein. Was für ein seltsamer Zufall war es doch, daß sich die vorgedruckte Prophezeiung aus dem Automaten erfüllt hatte, und daß dieser Zettel ausgerechnet in meine Hände gefallen war und nicht in die von irgend jemand anderem.
„Vielleicht“, schrieb ich in mein Tagebuch, „gibt es doch so etwas wie ein Schicksal. Vielleicht war es eine schicksalhafte Fügung, daß Vater Kirsty kennengelernt hat, daß ich durch sie hierhergekommen bin. Es könnte sogar sein, daß ich dazu bestimmt bin, die Pferde durch meinen Einfall vor dem Verkauf zu retten . . .“
Noch während ich schrieb, zog vom Westen her plötzlich ein Gewitter auf. Ich beobachtete eine Weile regungslos, wie sich die blauschwarzen Wolken hinter den Tannenwipfeln türmten. Der Wind, der die Blätter vorher sacht bewegt hatte, verstärkte sich und strich rauschend durch das Laub der alten Eiche, brauste in den Obstbäumen und verblätterte die Seiten meines Tagebuches, die ich beschrieben hatte.
Ich nahm mein Schreibzeug, brachte es auf mein Zimmer und ging wieder ins Freie. Der Himmel war jetzt sehr dunkel und leuchtete an manchen Stellen bedrohlich schwefelgelb. Der Wind hatte noch an Stärke zugenommen. Die Wälder rauschten, und vom Dorf her klang verwehtes Glockengeläut herüber.
Auf der Koppel standen die Pferde dicht gedrängt vor dem Gatter. Ihre Mähnen und Schweife flatterten im Sturm. Noch während ich zwischen den Haselnußstauden stand und zu ihnen hinübersah, bemerkte ich, wie jemand vom Dreililienhof her zur Koppel gelaufen kam. Es war Matty. Ihm folgten Jörn und eine dritte Gestalt; vermutlich war es Sepp.
Unwillkürlich begann ich auch loszulaufen, zur Wegkreuzung und dann den Pfad zwischen den Koppeln entlang. Als ich das Gatter erreichte, hatten sie es schon geöffnet, und die Pferde stürmten auf den Pfad, so wild und gehetzt, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Diana sprang wie ein Irrwisch zwischen ihnen herum.
Jörn sah mich und schrie: „Schnell, komm mit zur Südweide, wir müssen die Jährlinge holen! Das gibt einen höllischen Sturm. Vielleicht hagelt es auch, und wir haben zu wenig Unterstände!“
Matty und Sepp hatten alle Mühe, die Stuten davon abzuhalten, in panischer Flucht durchzugehen. In ihr schrilles Gewieher mischte sich das erste Donnergrollen. Ich sah Isabell, wie sie mit bebenden Nüstern und weit aufgerissenen Augen hinter den anderen Stuten her galoppierte, und Odin folgte ihr, so rasch er auf seinen dünnen, noch ungeschickten Beinen laufen konnte.
Noch während Jörn und ich die Jährlinge durch das Gatter und über den Seitenpfad trieben, brach das Unwetter los. Blitze zuckten wie in einem Gruselkrimi über den Himmel, und der Donner krachte so ohrenbetäubend, daß ich fürchtete, die Pferde könnten vor Schreck den Verstand verlieren und über alle Berge verschwinden.
Zum Glück hatten sie keinen anderen Gedanken als den, in ihren Stall zu kommen, und rasten auf dem vertrauten Weg voraus. Jörn und ich liefen keuchend hinterher.
Als wir die Toreinfahrt erreichten, brach der Regen los. Eine wahre Sturzflut prasselte über uns herein. Doch die Jährlinge waren schon vor dem Stalltor, und wir sahen durch die Regenschwaden, daß Matty sie hereinholte.
Es waren keine fünfzig Schritte mehr bis zum Stall. Trotzdem wurden wir bis auf die Haut naß, ehe wir unter das schützende Dach kamen. Im Stall herrschte noch immer Aufruhr. Ein Teil der Pferde drängte sich auf der Stallgasse, ungeduldig, in die Boxen zu kommen. Das Krachen des Donners und das Brausen der Regenfluten wurde von schrillem Gewieher und dem Trampeln und Scharren der Pferdehufe übertönt.
Hinter den Stallfenstern zuckten fast ununterbrochen Blitze auf. Dann trommelten plötzlich harte Geschosse wie Schrotkörner gegen das Glas – es hagelte, was das Zeug hielt. Wir hatten den Stall gerade noch rechtzeitig erreicht.
Im Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit sah ich verängstigte Pferdeaugen schimmern. Ich führte Faun, einen der Jährlinge, zu seiner Box. Als ich mit ihm durch die Stallgasse kam, bemerkte ich im Licht eines aufzukkenden Blitzes eine gebeugte Gestalt auf Krücken gestützt zwischen den Säulen. Es war Herr Moberg.
Sein Blick streifte mich flüchtig. Dann hob er eine seiner Krücken und schrie: „Jörn, zu Ask, schnell! Er bricht sich sonst noch ein Bein!“
Der Hengst stand auf den Hinterbeinen in seiner Box und schlug mit den Vorderhufen gegen die Bretterwand, daß es nur so knallte. Er schien vor Schreck über das Unwetter ganz von Sinnen zu sein. Jörn rannte zu ihm, aber ich konnte nicht sehen, was er tat, um Ask zu beruhigen. Ich hatte plötzlich selbst alle Hände voll mit dem aufgeregten Faun zu tun, der nun auch die Nerven verlor und sich wie ein Wildpferd aufbäumte.
Glücklicherweise kam mir Matty zu Hilfe. Eine Viertelstunde später war es wieder ruhig im Stall. Die Pferde waren damit beschäftigt, ihr Abendheu zu fressen, die Blitze und das Donnergetöse hatten nachgelassen, und der Hagelschauer war vorüber. Dafür regnete es wieder in Strömen. Ich fröstelte in meinen nassen Kleidern. Das Wasser tropfte mir noch immer aus den Haaren ins Gesicht und in den Hemdkragen, und meine nackten Beine waren bis an die Knie voller Pferdemist.
Wie eine nasse Katze stand ich in der Stallgasse, während Herr Moberg mit Hilfe seiner Krücken zur Tür hinkte. Jörn warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu und folgte ihm.
Nur Matty blieb noch einen Augenblick neben mir stehen und flüsterte: „Jetzt ist es soweit, Nell. Halt uns die Daumen! Willst du hier warten? Dann zieh aber das nasse Zeug aus. In der Sattelkammer liegen ein paar alte Sachen von mir, die kannst du nehmen.“
Mein Herz sank. Ich sagte gar nichts, nickte nur und sah ihm nach, wie er aus dem Stall ging. Jetzt, wo die Anspannung und die Aufregung wegen des Unwetters vorüber waren, fühlte ich mich seltsam leer.
Ich wartete, bis Sepp und Schorsch den Stall verließen. Dann ging ich in die Sattelkammer. Draußen war es nicht mehr ganz so finster wie vorher. Im Zwielicht zog ich meine nassen Sachen aus und schlüpfte in Mattys alte Shorts und sein kariertes Hemd, das er oft bei der Stallarbeit trug. Dann kauerte ich eine Weile auf der Bank zwischen den Satteldecken, die Hände im Schoß. Ich atmete den Duft von Leder und Sattelseife ein, sah auf die Kardätschen, Wasserbürsten, Schwämme und Hufreiniger in den Regalen, die gerahmten Urkunden, die Zaumzeuge, die alten Truhen und Stallkisten und die Sättel, die unter den Namensschildern der Pferde an den Wänden hingen.
Vielleicht, dachte ich, werden bald all diese Namensschilder verschwinden; alle bis auf drei oder vier. Und die seltsame Leere in meinem Innern wich einer Mischung aus angstvoller Spannung und Traurigkeit.
Ich mochte nicht länger im Halbdunkel sitzen. Jörn und Matty redeten wohl gerade in diesem Augenblick mit ihrem Vater. Vielleicht war die Entscheidung aber auch schon gefallen.
Voller Unruhe stand ich auf und ging in den Stall zurück. Die Pferde standen friedlich in ihren Boxen und dösten, während draußen der Regen plätscherte und rauschte. Isabell säugte ihr Fohlen, Faun knabberte am Hals eines anderen Jährlings, der in der benachbarten Box stand, und Hazel streckte den Kopf weit über die Halbtür zu mir herüber und schnaubte leise.
Ich blieb bei ihr stehen und sah sie an. Sie hatte so sanfte, milde Augen, und ich war fast sicher, daß sie meine Unruhe und Angst spürte. Es war wie damals im Frühling, als ich Abschied genommen hatte. Auch damals war sie zu mir gekommen – oder ich zu ihr, wer weiß das so genau? – wie zu einem Freund, der Trost braucht.
Ich legte die Arme um ihren Hals, und wir sahen uns an, lange. Dann hörte ich, wie sich die Stalltür öffnete. Ich dachte, es wäre Sepp oder Schorsch, doch als ich den Kopf hob, sah ich Matty durch die Tür kommen.
Es war nicht hell genug, um den Ausdruck auf seinem Gesicht zu erkennen. Sekundenlang sagte keiner von uns ein Wort. Dann kam er zu mir, triefend vor Nässe, und setzte sich auf den Rand eines Futtertroges.
Ich brauchte ihm keine Fragen zu stellen. Die Haltung seines Kopfes und seiner Schultern sagte mir genug. Jetzt sah ich auch seine Augen. Sie hatten nichts erreicht. Unser Plan war fehlgeschlagen.
Leise sagte er: „Ich hab’s nicht mehr ausgehalten. Jörn ist noch bei ihm. Er gibt nicht so schnell auf.“
„Aber was hat dein Vater gesagt?“ fragte ich verzweifelt. „Er muß doch begreifen, daß es eine Chance ist, die Pferde zu behalten!“
„Er hatte tausend Einwände, Ich glaube, er hat einfach Angst vor einem weiteren Fehlschlag. Jörn denkt wohl, er könnte ihn doch noch überreden.“ Und Matty wiederholte: „Er gibt nicht so schnell auf.“
Jörn . . . Jetzt hing alles von ihm ab. Er war älter als Matty; vielleicht hörte sein Vater auf ihn. Plötzlich ertappte ich mich dabei, daß ich Herrn Moberg richtig haßte – ihn und die Macht, die er über die Pferde hatte und damit auch über uns. Und doch war auch er nicht frei in seinen Entscheidungen. Er war abhängig von Gewinn und Verlust, mußte eine Familie ernähren, Angestellte bezahlen, seinen Hof erhalten.
Ich setzte mich neben Matty auf den Futtertrog. Stumm warteten wir. Die Pferde schnaubten leise, und die Schtwalben flogen wieder durch die halboffene Klappe eines Stallfensters aus und ein.
Dann scharrte etwas an der Tür. Matty hob den Kopf, lauschte und sagte: „Diana.“
Die Jagdhündin stand vor dem Stall. Das bedeutete, daß auch Jörn nicht weit sein konnte, denn sie hielt sich ja meistens in seiner Nähe auf. Ich sprang auf, lief zur Tür und öffnete sie; da sprang Diana kurz an mir hoch. Dann lief sie zu Matty.
Ich trat über die Schwelle in den Regen hinaus und hielt nach Jörn Ausschau. Vom Torbogen her erklangen Schritte. Ich wandte den Kopf nach rechts. Jörn bog um den Mauervorsprung.
Er sah mich im gleichen Augenblick wie ich ihn. Sein Gesicht verriet mir, was ich wissen wollte. Ich lief ihm entgegen, und er lief auf mich zu. Plötzlich hielten wir uns in den Armen; ich wußte selbst nicht, wie es geschah. Ich lachte und weinte gleichzeitig, und Jörn küßte mich mitten im strömenden Regen wild auf die Stirn, die Nasenspitze, die Wangen und den Mund.
„Wir haben’s geschafft!“ schrie er zwischen den Küssen. „Herrgott, wir haben’s geschafft, Nell!“
Und er hob mich hoch und schwenkte mich durch die Luft. Wir waren beide naß bis auf die Haut, und plötzlich tauchte auch Matty auf. Er rief laut: „Er hat ja gesagt, Jörn – wirklich? Hat er wirklich ja gesagt?“
Jörn stellte mich ab. Einen Augenblick lang sahen wir uns atemlos und ein wenig verlegen an. Dann erwiderte er keuchend: „Ja, er sagt, er will’s versuchen. Ein halbes Jahr lang will er versuchen, ob sich so eine Reitschule lohnt. Aber er hat Bedingungen gestellt – daß wir ihm helfen und jemanden finden, der Reitunterricht geben kann und nicht allzuviel dafür haben will. Er hat auch verlangt, daß wir Reitschüler bringen und ihm Arbeit abnehmen, so viel wir können. Das alles hab ich ihm versprochen.“
„Das macht nichts!“ sagte Matty. Der Regen lief über sein strahlendes Gesicht. „Das macht alles nichts, wir werden’s schon schaffen. Wenn wir nur die Pferde behalten können!“
Ich sagte gar nichts. Ich war ganz einfach glücklich.