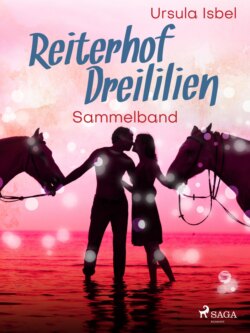Читать книгу Reiterhof Dreililien Sammelband - Ursula Isbel - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAbends erwähnte ich nichts davon, daß ich Jörn und Matty kennengelernt hatte und im Stall von Dreililien gewesen war, obwohl mein Vater mehrmals fragte, wie ich denn den Tag verbracht hätte. Kirsty stellte überhaupt keine Fragen. Sie verhielt sich zurückhaltend, war dabei aber doch freundlich zu mir. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte sich abscheulich benommen und mir damit einen weiteren Grund gegeben, sie nicht zu mögen.
Sie versuchte jedenfalls nicht, sich anzubiedern, und Vater war so glücklich, daß ihm nicht einmal mein mürrisches, abweisendes Verhalten etwas auszumachen schien. Er hatte selbst gekocht – ein indonesisches Gericht mit unaussprechlichem Namen, der Teufel mochte wissen, woher er die Gewürze hatte! – und strahlte, als er sah, daß es Kirsty schmeckte. Im Ofen prasselten die Holzscheite, die sie zusammen aus dem Wald geholt hatten, und hinter den Fenstern schwankten die kahlen Äste der Eiche im Abendwind. Herr Alois lag auf dem Teppich vor dem Ofen, die Schnauze auf den Vorderpfoten, und schnarchte leise.
Nach einer Weile holte Kirsty ihre Gitarre, die sie mitgebracht hatte. Sie setzte sich neben meinen Vater auf die Eckbank und begann eine Melodie zu spielen, die ich nicht kannte.
Vater ließ sie nicht aus den Augen; er sah sie an wie ein Wesen von einem anderen Stern. Da hatte ich genug. Ich stand auf, murmelte etwas und ging ins Mansardenzimmer hinauf.
In dem Räum mit den schrägen Wänden war es kalt. Die Fensterflügel standen noch weit offen. Ich lehnte mich mit den Armen aufs Fensterbrett und sah in die Dunkelheit. Ein paar Lichtpunkte zeigten an, wo Dreililien war. Ein Ast ächzte leise und klagend. Der Mond stand über dem Wald, und der Wind trüg den Geruch von Stall und Pferden zu mir herüber.
Ich dachte, daß ich hier, wo ich es am wenigsten erwartet hatte, zwei Menschen kennengelernt hatte, die mich interessierten und die ich gern zu Freunden gehabt hätte. Dafür habe ich meinen Vater verloren! ging es mir durch den Sinn, und ein bitteres Gefühl stieg in mir auf.
Ich mochte nicht länger am Fenster stehen. Schaudernd zog ich mich aus und kroch unter die Bettdecke. Eine Weile lag ich da und zitterte, doch nicht nur vor Kälte. Ich versuchte einzuschlafen, aber es ging nicht. Ich versuchte an etwas Angenehmes zu denken – daran, daß ich morgen mit Jörn und Matty im Stall arbeiten würde, daß ich hier vielleicht sogar anfangen konnte, reiten zu lernen; doch es nützte nichts. Ich war traurig, und nichts konnte mich darüber hinwegtäuschen, daß ich allein war, und daß mein Vater mit Kirsty dort unten in der Küche saß und vor Glück und Verliebtheit fast platzte.
Zwei Stunden später lag ich noch immer wach. Meine Füße waren wie Eisklötze. Ich dachte sehnsüchtig an meine Mutter, die mir heiße Milch und Honig gebracht hatte, wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte.
In der Küche war noch ein Rest Milch vom Frühstück, Honig hatten wir von zu Hause mitgebracht. Ich stand auf, schlüpfte in den Morgenmantel, zündete die Kerze an und nahm sie mit ins Treppenhaus.
Ich nahm fest an, daß Vater und Kirsty längst zu Bett gegangen waren; als ich jedoch in die Nähe der Küche kam, drang Lichtschimmer durch die Türritzen, und ich hörte gedämpfte Stimmen.
Unwillkürlich blieb ich stehen. Ich hatte keine Lust, in die Küche zu gehen, wie ein Kind nach heißer Milch mit Honig zu verlangen und zuzugeben, daß ich nicht schlafen konnte. Schon wollte ich wieder umkehren, da hörte ich ganz deutlich die Stimme meines Vaters: „ . . . daß Elinor dir gegenüber so unfreundlich ist!“
Die erste Hälfte des Satzes hatte ich nicht verstanden, aber ich konnte mir denken, daß er sich für mich entschuldigte.
Ich hielt mitten in der Bewegung inne. Eigentlich wollte ich nicht lauschen; ich verachte neugierige Leute. Diesmal aber mußte ich einfach bleiben und wissen, was sie sagten. Irgend etwas zwang mich, ihre Unterhaltung mit anzuhören.
„Laß nur, ich verstehe sie“, erwiderte Kirstys helle, ein wenig brüchige Stimme.
Sie verstand mich . . . Wenn ich das schon hörte! Ich wollte ihr Verständnis nicht, es konnte mir gestohlen bleiben!
„Ich bin doch ein Eindringling für sie“, fuhr sie fort. „Sie denkt, daß ich dich ihr wegnehme. Und irgendwie ist es ja auch wirklich so.“ Sie stockte. „Es ist sehr schwer, zu teilen, wenn man nur einen Menschen auf der Welt hat, zu dem man gehört.“
Mein Vater erwiderte aufgebracht: „Aber ich kann doch ihretwegen nicht meine besten Jahre wie ein Einsiedler verbringen! In ein paar Jahren wird sie vielleicht schon aus dem Haus gehen und ihr eigenes Leben führen. Ich habe doch auch ein Recht auf ein bißchen Glück und Zärtlichkeit! Warum gönnt sie es mir nicht, daß ich glücklich bin? Sie müßte froh sein, daß ich eine Frau wie dich gefunden habe.“
Ich wagte kaum zu atmen. So also sah er die Sache; das war sein Standpunkt. Ein Teil von mir begriff, daß er recht hatte, aber die Bitterkeit und das Gefühl von Zurücksetzung blieben. Vater brauchte eine Frau, um glücklich zu sein. Er brauchte Kirsty.
Kirsty sagte sanft: „Natürlich hast du ein Recht darauf, Richard. Aber die Sache hat zwei Seiten, und für deine Tochter sieht alles ganz anders aus. Ich habe es doch selbst erlebt, wenn auch umgekehrt. Ich lebte bei meiner Mutter, und als sie Jahre nach ihrer Scheidung wieder eine Beziehung zu einem Mann aufnahm, fühlte ich mich zurüekgestoßen und vernachlässigt. Es war eine bittere Erfahrung, die mir jahrelang schwer zu schaffen gemacht hat. Deshalb verstehe ich Elinor so gut.“
Erst jetzt merkte ich, daß heißes Wachs auf meine Hand tropfte, weil ich die Kerze schief hielt. Leise drehte ich mich um und ging wieder die Treppe hinauf. Ich hatte genug gehört. Mein eigener Vater war gegen mich, und die Frau, die ich für meine Feindin hielt, verteidigte mich noch. So erschien es mir jedenfalls in dieser Nacht.
Kirstys Lebensgeschichte interessierte mich nicht weiter. Ich wollte ihr Verständnis und Mitgefühl nicht. Alles, was ich wollte, war, daß sie meinen Vater in Ruhe ließ, damit wir wieder leben konnten wie zuvor. Doch zugleich wußte ich auch, daß es nie wieder so werden konnte wie früher.
Gegen Mitternacht schlief ich dann doch ein, und als ich in der Morgendämmerung erwachte, sah alles nicht mehr ganz so schlimm aus. Zwar war ich Vater und Kirsty gegenüber keinen Deut versöhnlicher gestimmt, doch ich war fest entschlossen, in Zukunft meine eigenen Wege zu gehen.
Diesen Vorsatz führte ich auch sofort aus, indem ich früher als sonst aufstand, um ins Dorf zu gehen. Im Haus war alles still, und in der Küche waren noch die Vorhänge zugezogen. Ich schrieb auf einen Zettel Bin gegen Mittag zurück, legte ihn auf den Tisch, nahm meine Jacke vom Garderobenhaken und verließ das Haus.
Der Himmel war milchig blau mit einem Schleier von Dunst, doch aus den Wiesen stieg Feuchtigkeit auf, und ich fröstelte in der kalten Morgenluft. Meine Ballerinaschuhe mit den dünnen Sohlen waren nicht gerade die passende Fußbekleidung für einen ländlichen Spaziergang. Ich spürte jeden Stein auf der unbefestigten Straße, und als ich versuchte, im Gras zu gehen, war das dünne Leder im Nu durchnäßt.
Der Weg zum Dorf, der mir mit dem Auto so kurz erschienen war, zog sich endlos lange hin. Als ich nach mehr als einer Dreiviertelstunde den Hügel mit der Dorfkirche in der Ferne auftauchen sah, war ich erleichtert. Kühe starrten mich über einen Weidenzaun hinweg mit friedlicher Neugier an, und ein stattlicher Misthaufen war der erste Vorbote des Dorfes. Eine Schar Hühner kratzte gackernd darauf herum, ein alter Bauer arbeitete in einem Gemüsegarten hinter einem Holzhaus und musterte mich prüfend, und über die Dorfstraße kurvten Kinder mit ihren Fahrrädern.
Ich ging in den Lebensmittelladen, kaufte Milch, Semmeln, ein Stück Käse und zwei Äpfel und setzte mich auf eine Bank am Fuß des Kirchbergs. Dort frühstückte ich in der Morgensonne. Eine Katze saß nicht weit von mir auf einem Zaunpfosten, kniff die Augen zusammen und sonnte sich wie ich, und im Gras unter den Fliederbüschen blühten die ersten Veilchen.
Vom Kirchturm schlug es neun, als ich schließlich aufstand und durchs Dorf ging. Allzu viel gab es da nicht zu sehen – ein großes Haus mit grüngestrichenem Spalier, das offenbar die Schule war, der Pfarrhof am Kirchberg, neben der Dorfstraße ein Wirtshaus mit Kastanien, die gerade erst ausschlugen, den Lebensmittelladen, eine alte Schmiede und ein paar Dutzend Häuser mit Holzbalkons, dazu Gärten, eine Ferienpension, eine Tankstelle und daneben eine Bushaltestelle. Das war alles.
Kein Kino, keine Disco, kein Schallplattenladen und keine Boutique. Nichts. Ich dachte: Wie halten es die Leute hier nur aus?
Die Menschen, die mir begegneten, musterten mich neugierig. Vermutlich waren Fremde um diese Jahreszeit eine Seltenheit. Schließlich hatte ich mir das ganze Dorf angesehen, und es war gerade erst zehn. Ich hatte überhaupt keine Lust, schon wieder zurückzugehen, aber etwas anderes fiel mir nicht ein; und mit Matty und Jörn hatte ich mich erst für fünf Uhr nachmittags verabredet.
Langsam und lustlos schlenderte ich den Weg zurück, den ich gekommen war. Als ich das letzte Bauernhaus des Dorfes hinter mir gelassen hatte und auf die Straße abbog, die am Wildbach entlang nach Dreililien führte, sah ich in der Ferne zwischen den Bäumen einen Reiter kommen.
Es war Matty. Als er mich bemerkte, lenkte er sein Pferd auf mich zu und brachte es kurz vor mir zum Halten. Ich zwang mich, stehenzubleiben und nicht zurückzuweichen, obwohl das haselnußbraune Pferd einfach riesenhaft wirkte.
„Hallo!“ sagte Matty atemlos.
„Hallo“, erwiderte ich. „Reitest du spazieren?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, ich muß ins Dorf und dem Hufschmied Bescheid sagen, daß er heute vorbeikommen soll. Emily hat ein Hufeisen verloren.“
„Hat er denn kein Telefon?“ fragte ich erstaunt.
Matty sah mich ebenso erstaunt an. „Nein, warum denn? Ohne geht’s doch auch! Aber du kommst natürlich aus der Stadt, da denkt man wohl, ohne Telefon geht die Welt unter!“
„Quatsch“, sagte ich etwas gereizt. „Aber praktisch ist es, das wirst du wohl zugeben?“
Er sagte friedlich: „Ja, schon. Hör mal, Nell, ich bin in spätestens zehn Minuten wieder da. Wenn du auf mich wartest, können wir gemeinsam zurückreiten.“
„Reiten?“ wiederholte ich und sah zweifelnd auf das große Pferd. „Ich weiß nicht recht. Wahrscheinlich komme ich gar nicht erst rauf, und überhaupt . . .“
Matty lachte. „Hochstemmen kann ich dich schon“, sagte er. „Aber wir müssen ja nicht unbedingt reiten. Zwei Leute wären sowieso zu viel für Hazel. Sie hat nämlich etwas schwache Fesselgelenke.“
Hazel senkte den Kopf, als hätte sie verstanden, was Matty gesagt hatte, streckte die Nase vor und schnupperte an meinen Haaren. Ich blieb ganz still stehen und ließ es über mich ergehen, doch mein Herz klopfte schneller als sonst.
„Keine Angst“, sagte Matty. „Hazel hat noch keiner Seele was zuleide getan.“
Die Stute blies in mein Haar, und ich atmete den herben, aber angenehmen Pferdegeruch ein. Dann zog sie den Kopf zurück und sah mich mit ihren sanften braunen Augen aufmerksam an.
„Wir können ja zusammen zurückgehen“, schlug Matty vor. „Hazel ist froh, wenn sie niemanden auf ihrem Rücken herumschleppen muß, was, Hazel?“
Die Stute schnaubte leise und schüttelte ungeduldig den Kopf, um ein paar Fliegen zu verscheuchen. Ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück und sagte: „Also, dann warte ich auf dich.“
„Prima.“ Matty lenkte Hazel zur Mitte der Straße, und sie trabte in Richtung zum Dorf davon. Während ich den beiden nachsah, dachte ich, daß Matty ein netter Kerl war, netter als alle Jungen in meiner Klasse; auch wenn er noch ziemlich jung war und nicht so gut aussah wie sein Bruder.
Nach etwa zehn Minuten war er wirklich wieder da, schwang sich aus dem Sattel und ließ Hazel auf der Wiese frei. Sie trottete mit schleifenden Zügeln neben uns her, graste ab und zu zufrieden und sah immer wieder zu uns herüber, als wollte sie sich vergewissern, ob Matty noch da war.
„Hazel ist so anhänglich“, erklärte Matty. „Ich habe sie selbst zugeritten. Sie war immer schon lammfromm und hat mich nie abgeworfen.“
„Werdet ihr sie eines Tages verkaufen?“ fragte ich.
Sein Gesicht wirkte plötzlich verschlossen. „Ich weiß nicht“, sagte er. „Das liegt bei meinem Vater. Die Pferde gehören ja alle ihm.“
Ich sah ihn von der Seite an. Eine Weile schwiegen wir. Dann fragte ich vorsichtig: „Verstehst du dich nicht gut mit deinem Vater?“
„Ach, er ist ziemlich schwierig. Aber ich kann’s ihm wohl nicht vorwerfen.“
Ich merkte, daß er im Augenblick nicht mehr darüber sagen wollte, und stellte keine weiteren Fragen. Dann dachte ich, daß ich wirklich einmal gern jemanden kennengelernt hätte, der keine Schwierigkeiten mit seinem Vater oder seiner Mutter oder mit beiden Eltern hatte. Abgesehen von Erwachsenen natürlich, aber selbst die schienen oft noch Probleme mit ihren Eltern zu haben. Ich hatte geglaubt, eine rühmliche Ausnahme zu sein, denn bisher hatte ich mich gut mit meinem Vater verstanden und war stolz darauf gewesen, daß wir so gute Freunde waren. Doch das war jetzt wohl ein für allemal vorbei . . .
„Zum Teufel!“ sagte ich unwillkürlich.
Matty nickte, als wüßte er, in welche Richtung meine Gedanken gingen. „Man müßte erwachsen und unabhängig sein“, sagte er bitter.
„Wenn man erwachsen ist, ist man deswegen noch lange nicht unabhängig“, erwiderte ich.
Matty lachte, aber besonders froh wirkte er nicht dabei. „Das klingt verdammt weise“, sagte er. „Aber du hast schon recht. Um unabhängig zu sein, braucht man Geld.“
Ich murmelte: „Ja, Geld – wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich sofort verschwinden. Nach Amsterdam vielleicht, das ist eine wunderbare Stadt.“
„Oh, ich würde schon hierbleiben“, erwiderte Matty. „Ich würde meinem Vater das Gut und die Pferde abkaufen. Dann könnten sie frei leben und hätten es gut bei mir.“
„Haben sie es denn nicht gut bei deinem Vater?“
„Er behandelt sie nicht schlecht, das ist es nicht. Er hängt zwar auch an ihnen, aber ich glaube, er liebt sie nicht so wie Jörn und ich. Für ihn sind sie mehr eine Art Ware, weißt du, die man möglichst gewinnbringend verkauft. Etwas, das man abstoßen muß, wenn es sich nicht mehr rentiert.“
Der Weg führte nun wieder dicht am Wildbach vorbei, und wir warteten, während Hazel an eine seichte Uferstelle ging, sich vorsichtig einen Weg zwischen dem Geröll bahnte und von dem klaren Wasser trank. Es war ein schönes Bild, fast wie ein Gemälde – die haselnußbraune Stute am Bach, die Sonne auf dem Wasser und im Hintergrund die Felsen zwischen den Tannen.
„Rentiert es sich denn?“ fragte ich.
Matty schwieg eine Weile. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich wieder zum Gehen. Ich folgte ihm. Hinter uns erklang das leichte Getrappel von Hazels Hufen auf dem steinigen Pfad.
„Eben nicht“, sagte er nach einiger Zeit. „Es lohnt sich nicht. Deshalb überlegt Vater ja auch immer wieder, ob er die Pferde und vielleicht auch einen Teil unseres Grundstücks verkaufen soll. Er sagt, dann könnten wir bequem und sorgenfrei leben.“
Er schwieg wieder und senkte den Kopf. Die Sache war schlimm für ihn, das spürte ich. „Und deine Mutter? Was sagt sie dazu?“
„Meine Mutter? Die hat keine eigene Meinung“, erwiderte er. „Von ihr kann man keine Unterstützung erwarten. Ich glaube, sie hat Angst vor Vater.“
Matty vergrub die Hände in den Hosentaschen und ging rascher vorwärts. Ich müßte mich beeilen, um ihn einzuholen. Nach einigen Minuten sagte er fast schroff: „Aber was kümmert dich das? Du hast sicher andere Sorgen. Ich will dir nicht die Ohren volljammern.“
„Du jammerst mir nicht die Ohren voll“, sagte ich. „Manchmal tut’s einem gut, wenn man jemandem etwas erzählen kann, den man kaum kennt – einem Außenstehenden, meine ich. Und das bin ich ja auch – eine Außenstehende.“
Und voller Bitterkeit dachte ich, daß das wirklich stimmte. Ich war eine Außenstehende. Das war gegenwärtig genau meine Stellung in der Welt.
Matty nickte und sagte: „Vielleicht hast du recht. Aber dann kannst du mir doch eigentlich auch von dir erzählen. Für dich bin ich schließlich auch ein Außenstehender, wie du das nennst.“
„Ich weiß nicht“, erwiderte ich zögernd. „Immerhin kennst du Kirsty.“
„Und du meinst, deshalb wäre ich voreingenommen?“
„Vielleicht“, sagte ich.
„Kirsty ist in Ordnung“, sagte Matty. „Aber so gut kenne ich sie gar nicht, wie du vielleicht glaubst. Bei ihrer Tante Karen sind wir oft gewesen, als wir noch Kinder waren. Sie hat da ziemlich allein gelebt, aber es war ihr offenbar ganz recht so.“ Er sah mich von der Seite an. „Und Kirsty . . . kommst du nicht gut mit ihr aus?“
„Ich mag sie nicht“, sagte ich heftig.
Matty nickte wieder. „Sind deine Eltern geschieden?“
„Nein“, sagte ich kurz. „Meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben.“
„Oh!“ Er fragte: „Und jetzt hat dein Vater Kirsty kennengelernt? Glaubst du, daß die beiden heiraten werden?“
„Vielleicht“, sagte ich. „Meinetwegen sollen sie es tun. Sie können machen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht.“
Matty murmelte: „Das glaube ich dir nicht.“
Ich wurde plötzlich richtig wütend. „Es ist aber so!“ herrschte ich ihn an. „Was weißt du schon von mir? Ich brauche niemanden, ich komme ganz gut allein zurecht.“ Ich stockte, weil ich merkte, wie meine Stimme zitterte. Meine Kehle verengte sich und schmerzte von der Anstrengung, die Tränen zurückzuhalten. Ich wandte das Gesicht ab, damit Matty meine Augen nicht sah.
Er blieb stehen und sagte sanft: „Unsinn, das stimmt doch gar nicht! Keiner kommt allein zurecht. Warum gibst du nicht einfach zu, daß es dir weh tut? Du hast Angst, deinen Vater zu verlieren, stimmt’s? Du fürchtest, daß Kirsty ihn dir wegnehmen könnte.“
Ich kämpfte um meine Fassung, Matty war nett, aber ich kannte ihn kaum. Er durfte nicht sehen, wie elend und hilflos ich mich fühlte. Ich wollte um keinen Preis vor ihm weinen. Warum hatte ich mich nur auf dieses Gespräch eingelassen?
Verbissen ging ich weiter, die Augen blind vor Tränen, das Gesicht dem Wald zugekehrt. Ich schluckte und schluckte und hielt die Tränen mit aller Macht zurück. Dabei hörte ich Mattys Schritte dicht hinter mir, und dazwischen das gedämpfte Geklapper von Pferdehufen.
Plötzlich hielt ich es nicht länger aus. Ich setzte mich auf einen gefällten Baumstamm, der am Waldrand lag, und sagte mit erstickter Stimme: „Sei nicht böse, aber ich möchte jetzt allein sein. Bitte, geh ohne mich weiter!“
Matty zögerte eine Weile. „Gut“, sagte er dann, „wenn du das wirklich möchtest, reite ich eben nach Hause. Vielleicht reden wir ein andermal darüber. Aber du kommst doch heute noch zu uns in den Stall, wie wir’s ausgemacht haben?“
Ich sah ihn nicht an, nickte nur und fuhr mir mit dem Handrücken über die Nase. Da wandte er sich ab und rief nach Hazel.
Verschwommen sah ich aus den Augenwinkeln, wie die Stute angetrabt kam, und wie Matty sich in den Sattel schwang. Dann hörte ich die beiden davonreiten. Der Kies knirschte unter den Pferdehufen; laut zuerst, dann immer leiser, bis das Geräusch schließlich verklang.
Ich blieb allein zurück. Die Vögel sangen. Jetzt, wo ich hätte weinen können, weil niemand mich sah, konnte ich es nicht mehr. Meine Augen brannten, und ein dumpfes, quälendes Gefühl saß in meiner Brust. Ich war wieder allein, denn ich hatte Matty weggeschickt.