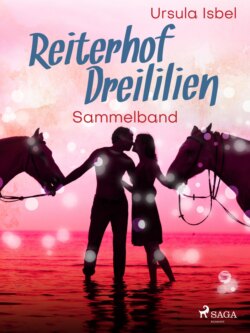Читать книгу Reiterhof Dreililien Sammelband - Ursula Isbel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
17
ОглавлениеWie der Tierarzt sagte, hatten wir das Richtige getan. Er gab Herrn Alois noch eine Spritze, um sein geschwächtes Herz zu stärken, und meinte dann, jetzt könne man nur noch abwarten, ob die robuste Natur des Hundes den Sieg über das Gift davontrug. Er versprach, am Nachmittag noch einmal hereinzuschauen, und ließ sich von Vater wieder nach Hause fahren.
Da es nichts mehr zu tun gab, ging ich in mein Zimmer. Kirsty blieb bei ihrem Hund und hielt für den Rest der Nacht Wache. Ich war todmüde, aber hellwach, lag im Bett, hörte, wie mein Vater einige Zeit später zurückkam, sah, wie hinter den Fenstern die Dämmerung hereinbrach und hörte das erste Zwitschern der Schwalben im Morgengrauen.
Erst als es schon hell war, schlief ich ein und wurde von unruhigen Träumen geplagt. Ein Klopfen an der Tür weckte mich schließlich.
Ich schreckte hoch; da stand mein Vater im Türrahmen, ein Tablett in den Händen, und sagte: „Ich bringe dir dein Frühstück.“
Einen Augenblick lang sah ich ihn verwirrt an. Dann fiel mir plötzlich alles wieder ein, und ich fragte: „Wie geht es ihm? Ist er . . . lebt er noch?“
„Herrn Alois geht’s besser“, erwiderte Vater. „Er schläft die ganze Zeit, aber Kirsty meint, daß er das Schlimmste überstanden hat. Sie hofft, daß er sich gesund schläft.“
Zum erstenmal weckte es keine Wut oder Eifersucht in mir, ihren Namen aus seinem Mund zu hören. Ich richtete mich schlaftrunken auf, und er kam ans Bett und stellte das Tablett etwas ungeschickt auf meine Bettdecke.
„Hier“, sagte er. „Kaffee und frische Sahne und aufgebackene Semmeln mit Marmelade und Honig.“
Als ich das Frühstück sah, merkte ich erst, wie hungrig ich war. „Wie spät ist es?“ fragte ich und griff nach der Kaffeetasse.
„Zehn Uhr“, sagte Vater und blieb mit hängenden Armen vor meinem Bett stehen. „Aber bleib ruhig noch eine Weile liegen, das war eine anstrengende Nacht.“
Ich warf einen Blick zum Fenster. Draußen war es trüb – der erste trübe Tag seit unserem Einzug im Kavalierhäusl. Ein richtiger Tag zum Faulenzen; doch ich wollte zu Jörn und Matty, um ihnen alles zu erzählen und mit den Pferden zu helfen. Außerdem sollte ich ja jetzt täglich eine Reitstunde bekommen . . .
Ich biß in die Marmeladensemmel, und mein Vater ging zur Tür. Mit vollem Mund sagte ich: „Danke fürs Frühstück, Paps.“ So hatte ich ihn lange nicht mehr genannt.
Er drehte sich zu mir um, Sein Gesicht strahlte so, daß mir richtig warm ums Herz wurde. Ich konnte mir plötzlich vorstellen, wie er als kleiner Junge ausgesehen hatte. „Für das Frühstück?“ sagte er. „Das war doch weiter nichts. Aber dank dir, Elinor – du weißt schon, wofür.“
„Ist schon in Ordnung“, sagte ich.
Herr Alois schlief noch immer, als ich etwas später in die Küche kam, doch er atmete regelmäßiger, und sein Körper wirkte entspannt. Kirsty saß mit dem Strickzeug im Schaukelstuhl, lächelte mir entgegen und sagte: „Ich glaube, wir haben’s geschafft, Nell.“
Sie nannte mich nicht mehr Elinor wie mein Vater, sondern gebrauchte den Namen, den Matty für mich gefunden hatte. Ich merkte, daß ich sie plötzlich mit ganz neuen Augen betrachtete. Erst jetzt konnte ich sehen, daß ihr Gesicht weich war und ihre Augen sanft, und daß mir die Art, wie sie sich kleidete, gefiel – die braune Pluderhose und dazu die bestickte Trachtenjacke, die an den Ellbogen schon ein wenig durchgescheuert war.
Eine Art geheimes Einverständnis schien zwischen uns zu bestehen; so, als hätten die gemeinsamen Bemühungen um den todkranken Hund uns verbunden. Doch das alles war so ungreifbar, daß ich es nicht aussprechen konnte oder wollte. Ich konnte nur hoffen, daß Kirsty das gleiche empfand wie ich.
Ich räumte das Tablett ab und spülte meine Tasse und die Teller. Im Schuppen rumorte es; offenbar arbeitete Vater wieder an der Töpferwerkstatt. Das Geräusch ärgerte mich plötzlich nicht mehr, ebensowenig wie das Klappern von Kirstys Stricknadeln. Im Gegenteil, jetzt fand ich beides anheimelnd, und das Haus erschien mir freundlich und friedlich mit den tiefblauen Klematissternen vor dem Küchenfenster, den Malven, die im Garten blühten, und Kirstys Topfpflanzen auf dem Fenstersims.
Obwohl die Sonne nicht schien und das Tal im Schatten lag, war es doch schön im Freien. Eine kleine Gruppe von Pferden stand am Koppelzaun, als ich den Pfad entlang ging, der zur Wegkreuzung führte. Ich blieb stehen, verteilte die Karotten, die ich eingesteckt hatte, und sah Isabell und ihrem Fohlen eine Weile zu.
Auf dem Dreililienhof war es merkwürdig still, als ich zur Toreinfahrt kam. Weder Matty noch Jörn waren zu sehen. Im Stall war nur Schorsch und besserte einen Riß in einem Futtertrog aus.
Er sah so mürrisch drein und antwortete kaum auf meinen Gruß, daß ich ihn nicht fragen wollte, wo die beiden waren. Ich ging zur Südweide, wo die einjährigen Fohlen grasten, doch auch da waren Matty und Jörn nicht.
Ins Haus wagte ich mich noch immer nicht. Unschlüssig kehrte ich zur Toreinfahrt zurück. Eine Frau stand dort. Ich sah sie von weitem und wäre am liebsten umgekehrt, doch das wäre wohl zu unhöflich gewesen. Es war Jörns und Mattys Mutter, Frau Moberg. Ich hatte sie erst ein paarmal flüchtig gesehen; eine blasse, unscheinbare Frau mit tiefliegenden Augen und einem ständig besorgt wirkenden Gesichtsausdruck.
Als sie mich kommen sah, machte sie eine halbe Wendung mit der Schulter, als wollte sie ihrerseits vor mir weglaufen. Dann blieb sie aber doch stehen, sah mich an und sagte hastig: „Entschuldige . . . hast du einen der Jungen gesehen?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich suche sie selbst.“
Die Besorgnis in ihrem Gesicht verstärkte sich. Sie warf mir einen ratlosen Blick zu, und ich hätte sie gern gefragt, ob denn etwas passiert sei. Ehe ich mich noch entschließen konnte, nickte sie mir kurz zu, wandte sich ab und ging durchs Tor zum Wohnhaus.
Ich blieb stehen und sah ihr nach. War irgend etwas vorgefallen, oder wirkte sie vielleicht immer so, als befürchtete sie dauernd eine Katastrophe? Seltsam, zu denken, daß diese unsichere, unscheinbare Frau Jörns und Mattys Mutter war.
Während ich noch dastand und überlegte, knirschte plötzlich der Kies der Auffahrt. Gleich darauf hörte ich das Geräusch einer Fahrradklingel. Ich drehte mich um und erwartete, Matty zu sehen, aber es war Carmen.
Ich dachte, daß es wohl keinen unpassenderen Namen für sie geben konnte als den, den ihre Eltern ausgesucht hatten. Wie kamen bayerische Bauern nur dazu, ihrer Tochter einen spanischen Vornamen zu geben?
Sie hatte Sonnenbrand auf der Stirn, und die Haut auf ihrem Nasenrücken schälte sich, so daß darunter ein rosaroter Fleck schimmerte. Das fiel mir auf, als sie neben mir anhielt und vom Fahrrad stieg.
„Hallo“, sagte sie. „Was macht das Reiten?“
„Momentan gar nichts. Matty und Jörn scheinen verschwunden zu sein.“
„Die tauchen bestimmt gleich auf. Hast du mal im Haus nachgesehen?“
„Nein“, sagte ich. „Aber da sind sie wohl nicht, weil Frau Moberg mich gerade gefragt hat, ob ich sie gesehen hätte.“
„Hm“, murmelte Carmen. Sie schob ihr Fahrrad ein Stück weiter und lehnte es gegen die Stallmauer. Ich folgte ihr. Im Stall war noch immer niemand als Schorsch, doch Carmen ließ sich von seiner mürrischen Miene nicht einschüchtern und fragte, wo die Jungen wären.
Ohne sich nach uns umzusehen, erwiderte er brummend, er hätte keine Ahnung, und schließlich wäre er kein Kindermädchen.
„Dem ist was über die Leber gelaufen“, stellte Carmen nüchtern fest, als wir wieder aus dem Stall traten. „Jetzt hole ich jedenfalls mal die Joschi von der Weide und sattle sie. Vielleicht taucht Jörn inzwischen auf.“
„Hoffentlich“, sagte ich. „Ich weiß nicht, Carmen, aber . . . Du, ob vielleicht etwas passiert ist?“
„Passiert?“ Ihre runden Augen musterten mich erstaunt. „Wie kommst du denn darauf?“
„Ach, ich weiß nicht. Es kommt mir nur merkwürdig vor, daß keiner von den beiden da ist. Schließlich weiß Jörn, daß du heute Reitstunde hast. Außerdem heißt es doch immer, daß ein Unglück selten allein kommt.“ Und ich erzählte ihr, daß Kirstys Hund irgendwo Gift gefressen hatte und beinahe daran gestorben wäre.
Carmen hörte aufmerksam zu, blieb am Gatter stehen und sagte: „Verdammt, schon wieder so eine Schweinerei! Vor einem halben Jahr ist unsere Katze vergiftet worden, und die vom Wirt ebenfalls. Irgend jemand in der Gegend legt vergiftete Köder aus – aber frag mich bloß nicht, warum ein Mensch so was tut!“
„Wahrscheinlich ist es jemand, der Tiere haßt und Vergnügen dabei empfindet, sie umzubringen“, sagte ich. „Kirsty hat schon recht, wenn sie sagt, daß man nirgends vor Haß und Zerstörung sicher sein kann.“
Carmen nickte. „Vielleicht sind das Leute, die selber nie geliebt worden sind“, erwiderte sie nachdenklich. „Solche, die mit Brutalität und Härte aufgewachsen sind und sich jetzt an den Schwächsten und Hilflosesten dafür rächen – und das sind nun mal die Tiere.“
„Oder Kinder“, murmelte ich. „Es soll ja auch genügend Leute geben, die Kinder mißhandeln, meistens sogar ihre eigenen.“
Das Gespräch verstärkte meine düstere Stimmung. Plötzlich war ich äußerst niedergeschlagen und hatte das sichere Gefühl, daß etwas Schlimmes passiert war.
Wir führten Joschi in den Stall und sattelten sie gemeinsam. Als wir über den Pfad gingen, der zur Schwammerlwiese führte, saß da ganz unvermutet jemand am Wegrand zwischen den Büschen.
Joschi wich ein Stück zurück und schnaubte erschrokken, und auch ich erschrak. Dann aber sah ich, daß es Jörn war. Auch die Stute erkannte ihn und beruhigte sich wieder.
Er stand auf. Sein Gesicht war so verschlossen, daß ich nicht den Mut fand, ihm eine Frage zu stellen. Sogar Carmen wirkte eingeschüchtert. Sie sagte nur „Hallo“, und Jörn nickte uns stumm zu und ging voraus zur Wiese. Diana kam aus dem Gebüsch gekrochen und folgte ihm mit eingezogenem Schwanz.
Carmen und ich wechselten einen Blick. Sie zuckte mit den Achseln. Dann stieg sie aufs Pferd und ritt im Schritttempo zur Mitte der Wiese, während Jörn mit hängenden Schultern stehenblieb. Er hatte die Hände tief in den Hosentaschen vergraben und starrte in die Luft.
„Jörn“, sagte ich, „wo ist Matty?“
Einen Augenblick lang schien es, als wollte er mir nicht antworten. Dann erwiderte er, ohne mich anzusehen: „Keine Ahnung. Er hat sich wohl irgendwo verkrochen.“
Verkrochen? Ehe ich den Mut aufbrachte, weiter zu fragen, begann Jörn Kommandos zu geben. Carmen und Joschi müßten leichttraben, aussitzen, im Viereck reiten, halbe und ganze Wendungen machen, auf dem Zügel reiten, durch die Bahn wechseln, Volten machen, Schlangenlinien durch die Bahn reiten und sonst noch so allerhand. Es hagelte Befehle, und ich stand dabei und sah mit offenem Mund zu, beunruhigt und erschrocken.
Reiterin und Pferd schwitzten schon nach kürzer Zeit heftig und taten mir aufrichtig leid. Es war eine Reitstunde zum Abgewöhnen. Jörn schenkte den beiden nichts. Ich merkte, daß er seinen ganzen unausgesprochenen Ärger, seine Sorgen oder was es auch sein mochte, was ihn bedrückte, an Carmen und Joschi ausließ.
Was mich betraf, so tat er, als wäre ich Luft. Ich hielt es etwa eine Viertelstunde lang aus, dann mochte ich nicht mehr zusehen. Ich unternahm auch keinen Versuch mehr, mit Jörn zu reden. Im Augenblick hatte es ja doch keinen Sinn. Stumm verließ ich die Reitwiese, und er hielt mich nicht zurück.
Dann begann ich nach Matty zu suchen. Ich ging zur Koppel, die dem Kavaliershäusl am nächsten war, und sah am Waldrand und im alten Viehunterstand nach, doch da war er nicht. Dann suchte ich ihn in der Sattelkammer, auf dem Heuboden über dem Stall, in der Futterkammer, im Werkzeugschuppen, in der Remise, wo zwei altersschwache Kutschen standen, und im halb verfallenen Gartenhäuschen hinter den Birken.
Erst dann fiel mir die Aussichtsbank ein, die auf der Anhöhe hinter Dreililien stand. Von dieser Bank aus hatte man einen besonders schönen Blick über das ganze Tal und die Wiesen und Felder bis hin zum Dorf. Ich wußte, daß Matty dort abends manchmal nach der Stallarbeit saß und auf der Mundharmonika übte oder in sein Tagebuch schrieb.
Er saß auch diesmal dort, doch ohne Mundharmonika und Tagebuch. Er hatte die Arme um seine Knie geschlungen und den Kopf daraufgelegt. Ich sah nur seine Haare, die ziemlich zerrauft waren. Ob er mich kommen hörte, weiß ich nicht, denn er sah nicht auf; auch nicht, als ich mich neben ihn auf die Bank setzte.
Eine Weile schwieg ich und wartete auf ein Zeichen von ihm, doch er blieb unbeweglich in der gleichen Stellung sitzen.
Schließlich sagte ich leise: „Matty, was ist los?“
Jetzt erst hob er den Kopf, und ich sah, daß er geweint hatte. Sicher wußte er, daß Tränenspuren auf seinem Gesicht waren, aber er schien sich nicht dafür zu schämen. Wie ein kleiner Junge fuhr er sich mit dem Handrücken über die Nase, und seine Stimme zitterte ganz leicht, als er erwiderte: „Hat Jörn es dir nicht erzählt?“
Ich schüttelte den Kopf. „Er hat nichts gesagt.“
Matty strich seine Haare zurück, so daß sie noch wilder nach allen Seiten abstanden. „Es hat ja sowieso alles keinen Sinn“, sagte er.
Ich hatte das Gefühl, gleich aus der Haut fahren zu müssen. „Aber was ist denn, zum Teufel? Was ist los?“
„Die Pferde sollen verkauft werden, das ist los“, erwiderte er heftig. „Alle bis auf drei oder vier.“
Ich starrte ihn an. Einen Moment lang war ich unfähig, es zu begreifen. „Die Pferde? Verkauft?“ wiederholte ich einfältig. „Aber . . . hat das dein Vater gesagt?“
Matty nickte. In seinen Augen war ein so verzweifelter Ausdruck, daß ich am liebsten selbst losgeheult hätte. Ich sagte rasch: „Aber das meint er sicher nicht ernst. Ihr habt doch hier immer Pferde gehabt, ihr lebt ja von den Pferden . . .“
Matty sagte bitter: „Das ist es ja gerade – wir können nicht mehr von den Pferden leben. Sie bringen nicht genug ein. Und obendrein schaffen wir die viele Arbeit kaum noch. Wir bräuchten einen Pferdepfleger mehr, aber das können wir uns nicht leisten. Wenn mein Vater selbst mitarbeiten könnte wie früher, wäre die Sache anders. So aber . . .“ Er verstummte und starrte trostlos vor sich hin.
Eine Weile versanken wir in Schweigen. Ich hätte ihn so gern getröstet, aber mir fiel nichts ein, was ich ihm hätte sagen können. Es gab keinen Trost. Der Gedanke, mit ansehen zu müssen, wie fast alle Pferde von Dreililien abtransportiert wurden, einem ungewissen Schicksal entgegen, machte mich selbst fast krank. Wieviel schlimmer mußte es erst für Matty und Jörn sein, die doch mit den Pferden aufgewachsen waren und jedes einzelne liebten!
Nach einer Weile sagte ich leise: „Und wann . . . wann ist es soweit?“
„Bald“, erwiderte Matty tonlos. „Er sagt, er will die Pferde möglichst schnell verkaufen – sobald er einen Käufer findet, der ihm einen anständigen Preis bietet.“ Er ließ den Kopf hängen. „Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, Nell. Ich glaube, ich muß von hier weg.“
Ich erschrak noch mehr. „Aber Matty!“ sagte ich. „Du bist doch so gern auf Dreililien. Das ist dein Zuhause, hierher gehörst du! Und überhaupt – wohin willst du denn gehen?“
„Ich weiß nicht. Aber ich kann nicht hierbleiben, wenn er die Pferde weggibt, das kann ich einfach nicht. Das mußt du doch verstehen, Nell!“
Ich sah ihn an. Die Welt war plötzlich dunkel und trostlos, und die Verzweiflung in Mattys Augen tat mir fast körperlich weh. Jetzt weinte er.
Ich rückte dichter an ihn heran und schlang ganz einfach die Arme um seinen Hals. Da legte er seinen Kopf an meine Schulter. Ich hörte, wie er schluchzte, spürte die Erschütterung mit meinem eigenen Körper und wurde seltsam ruhig dabei. Ich dachte: So muß es sein, so ist es richtig. Dafür hat man Freunde – daß man vor ihnen weinen kann und von ihnen in die Arme genommen und getröstet wird, wenn man elend und unglücklich ist.
Die Anspannung, die sich während der letzten Stunde in mir ausgebreitet hatte, wich, und mir wurde wieder warm. Ein Gefühl von Lebendigkeit stieg in mir auf, und etwas wie Hoffnung.
Es muß einen Ausweg geben, dachte ich. Wir dürfen es nicht so einfach hinnehmen wie ein unabänderliches Schicksal. Und während Mattys Schluchzen langsam verebbte, wuchs in mir die Überzeugung, daß wir gemeinsam eine Lösung finden konnten, wenn wir nur wollten.