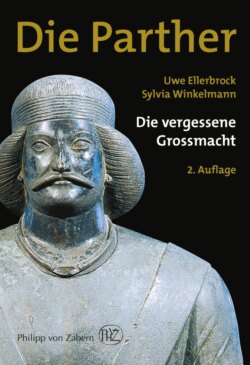Читать книгу Die Parther - Uwe Ellerbrock - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Antike Quellen – historische Wahrheiten oder Zerrbilder?
ОглавлениеBei allen sekundären Quellen müssen die politischen Umstände ihrer Entstehung, die persönliche Motivation und der persönliche Erfahrungsbereich der Autoren berücksichtigt werden, wenn es um die Einschätzung der Glaubhaftigkeit der in ihnen enthaltenen Aussagen geht, die nicht selten verzerrend oder ungenau sind.21 Ungeachtet derartiger Schwierigkeiten sind diese Zeugnisse eine notwendige Bereicherung, da sie bei der ohnehin geringen Gesamtquellenlage über das Parthische Reich wichtige Zusatzinformationen geben können.
Die Griechen, die Römer und die Chinesen waren über dieses Reich und dessen Bevölkerung nur unzureichend informiert. Parthien war weit weg, und man kann davon ausgehen, dass sich nur ein Bruchteil der Oberschicht für die parthischen Gebiete interessierte, vermutlich aus Handelsgründen. Erst mit Beginn der kriegerischen Konflikte zwischen Rom und Parthien rückte das Partherreich stärker in das allgemeine Bewusstsein der Römer. Viele zeitgenössische Berichte und bildliche Darstellungen waren politisch gefärbt oder gar verfälscht. Der Schriftsteller Strabon macht dieses Zerrbild deutlich, wenn er nach Friedenverhandlungen zwischen Kaiser Augustus und den Parthern schreibt, dass die Parther fast bereit seien, ihre ganze Selbständigkeit aufzugeben, und sogar von Rom ihren künftigen Kaiser erbäten. Eine solche Darstellung der Lage der Parther kann heute mit Sicherheit als falsch bezeichnet werden, denn gerade zu dieser Zeit stand das Parthische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Äußerungen Strabons entsprachen mehr einem politischen Wunschdenken und gewollter Propaganda, welche die Überlegenheit der Römer kennzeichnen sollte.
Ähnlich wie die Schriftzeugnisse geben auch die bildlichen Darstellungen von Parthern in der römischen Kunst nicht die Realität wieder.22 Eine der ersten Abbildungen eines Parthers in der römischen Kunst finden wir auf der Augustusstatue, die in das Jahr 20 v. Chr. datiert wird. Die hier dargestellte Szene bezieht sich auf die Rückgabe der Standarten, die die Römer in dem für sie sehr verlustreichen Krieg gegen die Parther in der Schlacht von Carrhae (53 v. Chr.) verloren hatten. Kaiser Augustus hatte in geschickten diplomatischen Verhandlungen die Rückgabe der Standarten erwirkt und so einen großen innenpolitischen Erfolg verbuchen können.
Die Abbildung eines Parthers auf dem Brustschild dieser Statue – möglicherweise soll es sogar der parthische König sein – zeigt diesen mit einer typisch parthischen Kleidung, einer V-förmigen Wickeljacke, die durch einen Gürtel zusammengehalten wird. Schon ein erster Blick auf die Gestik des dargestellten römischen Soldaten, der die Standarte entgegennimmt, macht deutlich, dass hier keine Gleichrangigkeit dargestellt werden soll, sondern dem Parther ein niedrigerer Status zugewiesen wird.
Ein weiteres bekanntes zeitgenössisches römisches Baudenkmal ist das Partherdenkmal aus Ephesos, das vermutlich nach 169 n. Chr. erstellt23 wurde und sich auf den Partherfeldzug des Lucius Verus bezieht (Abb. 3). In zahlreichen Darstellungen wird der Kampf der Römer gegen die Parther dargestellt. Die zeitgenössischen Künstler vermitteln auch hier sicherlich kein realitätsnahes Bild von den Parthern, denn in diesen Abbildungen werden einige der dargestellten Parther nur mit Lendenschurz und einer phrygischen Mütze bekleidet dargestellt, ein Parther sogar nackt. Die Parther werden im Nahkampf gezeigt, ihre Gesichter sind zum Teil schmerzverzerrt und drücken Angst aus.
Abb. 3: Partherdenkmal, Fundort: Ephesus, um 169 n. Chr., Teile in Kopie. Zwei Parther, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, sind zu Boden gegangen und von römischen Soldaten besiegt worden. Inv. Nr.: 10/6/77, 51/61/90, Museum Selçuk, Türkei.
Auch hier soll in propagandistischer Weise die Überlegenheit der Römer gezeigt werden, denn die parthischen Soldaten gingen nicht nackt oder mit Lendenschurz ins Gefecht, sondern trugen ihre Reitertracht mit den typischen Hosen. Ihre Kämpfe führten sie überwiegend mit Lanze, Pfeil und Bogen vom Rücken ihrer schnellen Pferde. Die verschiedenen römischen Bildzeugnisse und Darstellungen von Kämpfen gegen die Parther zeigen also nicht das wirkliche Bild eines Kampfgeschehens, sondern stellen die Parther als unterlegenes, barbarisches Volk dar. Dies geschieht mit der klaren Absicht, Niederlagen in vermeintliche Siege umzudeuten, mit dem Ziel, die eigene Schwäche nicht offenkundig werden zu lassen.
Eine andere Perzeption der Parther ergibt sich aus Berichten, die zu Zeiten des Kaisers Augustus entstanden sind. Mindestens fünf parthische Abordnungen besuchten damals Rom und führten Verhandlungen über Frieden und über die Grenzziehungen zwischen Rom und Parthien. Der von dem parthischen Rebellen Tiridates gefangen genommene und nach Rom gebrachte Sohn Phraates’ IV. wurde von Kaiser Augustus in den Circus Maximus geführt und erhielt einen Sitz in der zweiten Reihe hinter dem Kaiser.24 Unschwer darf hierbei ein politisches Kalkül des Imperators vermutet werden.25
Diese wenigen Kontakte zwischen Rom und Parthien vermochten jedoch nicht das Bild zu ändern, das die Römer generell von den Fremden aus dem Orient hatten. Es gab kaum verlässliche Informationen über das Parthische Reich, und die Römer blieben den typischen, stereotypen Vorstellungen verhaftet, die auch früher schon bestanden hatten: Die Parther verfügen über einen ungeheuren Reichtum und leben in pompöser Verschwendung, sind brutale Despoten und pflegen eine ausufernde Sexualität.26
Eine andere Sichtweise auf die Parther zeigen Darstellungen von gut aussehenden parthischen Dienern oder Sklaven in römischer Gesellschaft.27 Seit der Zeit von Kaiser Augustus dienten parthische Diener in Häusern wohlhabender Römer. Die Diener stammten zwar aus der märchenhaften Welt des Orients, erkennbar an den von ihnen getragenen orientalischen Hosen, mussten sich aber sicherlich an die römischen Vorstellungen anpassen. So trugen sie gepflegtes längeres Haar und waren glattrasiert, einige Sklaven werden mit einer phrygischen Kappe dargestellt. Eine Marmorfigur, die in der Casa del Camillo in Pompeji gefunden wurde, zeigt einen solchen Luxussklaven, der mit knielangem Gewand und Hosen abgebildet ist, in der Hand einen Weinschöpflöffel hält und ergeben auf die Befehle der Gäste wartet. Die gewünschte Darstellung der Unterlegenheit der Parther wird auch deutlich in römischen Glasgemmen, einem Massenprodukt aus der Zeit von Kaiser Augustus, die das Bild von zwei Parthern zeigen, die vor der Siegesgöttin Victoria stehen und dieser die römischen Standarten entgegenreichen.28
Das Bild der Römer von den Parthern war von der Vorstellung unermesslichen Reichtums begleitet. Parthische Könige saßen auf goldenen Stühlen, wenn der Bericht stimmt, wonach Trajan einen solchen bei der Eroberung Ktesiphons 116 v. Chr. erbeutete.29 Die prachtvoll verzierten Trinkhörner (Rhytha) und Silberschalen, die man im parthischen Palast in Nisa fand (Abb. 73), bestätigen den Reichtum parthischer Könige. Auch die Berichte über den parthischen Feldherrn Surena, der einen Tross mit 200 Konkubinen mit sich führte, lassen einen großen Wohlstand in der parthischen Oberschicht erkennen. Im Museum in Trier findet sich ein Sandsteinfragment, das einen gut gekleideten Diener in parthischer Kleidung zeigt, erkennbar ebenfalls an der Wickeljacke mit V-förmigem Ausschnitt, der – so wird vermutet – einen Goldbarren überreicht, der den Reichtum der Parther kennzeichnen soll (Abb. 43). Das aufwendig und kunstvoll frisierte Haar des parthischen Bediensteten signalisiert Luxus und Eleganz.30
Auch die Wunschträume der römischen Männer kommen nicht zu kurz, wie wir einem um 25 v. Chr. verfassten Text von Horaz entnehmen können, den der Dichter einem Freund gewidmet hat. Nach einem Sieg über die Parther würde ihm nämlich eine der barbarischen Jungfrauen als exotisches Sklavenmädchen dienen können, deren Bräutigam er im Kampf getötet haben werde.31 Letztlich werden in all diesem Darstellungen die Parther so gezeigt, wie die Römer sie sehen wollten.