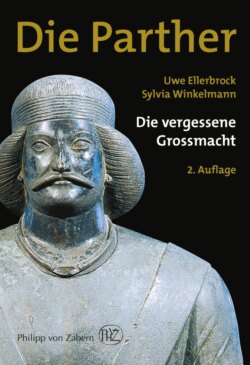Читать книгу Die Parther - Uwe Ellerbrock - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorparthische Geschichte – ein kurzer Überblick
Uwe Ellerbrock und Sylvia Winkelmann
Elam – die erste Hochkultur des Iran
Das Reich Elam war die erste Hochkultur in Iran. Die Elamer siedelten im Südwesten des Landes in zwei Regionen: im Gebiet von Khuzestan, der Tiefebene im Südwesten mit der Hauptstadt Susa, und in der Region von Anschan, der Hochebene der Fars mit der Hauptstadt Anschan (Tall-i Malyan). Die Herkunft der Elamer ist bis heute nicht sicher geklärt, deren Sprache mit keiner benachbarten Sprache verwandt. Frühe städtische Zentren entstanden hier schon im 4. Jt. v. Chr. Die früheste staatliche Formation bildet die sogenannte protoelamische Kultur (ca. 3100–2600 v. Chr.), die eine eigene Zeichenschrift besaß. Danach folgten die eigentlichen elamischen Reiche, das Altelamische (2600–1500 v. Chr.), das Mittelelamische (1500–1000 v. Chr.) und das Neuelamische Reich (760–640 v. Chr.). Die elamische Kultur profitierte vom Zugang zu den reichen Rohstoffvorkommen des Iran und von der Kontrolle des Überlandhandels nach Vorderasien, Indien und Mittelasien. Zeitgleich mit dem Reich der Elamern entstanden im 3. Jt. v. Chr. in Mesopotamien die sumerische städtische Hochkultur und das akkadische Großreich. Bedeutendes Kulturzeugnis dieser Reiche war die Entwicklung der Keilschrift. Da diese Kulturen auf die Zulieferung iranischer Rohstoffe angewiesen waren, fand zwischen beiden Regionen ein reger geistiger und wirtschaftlicher Austausch statt, der häufig von gegeneinander geführten Kriegszügen begleitet wurde. Im 2. Jt. v. Chr. wurde die altelamische lineare Schrift von der akkadischen Keilschrift abgelöst, wobei die Sprache, in der geschrieben wurde, das Elamische blieb. Nur die Keilschriftzeichen wurden übernommen. Die beiden Zentren der Elamer, Susa und Anschan, wurden jeweils von einem Großregenten verwaltet, über denen noch ein König stand. Die Erbfolge der Elamer war noch mutterrechtlich geprägt. Die Ruinenstadt Tschoga-Zanbil in der Nähe der Stadt Susa mit ihrer bedeutenden Zikkurat (Tempelturm) legt heute noch beredtes Zeugnis von den kulturellen Leistungen in der Zeit der Herrschaft des mittelelamischen Königs Untasch-Napirischa (1275–1240 v. Chr.) (Abb. 7) ab.
Abb. 7: Zikkurat Tschoga-Zanbil in der Nähe der Stadt Susa.
1213 v. Chr. eroberten die Elamer Babylonien, die bekannte Gesetzesstele Hammurapis von Babylon (heute im Louvre) wurde dabei geraubt und nach Susa geschafft. Der babylonische König Nebukadnezar I. (Regierungszeit 1124–1104 v. Chr.) zerstörte im Gegenzug die Stadt Susa. Elam versank bis ca. 800 v. Chr. in die Bedeutungslosigkeit. Die kurze Blüte des neuelamischen Reichs endete 640 v. Chr. mit der Zerstörung durch den Assyrerkönig Assurbanipal. Das Gebiet Elams ging schließlich im Perserreich auf, in dem die elamischen Verwaltungseinrichtungen fortgeführt und die elamische Sprache weiter gepflegt wurden. In der Partherzeit begegnet uns die ehemalige Region der Elamer als Elymais wieder.
Meder und Perser
Die Meder und die Perser, die den indo-iranischen Völkern zuzuordnen sind, gehören zur zweiten Einwanderungswelle jener neuen Völkerschaften, die schon seit der Mitte des 2. Jts. v. Chr. in den Nordiran einwanderten und teilweise bis nach Mesopotamien vorstießen. Die medischen Stämme siedelten vor allem im Zagrosgebirge sowie in Nord- und in Nordostiran und bildeten eine Stammeskonföderation, deren erster bedeutender Führer Kyaxares I. war. Dieser verlegte das Verwaltungszentrum nach Ekbatana, gelegen in der Nähe des heutigen Hamadan (Iran). Medische Stämme unternahmen zahlreiche Vorstöße gegen die Assyrer. Ende des 7. Jhs. v. Chr. eroberten sie gemeinsam mit den Babyloniern das Reich der Assyrer und zerstörten die bekannten Städte Ninive und Assur am Tigris. Die persischen Stämme waren in den Süden gezogen und hatten sich in der Region des ehemaligen Elamischen Reiches in der Persis niedergelassen, wo sie zunächst unter medischer Oberhoheit lebten. Aus diesen persischen Stämmen entwickelte sich das Altpersische Reich der Achämeniden. Der spätere Name Persien leitet sich von dem Namen der Landschaft Pars ab, die dem Gebiet der heutigen Provinz Fars mit der Hauptstadt Schiraz entspricht. Die Bewohner wurden Parsa, Perser, genannt.
Achämeniden
Der persische König Kyros II. (559–530 v. Chr.), der die Provinz Fars regierte, eroberte kurz nach seiner Thronbesteigung 550 v. Chr. Ekbatana und besiegte die Meder. Die Bezeichnung „Achämeniden“ leitet sich von dem Namen des Vorfahren Kyros’ II., des Dynastiegründers Hakhamanisch (griechisch: Achaimenes) ab. Kyros II. wurde in Pasagardae beerdigt. Sein Grabmal kann dort noch heute besichtigt werden. Im Laufe seiner Regierungszeit dehnte Kyros II. sein Reich durch die Eroberung von Babylonien und Lydien im Westen sowie von Baktrien und Sogdien im Osten aus. Bekannt wurde Kyros II. auch durch die Erwähnung im Alten Testament: Dort wird erzählt, er habe die nach Babylon verschleppten Juden freigelassen und es diesen ermöglicht, nach Jerusalem zu ziehen, um dort den zerstörten Tempel und die Stadt wiederaufzubauen. Sein Sohn Kambyses II. (530–522 v. Chr.) eroberte Ägypten. Das Weltreich der Achämeniden erstreckte sich damit von Ägypten bis zum Indus im Osten sowie vom Schwarzen und vom Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf.
Abb. 8: Persepolis, Königspalast, königliche Palastwachen.
Der auf Kambyses folgende Dareios I. (522–486 v. Chr.) gilt neben Kyros II. als der bedeutendste Großkönig des Altpersischen Reichs. Zu seinen Leistungen, die zu dieser Einschätzung beitragen, gehörte die Erneuerung der Reichsstrukturen. Seine Verwaltungsreformen wurden noch lange nach dem Ende des Achämenidenreiches als vorbildhaft betrachtet. Möglicherweise beeinflussten sie sogar die Organisation des Römischen Reiches. Außerdem förderte Dareios die Künste, insbesondere die Architektur, wovon die Gründung der prunkvollen Residenzen in Persepolis wie auch in Susa und Babylon zeugt (Abb. 8).
Das noch heute von den Zoroastriern benutze Symbol „Faravahar“, der geflügelte Mann, hatte für die persischen Könige in Persepolis religiöse Bedeutung (Abb. 9). Es ist auch auf Münzen der Frataraka (Herrscher in der Fars zu parthischer Zeit) zu finden und stellt vermutlich das khvarrah, das königliche Glück dar.
Durch die Ausdehnung des Reiches im Westen waren Auseinandersetzungen mit den Griechen programmiert. Immer wieder kam es zwischen beiden Völkern zu Kriegen. Die wichtigste Quelle für unser Wissen über die Perserkriege ist das Werk des griechischen Historikers Herodot (um 490/480–425 v. Chr.). Der Ausdruck „Perserkriege“ bezeichnet eine Reihe militärischer Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stadtstaaten des antiken Griechenlands und dem Perserreich. Diese Kriege fanden zwischen ca. 500 und 449 v. Chr. statt. Der Ausdruck „Perserkriege“ bezeichnet allerdings auch den Jahrhunderte andauernden Krieg des Römischen Reichs gegen die Parther und die Sasaniden. Einer der bekanntesten Feldzüge der Achämeniden fand 480 v. Chr. statt, als Xerxes I., Sohn Dareios’ I., mit ca. 400 Schiffen gegen die Griechen zog. Letztlich musste er sich 479 v. Chr. geschlagen geben.
Abb. 9: Persepolis, Königspalast, das Faravahar-Symbol bedeutet vermutlich „das königliche Glück“.
Alexander der Große (356–323 v. Chr.)
Der nur zehn Jahre dauernde Feldzug des makedonischen Königs Alexander des Großen veränderte die antike Welt nachhaltig. In der berühmten Schlacht von Issos 333 v. Chr. schlug Alexander die Perser. In der weiteren Folge eroberte der König zuerst Ägypten, um sich dann an die Eroberung des gesamten Persischen Reiches zu machen. Die Städte Susa und Babylon wurden ihm kampflos übergeben. In Babylon ließ sich Alexander zum „König von Asien“ ausrufen. Während Alexander in der Regel versucht hatte, eroberte Städte nicht zu zerstören, sondern durch eine Politik der Akzeptanz und des Überlassens eigener Verwaltungsstrukturen und Belassung des Glaubens für sich zu gewinnen, ließ er Persepolis als einzige Stadt von seinem Heer teilweise verwüsten. Der Grund hierfür dürfte in einer bewussten politischen Kalkulation Alexanders gelegen haben, der mit dieser Brandzerstörung endgültig das Ende des Persischen Reiches verkünden wollte.47
329–327 v. Chr. eroberte Alexander Samarkand (im heutigen Usbekistan) und zog weiter nach Osten, wo er Sogdien und Baktrien unterwarf. 326 v. Chr. marschierte er weiter nach Indien bis in das obere Industal in den Bereich des heutigen Nord-Pakistan, wo sich seine Gefolgsleute und die Männer der Truppe jedoch weigerten, noch weiter nach Osten zu ziehen. Der beschwerliche Rückweg nach Hause begann. 325 v. Chr. erreichte das Heer die Indusmündung. Ein Viertel des Heeres wurde mit Schiffen westwärts gebracht. Der Rest kämpfte sich mühsam auf dem Landweg in Richtung Heimat durch. Im persischen Susa trafen sich die See- und die Landtruppen wieder. 10.000 persische Frauen wurden bei einer Massenhochzeit mit den Kriegern, Makedoniern und Griechen, verheiratet. Über Ekbatana gelangte Alexander im Jahr 323 v. Chr. zurück nach Babylon, wo er starb. Sein Leichnam wurde später nach Ägypten überführt und in eine eigens für ihn geschaffene Grabstätte nach Alexandria gebracht.
In nur zehn Jahren hatte Alexander der Große nicht nur das gesamte Herrschaftsgebiet der Achämeniden unterworfen, sondern seinen Feldzug sogar bis zum Indus ausgedehnt. Seine Eroberungen veränderten das gesamte politische und kulturelle Gefüge von Rom bis nach Zentralasien.
Seleukiden
Nach dem Tod Alexanders kam es zu den Kämpfen seiner Nachfolger, den sogenannten Diadochenkämpfen. Schließlich entstanden drei große Dynastien: Makedonien mit Teilen Griechenlands unter den Antigoniden, Ägypten unter den Ptolemäern sowie das Seleukidenreich, das von dem Diadochen Seleukos I. Nikator übernommen wurde. Seleukos I. übernahm 311 v. Chr. alle Gebiete von Vorderasien einschließlich Syriens bis zum Osten nach Indien hin. Babylon machte er wie Alexander zu seiner ersten Hauptstadt und untermauerte seine Machtansprüche durch die Heirat mit einer ostiranischen Prinzessin. Damit waren solide Grundlagen für das von ihm gegründete Reich der Seleukiden gelegt. Von enormer ökonomischer Bedeutung für das Seleukidische Reich war das Zweistromland, das sich aus den beiden wohlhabenden Satrapien (Provinzen) Mesopotamien und Babylonien zusammensetzte. Unter der Herrschaft der Seleukiden wanderten in der Folgezeit viele Griechen in dieses Gebiet ein. Im Zweistromland kam es zu zahlreichen griechischen Stadtgründungen, von denen Seleukia am Tigris als Hauptstadt fungierte. Damit ergab sich eine starke Hellenisierung in Mesopotamien, die auch in Baktrien fassbar war, während in den anderen östlich gelegenen Gebieten die dort ansässigen Menschen weiter ihre lokalen Lebensweisen pflegten.
Die Größe des Reiches mit seinen vielfältigen Völkern machte die Herrschaft auf die Dauer schwierig. Innere Unruhen und Auseinandersetzung mit Ägypten folgten, so dass im Osten ein Machtvakuum entstand. Um 250 v. Chr. nutzte Andragoras, der Provinzgouverneur der Satrapie Parthia, die südöstlich des Kaspischen Meeres lag, seine relative Eigenständigkeit und erhob Ansprüche auf einen eigenen Herrschaftsbereich, wie Münzen mit seinem Portrait zeigen.48 Auch für das Volk der Parner, die im Bereich der Satrapie Parthia lebten, war die Zeit nun gekommen. Sie erhoben sich, besiegten Andragoras, übernahmen die Herrschaft über Parthia und gründeten damit das Parthische Reich. Dies war der Anfang von seleukidischen Gebietsverlusten und von Machtveränderungen im Osten, die letztlich dazu führten, dass sich das Graeko-Baktrische Reich vom Seleukidenreich abspaltete.
Die Seleukiden übten ihre Herrschaft weiter in Kleinasien und in Mesopotamien aus. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Armenien und mit Rom. Mit der Eroberung Mesopotamiens und der Hauptstadt Babylon durch den Partherkönig Mithradates I. im Jahr 141 v. Chr. endete auch dort die Seleukidenherrschaft. Mit diesem Sieg wurden die Parther Herrscher über eine Region mit hohem griechi schen Bevölkerungsanteil. Die Seleukiden konnten durch diesen Sieg der Parther ihren Herrschaftseinfluss nur noch in Gebieten des nördlichen Syriens ausüben, endgültig endete das Seleukidenreich, als Pompeius die Provinz Syria 64/63 v. Chr. unter direkte römische Herrschaft stellte.