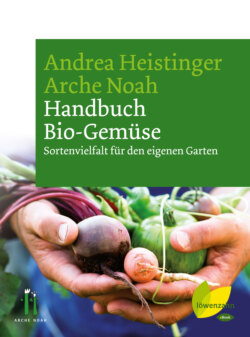Читать книгу Handbuch Bio-Gemüse - Verein Arche Noah - Страница 173
Fruchtfolge – was ist das eigentlich?
ОглавлениеDas Thema Fruchtfolge hat im Bio-Gemüsebau eine ganz besondere Bedeutung. Gemeint ist, dass sich auf einem Beet in zeitlicher Abfolge verschiedene Gemüse- und Gründüngungspflanzen einander abwechseln. Das kann in kleinen Gärten zu einer ziemlichen Herausforderung werden. Eine gute Fruchtfolge ist die Basis für die unkomplizierte und erfolgreiche Ernte von gesundem Bio-Gemüse. Sie pflegt den Boden und ein gesunder Boden ist die Voraussetzung, dass Kulturpflanzen gedeihen und gesund bleiben.
• Die Fruchtbarkeit der Böden stärken
Eine gute Fruchtfolge erhält nicht nur die Fruchtbarkeit der Böden, sondern erhöht die Bodenfruchtbarkeit von Jahr zu Jahr, sie aktiviert und „füttert“ das Bodenleben.
• Die Böden werden nicht einseitig beansprucht
Verschiedene Gemüse brauchen verschiedene Nährstoffe und verschiedene Pflanzen sondern unterschiedliche Wurzelausscheidungen aus. So werden die Böden nicht einseitig ausgelaugt bzw. nicht einseitig mit bestimmten Stoffen angereichert.
• Vorsorgender Pflanzenschutz
Eine ausgewogene Fruchtfolge ist der beste Pflanzenschutz – Krankheitserreger können von einem aktiven Bodenleben gut abgebaut werden.
• Unkräuter regulieren
Unkräuter können besser in Schach gehalten werden, vor allem ein Anbau von Gründüngung hilft, das Wachstum von Unkräutern wirksam zu unterdrücken. Allerdings ist es dafür nötig, dass die Gründüngung ausreichend dicht angebaut wird. Wenn der Bestand nicht gut schließt und zu lange steht, können sich manche Unkräuter (wie z.B. Quecke) sehr gut vermehren.
• Gute Erträge sichern
In Langzeitversuchen konnte gezeigt werden, dass z.B. Karotten, wenn sie 4 Jahre hintereinander auf der gleichen Fläche angebaut werden, im 4. Jahr nur noch 24 % vom Ertrag des 1. Jahres bringen.
Einige Grundregeln der Fruchtfolge
(auf Basis eines Artikels von Andreas Fritzsche Martin, Bio-Berater)
Für eine ausgewogene Fruchtfolge gibt es einige Grundregeln. Wer diese einhält, wird innerhalb dieser Prinzipien ausreichende Möglichkeiten der Gestaltung einer Fruchtfolge, die dem eigenen Garten und den eigenen Bedürfnissen ideal entsprechen, finden.
• Wechsel der Familien
Also z.B.: Wachsen in einem Jahr Kohlrabi auf einem Beet, im nächsten Jahr keine anderen Kreuzblütler auf der Fläche anbauen. Sind im letzten Jahr Karotten auf dem Beet gewachsen, im Folgejahr keine Doldenblütler auf dem Beet aussäen.
• Pflanzen, die andere Pflanzen düngen...
nennt man Gründüngung (→ Über das Düngen). 20–30 % der Fruchtfolge sollten aus Gründüngung (auch mehrjährige) bestehen
• Grüne Beete im Winter
30 % der Beete sollen im Winter mit Gründüngung oder einer Kulturart begrünt sein. Der Boden ist so vor Auswaschung geschützt und die Fruchtfolge ist weiter aufgelockert.
• Hülsenfrüchte sind Pflicht
Der Anbau von Bohnen & Co. zählt zu den Pflichtübungen jedes Biogärtners und jeder Biogärtnerin. Mindestens 20 % der Fruchtfolge sollten aus Hülsenfrüchten bestehen.
• Bodenkrankheiten auskurieren
Nicht mehr als 30 % der Fruchtfolge mit Pflanzen, die von ein- und derselben Krankheit befallen werden können, bebauen, wenn diese Krankheitserreger vom Boden aus die Pflanzen infizieren können: Z.B. Sclerotinia-Krankheit, die Salat, Gurken und Bohnen befallen kann.
• Pflanzen lockern den Boden
... wenn man sie lässt. Mindestens 30 % der Fruchtfolge mit Tiefwurzlerzlern (→ Tabelle 1) bebauen. Ihre Wurzeln durchwachsen den Boden 90 cm tief (!) und erschließen Nährstoffe (z.B. Stickstoff, Phosphor) aus tiefer gelegenen Bodenschichten. Bei den Gründüngungspflanzen ist dies im Hausgarten in erster Linie Winterwicke. Werden die Ernterückstände dieser Pflanzen wieder in die Erde eingearbeitet, stehen sie auch wieder Flachwurzlern zur Verfügung.
• Den Boden pflegen heißt für Abwechslung sorgen
Kulturarten, welche die Bodengare lockern und verdichten stets abwechseln (→ Tabelle 2). Zwischen Kulturen, die einen hohen Stickstoff-Bedarf („Starkzehrer“), einen mittleren („Mittelzehrer“) und einen niedrigen Stickstoffbedarf haben („Schwachzehrer) wechseln (→ Tabelle 3). Ebenso Kulturarten, die den Boden besser oder schlechter beschatten, Gemüse, die viel oder wenig Ernterückstände hinterlassen, Gemüse, die schnell oder langsam auflaufen. Diese Form der Abwechslung verhindert nicht nur die einseitige Ausnutzung des Bodens, sondern auch die einseitige Vermehrung von Unkräutern und führt gleichmäßig organische Substanz zu.
Welche Probleme treten auf, wenn keine gute Fruchtfolge eingehalten wird?
Bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge werden gefördert, also Krankheiten, bei denen die Erreger vom Boden aus die Pflanzen befallen (z.B. Sclerotinia, Kohlhernie, Nematoden).
• durch Wurzelausscheidungen kommt es zu Wachstumsdepressionen
• Nährstoff-Ungleichgewichte entstehen
• Schädlinge wie Karottenfliegen, Kohlfliege, Kohlweißling, Erdflöhe können sich gut vermehren
• der Unkrautdruck wird größer
• die Erträge sinken
Allen, die neu zu gärtnern anfangen (aber auch allen, deren Gedächtnis nicht penibel über Jahre zurückreicht), sei empfohlen, in einem Gartenheft zu notieren, auf welchem Beet in welchem Jahr welche Kultur stand. Idealerweise auch festhalten, wann welche Kulturart besonders gut gediehen ist und welches Gemüse vorher auf dem Beet gewachsen ist oder umgekehrt, wenn ein Gemüse sich nicht gut entwickelt.
| Tiefwurzler | Mittelwurzler | Flachwurzler |
| Spargel | Kohlarten | Sellerie |
| Pastinake | Gartenbohne | Mais |
| Kürbis | Puffbohne | Endivie |
| Tomate | Karotte | Porree |
| Wassermelone | Gurke | Kopfsalat |
| Artischocke | Melanzani | Zwiebel |
| Rote Rübe | Melone | Petersilie |
| Mangold | Erbse | Kartoffel |
| Zuckerrübe | Paprika | Radieschen |
| Futterrübe | WasserrübeKohlrübe |
Tabelle 1: Gemüsekulturen und ihre Durchwurzelungseigenschaften (Quelle: Andreas Fritzsche Martin/Ökomenischer Gärtnerrundbrief 05/2008)
| Die Bodengare fördernd | Die Bodengare belastend |
| Hülsenfrüchte Zwiebelgewächse Nachtschattengewächse Salate Gurkengewächse Kohlgemüse | Wurzelgemüse Doldenblütler Mais |
Tabelle 2: Gemüsekulturen und ihr Einfluss auf die Bodengare (Quelle: Andreas Fritzsche Martin/Ökomenischer Gärtnerrundbrief 05/2008)
| Starkzehrer | Mittelzehrer | Schwachzehrer |
| Endivien | Salat | Feldsalat |
| Kohlarten | Neuseeländer Spinat | Winterportulak |
| Sellerie | Mangold | Rucola |
| Tomaten | Kohlrabi | Kresse |
| Gurken | Chinakohl | Rübstiel |
| Zuckermais | Pastinake | Radieschen |
| Porree | Rettich | Petersilie |
| Rhabarber | Steckrübe | Bohnen |
| Kürbis | Herbstrübe | Erbsen |
| Zucchini | Rote Rübe | Kräuter |
| Spargel | Fenchel | |
| Artischocke | Schwarzwurzel | |
| Cardy | Zwiebel | |
| Melone | KnoblauchKarottenKartoffel |
Tabelle 3: Nährstoffbedarf der Gemüsekulturen bezogen auf den Stickstoffbedarf (Quelle: leicht verändert nach Andreas Fritzsche Martin/Ökomenischer Gärtnerrundbrief 05/2008)