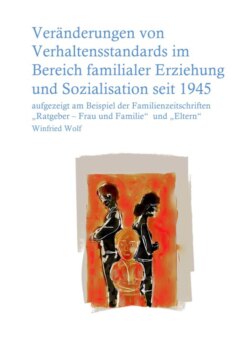Читать книгу Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation seit 1945 - Winfried Wolf - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Exkurs zum Männerbild der 50er Jahre
ОглавлениеDas Frauenbild der Männer: Idealbild der Frau ist für den deutschen Mann der fünfziger Jahre „die Ehefrau und Mutter“, die für ihre Familie lebt und den Inhalt ihres Lebens in ihr seiht. Was er nicht mag sind Frauen, die sich extravagant kleiden, unbedingt originell sein wollen, allzu ungezwungen auftreten, es mit der Ordentlichkeit zu genau nehmen (immer den Putzlappen in der Hand und das Kopftuch umgebunden, d. V.). Unsympathisch sind ihm Frauen, die sich ungeschickt verhalten, keinen Spaß verstehen, sich zur Salonschlange aufspielen und sich immer krampfhaft bemühen eine andere zu sein, als sie wirklich sind (vgl. 4/58/252)
„Richtige Männer schätzen nun einmal das Hausmütterchen, das kochen und wirtschaften kann, mehr als die zwar eleganter erscheinende, aber auch meist anspruchsvollere und selbständigere (berufstätige, d. V.) Frau.“ (11/56/693)
Sie, die berufstätige Ehefrau, ist daher oft die Sorge des Mannes und – wie der Ratgeber findet – „Anlass für seine schlechte Laune“. Er muss dann nämlich befürchten, „dass berufliche Interessen seine Frau mehr erfüllen könnten, als die Gedanken an das eigene Heim.“ (8/55/486) Das in jedem Manne schlummernde „Bedürfnis zu beschützen... fühlt sich gekränkt, wenn er merkt, dass dieses ‚schutzbedürftige’ Wesen seinen Schutz gar nicht braucht.“ (8/55/487)
Eine Frau darf „niemals vergessen, dass ihr Mann das Recht hat, nicht nur mit einer tüchtigen Berufsfrau, sondern vor allem auch mit einem sehr anziehenden weiblichen Wesen verheiratet zu sein.“ (6/59/547)
Der Mann als Familienvater und Erzieher:
Seine Autorität in der Familie erreicht er, wenn auch immer mühevoller und in Konkurrenz mit „Sportlern und Filmstars“, durch sein Vorbild und das „Setzen von Werten“. (vgl. 6/59/547) Zwar sind die Zeiten des Patriarchats vorbei, doch „patriarchalische Distanz“ und „unverletzliche Autorität“ sind nach wie vor notwendig, denn Kinder brauchen und wollen „eine feste Hand“ (vgl. 8/56/483).
Der „moderne Mann“ legt nun aber „keinen unbedingten Wert (mehr) darauf, allein die Autorität in der Familie auszuüben“. Er entdeckt für sich in der Familie neue Betätigungsfelder: er „interessiert sich für die Inneneinrichtung seiner Wohnung (ehemals eine Domäne der Frau), er beschäftigt sich mit Erziehungsproblemen, hilft im Haushalt und führt Reparaturen aus.“ (6/59/547) Zwar ist die Pflege und Erziehung der Kinder noch immer Angelegenheit der Frau, doch bleibt der Mann nicht mehr ganz unbeteiligt: beim neugeborenen Kind beschränkt sich seine Mithilfe noch darauf „still das Kleine zu betrachten“, denn „er fühlt sich etwas ratlos und weiß nicht recht, was er mit dem Säugling anfangen soll.“ (11/57/784) Auch beim Kleinkind erschöpfen sich die „Aufgaben des Vaters... noch im Umhertragen oder –führen und im gelegentlichen Spielen.“ „Die Macht, die er aufgrund seiner Vaterstellung besitzt“, hindert ihn zuweilen daran, eine gute Beziehung zu seinem Kind aufzubauen, denn im Kind kann das Gefühl erweckt werden, „dass es dem Vater hilflos ausgeliefert ist.“ (11/57/785)
Mit dem größer werdenden Kind nimmt dann die Bedeutung des Vaters als Erzieher zu. Er wird zur „richtenden Autorität“, dem am Ende eines Tages die Sünden der Kinder vorgetragen werden. Doch soll sein Strafgericht nicht „in Prügeln ausarten“. Der gute Vater zeigt sich vielmehr interessiert: „Wenn er sich die Pantoffeln bringen lässt, auf das kindliche Geplauder eingeht und den vielen Fragen standhält, gar noch etwas basteln hilft oder vorliest, werden sich die Kinder auf sein Heimkommen freuen.“ (11/57/785)
Das Vater-Sohn-Verhältnis
Eine besondere Aufgabe wächst den Familienvätern noch in der geschlechtsspezifischen Erziehung der Kinder zu. Vater und heranwachsender Sohn besprechen die ernsten Dinge des Lebens: Beruf, Politik, unter Umständen auch die Freundschaften des Sohnes und erste Liebesabenteuer. In der „Männerecke“ unterbreitet der Vater dem Sohn seine Pläne und Vorstellungen über dessen Zukunft. Der Sohn wird mit den Absichten des Vaters nicht immer einverstanden sein; dann gilt für den Vater: „Geduld haben, beraten, zuhören und wenn nötig, einlenken.“ (vgl. 3/55/149) „Natürlich wäre es schön, wenn Hans unseren Betrieb weiterführte, und in den allermeisten Fällen“, meint der Ratgeber, „wird es auch das Vernünftigste sein. Wenn er aber eine ausgesprochen andere Begabung und Neigung zeigt, so sollte er (der Vater, d. V.) ihn nicht zwingen...“ (3/55/148)
Der Mann im Haushalt:
Neben der Erziehung der Kinder ist der Vater und Ehemann der fünfziger Jahre auch schon bei der Mithilfe im Haushalt gefordert. Noch gilt vielen Vätern und Söhnen jede Haushaltsarbeit als zutiefst „unmännlich“ und – wie der Ratgeber zu berichten weiß – nicht „wenige Mütter unterstützen diesen ‚Antihaushaltskomplex’“. Es scheint sich jedoch die Überzeugung durchgesetzt zu haben, dass „auch das Haushaltsjoch zwei- und dreispännig getragen“ werden muss (vgl. 9/56/553). Genügt es doch schon, „wenn er wenigstens im Haus die Schwerarbeit verrichtet und je nach seinem individuellen Vermögen... da und dort mit das Geschirrtuch und den Staubsauger schwingt, den Teppichklopfer bedient, die Heizung versorgt, die Kehrrichtkübel fortbringt...“ (9/56/553)
Sollen Männer auch kochen können? Ja, wenn Not am Mann ist und „nur als festliche Ausnahme... etwa am Sonntag oder im Ferienhaus, auf der Skihütte oder als Junggesellenhobby“. Und es gibt noch eine Rechtfertigung für die kochenden Männer: „Frauen mögen ausgezeichnet kochen können, Phantasie und eine feinere Zunge haben wir (Männer)“ (11/55/698)