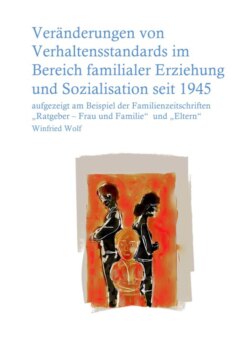Читать книгу Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation seit 1945 - Winfried Wolf - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Exkurs: Die Theorie struktureller Selektion
ОглавлениеBedarf es überhaupt einer Theorie zur Erklärung von Veränderungsprozessen im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation? Nun – sollen Veränderungen der für Erziehung und Sozialisation geltenden Wertesysteme nicht ungedeutet bleiben, bedarf es einer theoretischen Klammer. Ein ergänzendes Theorieangebot zum Prozess der Zivilisation von Norbert Elias bietet m. E. die Theorie struktureller Selektion. Sie kann ebenfalls als Erklärungsmodell für die Veränderung von Verhaltensstandards im Bereich familialer Sozialisation und Erziehung dienen und steht in einem parallelen Erklärungsmodus zur Zivilisationstheorie. Wie schon bei der Skizzierung der Zivilisationstheorie nach Elias angedeutet, scheint uns für die Erklärung von Veränderungen von Verhaltensstandards ein integratives Modell besonders geeignet zu sein, da es sowohl individualistische Handlungserklärungen als auch strukturelle Theorien sozialen Wandels miteinander verkoppelt. Mit Michael Schmid betrachten wir Familien bzw. die Eltern-Kind-Beziehung als „soziale Strukturen“14. Danach sind soziale Strukturen jene Arten von gegenseitigen Beziehungen, in die Aktoren zueinander treten können und müssen. „Die Elemente dieser Beziehungen sind einmal die Aktoren selbst (also Eltern und Kinder, d. V.) und zum anderen die Regeln (oder Normen), die den Verkehrsformen dieser Aktoren unterliegen, an denen sich ihr Handeln orientiert“15.
Wir betrachten hier die Aktoren nicht mit dem Blick auf die ganze Vielfalt ihrer möglichen Eigenschaften, sondern grenzen die Perspektive durch die Auswahl einer bestimmten Merkmalsmenge (Eltern als Erzieher und Kinder als zu Erziehende) ein. Wenn sich die Familie als soziale Struktur mit Hilfe der Begriffe „Kollektiv“ und „Regeln“ definieren lässt, dann kann die Beschreibung von Veränderungsprozessen die Veränderung eben dieser Kollektive und Regeln nicht unberücksichtigt lassen.
Darüber hinaus müsste natürlich auch das faktische Handeln der Aktoren selbst in den Blick kommen etwa über Fallbeispiele mit illustrativem Charakter.
Betrachtet man die Familie als Reproduktionssystem, sind die Randbedingungen oder Ressourcen für die Aufrechterhaltung, Absicherung und Veränderung von Verhaltensstandards zusätzlich zur Erklärung heranzuziehen, wenn man nicht einseitig individualistischen Erklärungsmodellen den Vorzug geben möchte.16 Die Randbedingungen wirken zwar regelmäßig auf das Gelingen familialer Reproduktionsleistungen ein, können sich aber auch völlig unabhängig von diesen verändern. „Bleiben diese Umweltfaktoren aber konstant, so können sie für die anfallenden Reproduktionsprozesse als externe Parameter gelten, deren Einfluss zu kennen sicherlich von Gewinn ist, die wir praktisch aber oftmals erst dann entdecken, wenn sie sich verändert haben, sei es aufgrund der kollektiven Handlungsfolgen des Reproduktionsprozesses selbst oder unberührt hiervon.“17
In jedem Fall gerät eine Struktur wie die Eltern-Kind-Beziehung mit ihrem Regel- und Normensystem wie andere soziale Strukturen auch bei sich wandelnden Umweltfaktoren unter Selektionsdruck und es wird fraglich, ob Form und Inhalt des Sozialisationsprozesses auch weiterhin so bleiben können, wie sich das über Generationen hinweg „eingespielt“ hat. „In solchen Situationen kann es passieren, dass alternative Erziehungs- und Sozialisationsformen, sofern sie zur Verfügung stehen, selektiv prämiert werden18. Sie werden sich bei günstigen Randbedingungen mit erhöhter Chance durchsetzen und im Extremfall alte und überkommene Regeln und Kollektive entweder in bestimmte Nischen zurückdrängen oder gänzlich eliminieren. Voraussetzung ist freilich auch, dass es gelingt in Korrespondenz zu den sich verändernden Umweltbedingungen die alternativen Erziehungsvorstellungen zu institutionalisieren. Erst dann nämlich können sich neue Formen und Regeln für Verhaltensweisen in der Eltern-Kind-Beziehung reproduzieren.
Die Familie wird nun solange ihre Reproduktionsleistungen der Form und dem Inhalt nach beibehalten können, solange dies die Umwelt zulässt. Eine strukturelle Krise stellt sich dann ein, wenn dies nicht länger möglich ist. Nach Schmid können zwei Gründe dafür ausschlaggebend werden: „Zum einen können die faktischen Folgen des Reproduktionsprozesses dessen eigene Voraussetzungen derart verändern, dass jene Handlungen, welche die Sozialstruktur konstituieren, fortschreitend an Wahrscheinlichkeit verlieren, wiederholt zu werden.19 Von einer strukturellen Krise wollen wir aber auch dann sprechen“, fährt Schmid fort, „wenn sich hiervon unabhängig die konstant geglaubten Umweltfaktoren und Ressourcen de facto als variabel erweisen und ihre Veränderung das Gelingen des Reproduktionsprozesses in Frage stellen kann.“
Strukturwandel nach diesem Modell wird also dann vorliegen, wenn es neuen Kollektiven auf der Basis alternativer Regeln gelungen ist, angesichts der veränderten Umweltlage einen Reproduktionsprozess zu institutionalisieren und zu stabilisieren, der die eigene Existenz gegenüber den überkommenen Kollektiven und Regeln favorisiert.20
Schmids Theorie erklärt demnach sozialen Wandel als Folge der differentiellen Selektion von reproduktionsfähigen Strukturen unter sich verändernden Umweltbedingungen.21 Ein solches Erklärungsmodell kann u. U. blinde Stellen der Zivilisationstheorie mit Erklärungen auffüllen.