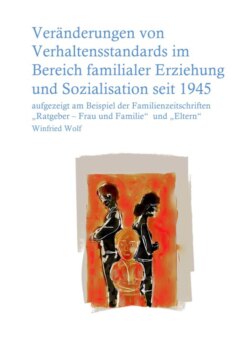Читать книгу Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation seit 1945 - Winfried Wolf - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Exkurs: Die Anwendung zivilisationstheoretischer Kategorien für die Analyse von Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich der Erziehung
ОглавлениеAllgemeines Erkenntnisinteresse der Zivilisationstheorie von Norbert Elias ist es u. a. die Folgen des Sozialen Wandels für die individuelle Existenz herauszuarbeiten.
Übertragen auf die vorliegende Arbeit hieße das die Frage aufzunehmen, wie sich etwa die normativen Erwartungen der Gesellschaft bezüglich der Kindererziehung auf die Betroffenen, Eltern und Kinder, sowie ihre Beziehungen zueinander, auswirken und wie sich diese und die Reaktionen darauf im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei wird es mir mit Hilfe der Analyse der ausgewählten Ratgeber-Literatur möglich sein gewisse Trends und Veränderungen in den Anforderungen, Verboten und Geboten im Bereich familialer Erziehung zu beschreiben, nicht aber zu zeigen, wie sich diese Trends des Zivilisationsprozesses auf das denken, Fühlen und Handeln von Eltern und Kindern auswirken (Ein Thema von Jugendstudien etwa).
Die Diagnose wird sich also auf die Klarlegung von Veränderungen im normativen Bereich beschränken, wobei allerdings nicht auf eine differenziertere Systematik verzichtet werden muss. Die Analyse wird zeigen können, wo etwa Verschiebungen in der Machtbalance zwischen Eltern und Kindern stattgefunden haben, welche Veränderungen sich etwa in der Einstellung der Erzieher zu sich selbst ergeben haben etc. Die Erklärung der festgestellten Trends soll dann probeweise mit Hilfe zivilisationstheoretischer Kategorien versucht werden. Dabei ist von folgenden Grundannahmen, die Elias in seiner Theorie der Zivilisation für andere, aber ähnliche Problemfelder herausgearbeitet hat, auszugehen:
Die Monopolisierungsprozesse führen zur Institutionalisierung gesellschaftlicher Chancen. Elias hat dies paradigmatisch an der Soziogenese des Staates aufgezeigt: mit der Monopolisierung der körperlichen Gewalttat hat sich der soziale Habitus des einzelnen Individuums geändert.
Annahme: Auch das, was man im Bereich der Pädagogik mit „Professionalisierung“, „Pädagogisierung der Gesellschaft“, „Expertenmacht“, „Beratungsboom“ etc. bezeichnet, steht für einen Prozess der Monopolisierung – für eine Monopolisierung der pädagogischen Kompetenz.
Mit der Monopolisierung ändert sich die soziale Kontrolle individuellen Handelns (Nach Elias verändert Sozialer Wandel, der zur Monopolisierung gesellschaftlicher Chancen führt, die soziale Kontrolle der Betroffenen. Elias hat dies beispielhaft an den Verhaltensweisen der Hofgesellschaften gezeigt).
Annahme: Auch mit der Monopolisierung pädagogischer Kompetenz hat sich durch die vorangetriebene Sensibilisierung für Fragen der Erziehung die soziale Kontrolle individuellen erzieherischen Handelns geändert.
Für die erklärende Diskussion im Rahmen der Elias’schen Zivilisationstheorie ergibt sich damit für die Arbeit folgendes argumentatives Verlaufsschema:
Figurative Veränderungen führen zu Monopolisierung und Institutionalisierung pädagogischer Kompetenz; das kann auch für die Figuration Familie gelten
Monopolisierung heißt: der ehemals privilegierende Besitz erzieherischer Autorität und Kompetenz auf Seiten der Eltern (Erzieher) gerät in einen Prozess Sozialen Wandels:
Dieser Prozess Sozialen Wandels führt zu einer gesellschaftlichen Ausdifferenzierung pädagogischer Kompetenz, zu einer Institutionalisierung der Erziehung neben und außerhalb der Familie; damit verbunden ist eine Verschiebung der erzieherischen Verfügungsgewalt;
Mit dem Prozess der Monopolisierung pädagogischer Kompetenz ändert sich die soziale Kontrolle individuellen und erzieherischen Handelns (Elternkontrolle); Neben der Freisetzung neuer Handlungsmöglichkeiten für die Betroffenen, erreicht durch die Sensibilisierung für Fragen der Erziehung, entstehen neue Zwänge und Ängste, die ihrerseits einer weiteren Institutionalisierung und Professionalisierung Vorschub leisten.
Eine Folge der Monopolisierungsprozesse in der Erziehung ist, dass die Menschen in einer ganz neuen Weise für Erziehung sensibilisiert werden. Dar damit verbundene mögliche Gewinn an Erfahrung wird jedoch durch die historisch gleichzeitig ablaufende und diese erst ermöglichende Pädagogisierung der Gesellschaft zumindest teilweise an Experten abgetreten. Dort, wo die Erfahrung mit und in der Erziehung in konfliktträchtige Situationen umschlagen, endet die Zuständigkeit der „Laien-Pädagogen“. Hier setzt nun wieder die Definitionsmacht von Psychologie und Pädagogik ein. Denn sobald die sensibilisierten Erzieher an die Grenzen einer intakten Erziehung kommen, dieses sind bei einer prinzipiellen Infragestellung schnell erreicht, werden sie angehalten, sich den Experten anzuvertrauen. Kompetenzen Rat suchen, gehört ja mittlerweile zur sozialen Rolle des „aufgeklärten“ Erziehers (Illich empfiehlt hier bekanntlich seine entfremdungstheoretisch begründete Rückkehr zum einfachen Leben, zur Pädagogik in Selbstverantwortung).
Zwar hat die Institutionalisierung / Professionalisierung zweifellos auch zu einer Steigerung individueller Handlungschancen im Erziehungsbereich geführt – ich vermute jedoch, dass infolge der Entlastung durch Institutionen bzw. Experten, den Erziehern wesentliche Erfahrungen verwehrt bleiben, denn nicht selten stürzt die Steigerung individueller Handlungschancen die Betroffenen in eine neue Zwangslage: Es sind dies die Erfahrungen mit den Möglichkeiten „falschen Handelns“ sowie der Umgang mit den bewusst gewordenen Risiken der Erziehung. In solchen Fällen ist man dann nämlich wieder auf den Experten angewiesen.
Der Monopolprozess der Erziehung kann die Betroffenheit durch schwere Konflikte und Krisen in der Erziehung jedoch nicht abdecken. Es gehört wohl zu den allgemeinen Erfahrungen von Erziehern, dass wirkliche Hilfe in Problemfällen der Erziehung durch soziale Institutionen, Beratungsdienste, pädagogische Literatur, nicht oder nur unzureichend gesichert ist. Man kann vielleicht daher von einer soziogenen Angst vor Verlassenheit in Situationen äußerster Hilfsbedürftigkeit sprechen. Sie entsteht nach der Theorie der Zivilisation mit der Existenz gesellschaftlicher Monopolinstitute, die Erziehung als Risiko auch im Bewusstsein der Einzelnen ausdifferenzieren. Die öffentliche Diskussion über Erziehungsfragen setzt eine Suche nach zusätzlichen Hilfsangeboten und Garantien in Gang. Eine antizipierende Vergegenwärtigung der eigenen Hilflosigkeit, das Bewusstsein der eigenen latenten Fehlbarkeit, motiviert den Versuch, Verpflichtungen und Bindungen bei den Personen (Eltern) zu erzeigen, die sich dem Ersuchen um Hilfe durch einen Hinweis auf gesellschaftliche Institutionen entziehen könnten.