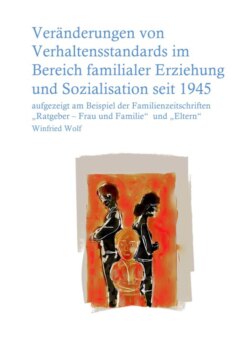Читать книгу Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation seit 1945 - Winfried Wolf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Beratung in und durch Zeitschriften
ОглавлениеSkizzierung der Beratungssituation
Jede Beratungssituation, die institutionelle, die alltägliche und auch diejenige, welche wir in den Ratgeber-Rubriken der Illustrierten und Frauenzeitschriften antreffen, strukturiert sich durch das Dreiecksverhältnis von Ratsucher, Problem und Ratgeber. Der Ratsuchende der Zeitschriftenberatung wendet sich aus freien Stücken, wenn auch nicht immer ohne inneren Zwang, an einen Ratgeber in der Hoffnung, von diesem Rat und Hilfe für ein ihn belastendes Problem zu finden. Er geht damit auf ein Angebot ein, das ihm vom „Ratgeberonkel“ einer Zeitschrift signalisiert bzw. offeriert wird46: „haben auch Sie Erziehungssorgen? Dann schreiben Sie an den ‚Ratgeber für Haus und Familie’, Kennwort ‚Erziehung’... Unser Mitarbeiter... wird Sie beraten... Wir leiten Ihr Schreiben diskret an unseren Mitarbeiter weiter, der Ihnen durch Brief antworten wird. Bei Veröffentlichung werden wir Ihren Namen natürlich weglassen... (vgl. 3/68/260).
Dass jemand überhaupt bei einem „qualifizierten“ Ratgeber, der gewöhnlich heute beruflich und vom Titel her auch als solcher ausgewiesen ist, um Rat nachsucht, mag von verschiedenen Faktoren abhängen.
Zunächst darf wohl davon ausgegangen werden, dass heute bei einer breiten Masse der Bevölkerung die Bereitschaft vorhanden ist, sich in allen für wichtig gehaltenen Dingen beraten zu lassen. Diesem Bedürfnis entsprechen auf dem Gebiet der Erziehung sog. Elternberater – gezielt für Eltern geschriebene Taschenbücher – aber auch Eltern- Familien- und Frauenzeitschriften, die entweder, wie die Zeitschrift „Eltern“, ausschließlich oder wie der „Ratgeber“ regelmäßig in eigenen Rubriken zu Fragen der Kindererziehung Stellung nehmen. Die Gründe für das Anwachsen der Beratungsliteratur, die eine Art Dolmetscherfunktion zwischen fachwissenschaftlichen Arbeiten zur Erziehung und rein an Erziehungsanweisungen orientierten Schriften einnimmt47, sollen hier nicht näher untersucht werden; es gehört jedoch schon fast zur Pflichtübung an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in einer sich wandelnden Gesellschaft, in der die tradierten Normen und persönlichen Erfahrungen des einzelnen beständig in Frage gestellt werden, Information und Beratung der Erwachsenen über Erziehung eine große Bedeutung erlangt haben. Hinzu kommt die zunehmende Pädagogisierung vieler Lebensbereiche, die zusätzlich für eine verstärkte Nachfrage nach Beratung sorgt48.
Zeitschriften, die für sich in Anspruch nehmen in kompetenter Weise Lösungen für alle familiären Probleme anbieten zu können, machen sich diese „Notsituation“ des „Verbrauchers“ zunutze. Sie vertrauen offensichtlich darauf, dass die Beratung in Erziehungsfragen nicht mehr nur im engeren Familien- oder Bekanntenkreis gesucht wird. Für viele Menschen ist es scheinbar leichter, sich mit ihren Problemen an „Dr. Brand“ oder „Frau Irene“ zu wenden, als an einen ihnen nahestehenden Menschen oder gar eine öffentliche Einrichtung, wie z.B. eine Familien- oder Erziehungsberatungsstelle.
Ratsuche in der Zeitschriftenberatung:
Was mag nun den einzelnen Ratsucher dazu veranlassen, sich Rat und Information gerade in einer Zeitschrift zu suchen? Gründe sozio-kultureller Art49 sollen hier nicht weiter erörtert werden. Behalten wir vielmehr die individuellen Motive des heutigen Lesers im Auge.
Der Leser ohne besonderes Interesse für Fragen der Erziehung mag wohl eher aus Neugier einen Blick in entsprechende Beiträge werfen und sich vielleicht nur hie und da informieren wollen wie andere „es machen“, ohne gleich Konsequenzen für sein eigenes Handeln zu ziehen. Der stärker Interessierte wird vergleichen und die eine oder andere Empfehlung für sein eigenes Verhalten in Erwägung ziehen. Dabei werden sich die meisten auch nur in der Richtung beeinflussen lassen, in die sie ohnehin schon vorher gehen wollten50. Dass ein Einfluss von Massenkommunikationsmitteln überhaupt unterstellt werden darf, dass in unserem Falle von der Zeitschriftenberatung eine Wirkung erwartet werden kann, macht E. Noelle-Neumann in einer Bemerkung zu diesem Thema deutlich. Aus zahlreichen Beobachtungen zieht sie den Schluss, „dass die Massenkommunikationsmittel einen um so größeren Einfluss auf das Denken und Handeln der Menschen haben, je mehr der gebotene Stoff, der Inhalt der Kommunikation, auf die Praxis des Alltags bezogen ist, oder je größer soziale und psychologische Bedeutung er hat“51.
Wir dürfen also ein allgemeines Interesse an Beratung, auch an Erziehungsberatung in Zeitschriften unterstellen. Und offenbar genügt vielen Menschen die allgemeine, unverbindliche Beratung nicht, sie suchen den brieflichen Kontakt zur personifizierten Beratung im sog. „Briefkasten“, den viele Zeitschriften verstärkt seit den 60er Jahren anbieten. Versuchen wir nun die Situation eines solchen Ratsuchenden näher zu beleuchten, denn sie wird uns Aufschluss über Inhalt und Form der Raterteilung geben.
Den Ratsuchenden veranlasst wohl zunächst die subjektiv empfundene Dringlichkeit seines „Falles“ sich um eine Beratung zu bemühen. Für viele Menschen mag dies nicht leicht sein, steht man doch in der Gefahr, sich, wenn auch anonym, eine Blöße zu geben, wenn man andere um Rat fragt und damit zugibt, dass man Probleme hat, die man selbst nicht meistern kann. „So scheuen sich manche Leute, ihre Sorgen vorzutragen, weil sie in einem kleinen Ort wohnen und fürchten, sie würden damit in der Öffentlichkeit oder Bekannten gegenüber bloßgestellt“52. Auch gilt es eine gewisse Schwellenangst zu überwinden, wenn man sich als Ratsuchender vertrauensvoll einem Unbekannten gegenüber öffnen und Schwächen sowie Fehler seinerseits zugeben soll53. Dabei mag die Anonymität der Illustriertenberatung dem Ratsuchenden noch einen gewissen Schutz geben, mehr als in der direkten Begegnung mit dem Therapeuten ist ihm hier ein Rückzug möglich, allerdings auch die Gefahr, dass man seinem Problem letzten Endes durch Nicht-Identifikation wieder ausweicht.
Problemdruck und allgemeine Akzeptanz von Beratung alle können aber noch nicht das Annehmen und Nutzen des Beratungsangebots erklären; hinzukommen muss beim Ratsuchenden die Überzeugung, dass er hierdurch seine persönliche Lage verbessern kann und dass der Berater für qualifiziert genug gehalten wird, ihn in seiner individuell besonderen und einmaligen Situation verstehen und damit helfen zu können.
Ob jemand um Rat nachsucht, wird natürlich auch davon abhängen, inwieweit man Kenntnis von der Möglichkeit einer persönlichen Beratung hat, was man beim Leser einer Zeitschrift mit Beratungsangebot allerdings voraussetzen kann. Ein Faktor übrigens, der in einer zunehmend „therapeutisierten“ Gesellschaft wohl an Bedeutung auch in den sog. unteren Bevölkerungsschichten verloren hat.
Viele werden jedoch trotz Problemdruck und der Überzeugung, dass ihnen geholfen werden könnte, nicht um Rat nachfragen, weil ihnen die form der Beratung nicht zusagt: Sich schriftlich oder mündlich, in Briefform oder im persönlichen Gegenüber zu äußern, und damit gegebenenfalls vor ein größeres Publikum zu treten, ist schließlich nicht jedermanns Sache. Wir dürfen daher annehmen, dass auch die Ratsuchenden in den Zeitschriften eine besondere Auswahl der Gesamtleserschaft ausmachen. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, wie eine solche Auswahl die Beratung in Form und Inhalt selbst wiederum beeinflusst.
Und letztlich mag es auch von der Attraktivität des Beratungsangebots und des Beraters abhängen, ob jemand den Mut findet, sich auf eine Beratung in einer Illustrierten einzulassen. Eine Vertrauen schaffende Maßnahme ist hier schon die Fotografie des Erziehungsberaters im Kreise seiner eigenen Familie, wie sie etwas im „Ratgeber“ zu finden ist oder auch die Vorstellung des Ratgebers anhand einer Kurzbiografie, die sowohl auf die berufliche Qualifikation Bezug nimmt als auch die Kompetenz qua Lebenserfahrung berücksichtigt (vgl. 9/69/1158). Der Ratgeber ist also dem Ratsuchenden in d. R. kein Unbekannter. Der Frager wendet sich vielmehr an „eine Autorität, die ihm aus veröffentlichten Antworten schon bekannt ist“54.
Was kann der Ratsuchende erwarten?
Wir können wohl annehmen, dass die Bereitschaft Rat anzunehmen beim Ratsuchenden schwindet, wenn er das Gefühl haben muss, dass er vom Berater weder mit seinen Problemen angenommen noch verstanden wird. Aus der Kritik an sog. „Kommunikationssperren“ hat man etwa für die partnerzentrierte Beratung folgende Verhaltenseigenschaften vom Berater gefordert (die ihn damit für den Ratsuchenden attraktiv machen):
emotionale Wärme, Akzeptieren und Achten des Klienten (Akzeptanz);
einfühlendes Verstehen (Empathie); und
Echtheit im Verhalten (Kongruenz).
Das Akzeptieren und Achten des Ratsuchenden erfordert vom Berater, dass er die Aussagen des Ratsuchenden nicht sofort negativ bewertet. Empathie heißt, dass der Berater sich in die Gefühlslage des Ratsuchenden einfühlen soll. Die emotionale Wärme des Beraters will besagen, dass dieser sich „echt“ verhält; seine Gefühle also, mit aller gebotenen Vorsicht natürlich, klar zum Ausdruck bringt55.
Hier wird nun deutlich, dass in der schriftlichen Kommunikation zwischen Berater und Ratsuchendem in der Zeitschriftenberatung diese drei Grundhaltungen des Beraters zwar auch durchgehalten werden56, aber doch nicht so zum Ausdruck kommen können, wie in der ‚face to face’ – Situation des verbal und nonverbal geführten Beratungsgesprächs. So sind gerade hier Gesprächsmethoden wie die Techniken des Paraphrasierens und des Verbalisierens emotionaler Erlebnisse, die zur Verbesserung der Beratung führen sollen, nicht oder doch nur sehr eingeschränkt möglich.
Der Verzicht auf eine persönliche Begegnung zwischen Ratsuchendem und Ratgeber ist jedoch auch und gerade unter therapeutischen Gesichtspunkten nicht ausschließlich negativ zu werten. Im Gegenteil: „Durch das Alleinsein beim Schreiben (eines Briefes, d. V.) ist man wie beim Tagebuch nicht gehemmt durch die unmittelbare Gegenwart eines Partners, wie dies beim Gespräch mehr oder weniger stark der Fall ist“57.
Was unterscheidet die Zeitschriftenberatung von anderen Beratungssituationen?
In der Zeitschriftenberatung erfährt der Berater und noch mehr das Publikum in d. R. wenig über die Normen und Wertvorstellungen, die sozialen, wirtschaftlichen, räumlichen und zeitlichen Abhängigkeiten, in denen der Ratsuchende steht und die sein Handeln, Denken und Fühlen beeinflussen58. Und das ist das Besondere dieser Art von Beratung: sie richtet sich eben nicht nur an den Ratsuchenden selbst, sondern auch an ein Publikum. So kann ein Fall schon im Interesse der noch anderen interessierenden Fälle nicht „ewig“ behandelt und ausgebreitet werden. Beschränkt sich der Kontakt zwischen Ratsuchendem und Ratgeber nicht auf ein einmaliges, druckwürdiges Ereignis, so bleibt dies doch dem Publikum in der Regel verborgen. Eine Kontrolle im Sinne katamnetischer Erhebungen ist hier jedenfalls noch weniger denkbar als im Rahmen einer Erziehungsberatungsstelle59. Vom therapeutischen Standpunkt aus mag der Wert einer solchen Kurzbehandlung angezweifelt werden. Und ist die Illustriertenberatung auch nicht selten nichts weiter als ein Frage- und Antwortspiel (mit Unterhaltungswert freilich) zweier mehr oder weniger anonymer Gesprächspartner, die, so zumindest der Berater, mit Blick auf das große Publikum agieren60, so lassen sich aber doch auch hier trotz unterschiedlicher Bedingungen im Vergleich zur „normalen gesprächsorientierten Beratung partnerzentrierte Grundhaltungen durchhalten. Das geht auch aus einer Befragung von Zeitschriftenberatern durch den Verfasser deutlich hervor: Danach gehört es zu den „guten Eigenschaften“ eines (Zeitschriften)Beraters „zwischen den Zeilen das eigentliche Anliegen zu finden“, „Einfühlungsvermögen“ zu zeigen, d. h. „beim oder im Ratsuchenden“ zu sein61.
Wir wollen uns jedoch nicht über therapeutischen Wert oder Unwert der Zeitschriftenberatung weiter auslassen, unser Interesse geht in eine andere Richtung62. Was den stark reduzierten Beratungsprozess der Zeitschriften-Beratung angeht, das individuelle und zeitlich prinzipiell unbeschränkte Eingehen auf die jeweilige Problemlage, ist für unsere Zwecke nun doch von Vorteil.
Verallgemeinerbare Normen und Werthaltungen spiegeln sich hier, wo sowohl einem einzelnen als auch einer breiten Leserschaft Rat, und zwar praktischer Rat, gegeben wird, deutlicher wieder als wir dies vom einmaligen Protokoll einer gesprächstherapeutischen Sitzung erwarten können. Die Zeitschriftenberatung, die ja keine persönliche Begegnung zulässt, muss „zwangsläufig pauschaler“ sein und „aus der Ferne allgemeine Ratschläge“ erteilen63.
Die Zeitschriften machen Beratungsangebote für aktuelle Lebensfragen, d. h., dass einzelne, vom Ratgeber der Leserschaft präsentierte Fallbeispiele, wiewohl sie immer auch den Einzelfall behandeln, doch repräsentativen Charakter für die Problemlage vieler haben64. Der Leser möchte und soll sich im vorgestellten Fall wiedererkennen und Nutzen aus der angebotenen Beratung ziehen65. So sieht denn auch der §Ratgeber“ seine Funktion schon im Titel der Zeitschrift eindeutig deklariert. „Den Lesern wird eine Vielzahl an Themen geboten in Form von praktischer Beratung und Anleitung, praxisnahen Tipps und Hinweisen sowie aktuellen Informationen.“66
Er kommt damit der Lesererwartung nach praktischer und realitätsgerechter Beratung und Information nach. Dass die Zeitung dieser Erwartung auch gerecht wird, zeigt sich in der hohen Übereinstimmung zwischen „genereller Themenerwartung und speziellen Themenangeboten.“67
So sieht sich denn auch der Ratgeber in Erziehungsfragen den Erwartungen einer Leserschaft ausgesetzt, die er nicht ignorieren kann. Es wäre wohl auch eine Überschätzung der Rolle der „Ratgeberonkel und –tanten“, wenn man annähme, sie hätten ihre „Pädagogik“ gegen die Zeit und nur aus ihrem Kopf herausgeschrieben.68 Vielmehr nimmt der Ratgeber auf, spricht aus und systematisiert, was das lesende Publikum seiner Zeit an Erziehungsvorstellungen besitzt und selbst wenn er gegen überkommene, traditionelle Vorstellungen anschreibt, versucht er doch lediglich Tradition und Moderne miteinander in Einklang zu bringen – niemals aber gibt er Rat „gegen die Zeit“.69
Seine praktischen Tipps verlangen von ihm, und damit unterscheidet er sich wesentlich vom „normalen“ Erziehungsberater und Psychotherapeuten, mehr oder minder eindeutige Stellungnahmen. Erleichtert wird ihm diese Aufgabe durch eine entsprechende Aufbereitung der für die Veröffentlichung vorgesehenen Leserbriefe. Aus „seitenlangen, ganz speziellen Lebensgeschichten“ muss „die Essenz herausgefiltert“ werden.70 In der Raterteilung muss der Ratgeber dann ein Doppeltes leisten: er übermittelt eine Norm vom „richtigen Verhalten“ und er macht Vorschläge darüber, wie sie zu erfüllen ist.71
Was ist „richtiges“ Verhalten?
Woher bezieht er nun seine Vorstellungen vom „richtigen“ Verhalten und wie begründet er seine Raterteilung? Nach Auskunft der Ratgeber durch Verweis auf „pädagogisch-psychologische Erkenntnisse“ und „persönliche Lebenserfahrung“.72 Der Vergleich über mehrere Jahrzehnte hinweg wird zeigen, dass die Gewichtung dabei historisch bedingt ist und dass etwa die „wissenschaftliche“ Begründung die auf Alter und Lebenserfahrung rekurrierende zunehmend zurückgedrängt hat.
Natürlich versucht jeder Ratgeber, das verlangt sein journalistisches Engagement von ihm, in den Augen seiner Leser „unverwechselbar“ zu sein73, doch kann er bei allem persönlichen Einsatz und aufklärerischem Impetus sowohl die Lesererwartung als auch die Leitlinien seiner Redaktion nicht unberücksichtigt lassen. Und so ist trotz aller möglichen individuellen Unterschiede in der Person des Beraters, trotz persönlicher Vorlieben und Eigenheiten, zu erwarten, dass sich in den Ratgeberrubriken und den einschlägigen Beiträgen zu Erziehungsfragen ein Bild von dem, was in der familiären Sozialisation und Erziehung aktuell „Mode“ ist und gelten soll, wiederspiegelt. Diese Vermutung wird durch die Berater-Befragung gestützt: Zeitschriftenberater sind in d. R. hauptberuflich in der Erziehungs- bzw. Familienberatung tätig und wissen aus ihrer täglichen Praxis „vor Ort“, was den Ratsuchenden „auf den Nägeln brennt“.74
Und unabhängig von den Leitlinien der Zeitschrift werden sich, über Jahre hinweg beobachtet, Änderungen in den Standards des Verhaltens, wie sie in der Familie von den Eltern an die nachwachsende Generation übermittelt werden sollen, feststellen lassen. Da nun die Kommunikationsinhalte in der Regel stark auf das breite Publikum abgestimmt sind – denn nur solche Inhalte werden sich behaupten, die vom Publikum auch angenommen werden – ist zu vermuten, dass sich in den Beiträgen des „Ratgebers“ zur Erziehung weitgehend die ‚cultural patterns“ seiner Leserschaft wiederspiegeln.75 Diese sog. Reflexionshypothese dürfte allerdings nicht uneingeschränkt gelten, denn sie setzt voraus, dass die ‚cultural patterns’ des Publikums die Kommunikationsinhalte wesentlich beeinflussen. Ein flüchtige Durchsicht der „Ratgeber“-Empfehlungen zur Erziehung vermag jedoch schon deutlich zu machen, dass sowohl die Wünsche bzw. der Geschmack des Publikums berücksichtigt werden als auch „ratgebereigene“ Zielvorstellungen in die Kommunikationsinhalte einfließen. Das ist bei einer Zeitschrift, die erklärtermaßen nicht der bloßen Unterhaltung dienen, sondern in erster Linie informieren und belehren will, auch nicht weiter verwunderlich. Der Reflexionshypothese ist also zumindest eine Kontrollhypothese entgegenzuhalten, wonach umgekehrt auch die Kommunikationsinhalte beim Publikum Veränderungen bewirken oder dies doch wenigstens beabsichtigen. Die Zeitschrifteninhalte sind dann nicht bloße Reflexion der sog. ‚Sitten und Gebräuche des Volkes’, sondern versuchen diese von sich aus zu beeinflussen und zu strukturieren. Da es jedoch nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, Aufschluss über die Erziehungsstandards der Rezipienten des „Ratgebers“ zu erhalten, können wir hier die Frage nach dem Wert oder Unwert dieser beiden Thesen vernachlässigen. Es kann wohl auch in dieser Sache weniger von einem ‚entweder oder’ als eher von einem ‚sowohl als auch’ die Rede sein.
Gleichgültig ob nun der „Ratgeber“ eher die impliziten Werte und Verhaltensvorschriften seines Publikums spiegelt oder eher selbst determinierend auf seine Leserschaft einwirkt, er und mit ihm die Ratgeberrubriken aller Zeitschriften bieten heute einem breiten Publikum das, was den Anstandsbüchern des 18. Und 19. Jahrhunderts ein Anlegen war: der sich bildenden, lesenden Schicht der Bevölkerung die für allgemein gültig gehaltenen Standards zivilisierten Verhaltens und „guter“ Erziehung zu vermitteln.
Zur Strukturierung der Raterteilung: Der „Briefkasten“
Hauptquelle der Untersuchung sind die sog. „Briefkästen“. In ihnen beantwortet ein Psychologe Leserfragen. Sie finden sich im „Ratgeber“ gut platziert in der Heftmitte. Auf zwei bis drei, manchmal vier Seiten werden zumeist ein bis zwei Problemfälle unterschiedlicher Thematik behandelt.
In geraffter Form wird das anstehende Problem dargestellt: der Erziehungsfachmann/frau versucht im Anschluss daran eine Antwort zu geben. Beide Textteile, die Frage und die Antwort, sind deutlich durch die Verwendung verschiedener Schriftarten und durch die Kennzeichnung wörtlicher Rede voneinander getrennt.
Die auszugsweise wiedergegebenen Briefe – es fehlen Anrede und Grußformel – sind zu einem lesbaren Text zusammengestellt und vermitteln in der Beschreibung persönlicher und privater Verhältnisse Authentizität und unmittelbare Betroffenheit. Das in Frage stehende Erziehungsproblem wird ohne Umschweife angesprochen: „Überall, wo unsere zwölfjährige Tochter auftritt, in der Schule, zu Hause, unterwegs bei den Besuchen, fällt sie auf. Eine Zeitlang war es ihre Gewohnheit, an den Haaren zu drehen. Dann musste sie sich wochenlang dauernd räuspern oder fortwährend ein Taschentuch in der Hand halten. Gegenwärtig hat sie, wie der Arzt feststellte, einen Blinzel-Tick...“ (10/75/1156).
Es folgt in der Regel eine Betroffenheitsoffenbarung des Ratsuchenden: „Sie können sich vorstellen, dass uns dieses Verhalten... unangenehm ist.“ (s. o.). Die Eltern, meist die Mutter, schildern dann ihre bisherigen erfolglosen Bemühungen das unerwünschte Verhalten ihres Kindes abzustellen. Der Brief endet häufig mit der Feststellung, dass man nun keinen Rat mehr wisse.
Die Antwort des Ratgebers beginnt fast ausnahmslos mit einer zusammenfassenden Darstellung des Problems, wobei nicht versäumt wird, Verständnis und Anteilnahme an die Adresse des Briefschreibers zu signalisieren. Die ‚guten Absichten’ des Ratsuchenden werden positiv verstärkt, die bisherigen Bemühungen um Abhilfe entsprechend gewürdigt: „Sie haben, wie Sie mir mitteilen, bisher immer darauf geachtet und verlangt, dass Ihre Tochter sich den Regeln menschlichen Zusammenlebens anpasst. Sie wollen eine sehr gut erzogene Tochter haben, die sie ja auch geworden ist. Sie wird überall für ihr gutes Benehmen gelobt, eine Eigenschaft, die heute bei vielen nicht mehr hoch im Kurs steht...“ (s. o.).
Einstieg und Ton sind in fast allen Antworten der Berater gleich. Mitarbeiter der Zeitschrift „Eltern“ bezeichnen das „Einstellen auf die Wellenlänge“ des Schreibers als den ersten und wesentlichen Teil der Arbeit eines Zeitschriftenberaters.76 Es komme darauf an, den Ratsuchenden nicht nur rational, sondern vor allem auch emotional zu erreichen.
Nach der ersten, vorwiegend emotionalen ‚Einstellung’ des Beraters auf die Leserfrage und die Person des Lesers, folgt eine sachlich-psychologische Erklärung des kindlichen Verhaltens: „Jeder Mensch verfolgt bekanntlich eigene Ziel, hat eigene Vorstellungen und auch Wünsche. So stehen Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit vielfach im Vordergrund. Bei der Erziehung werden jedoch die eigenen Triebe meist unterdrückt, was sich besonders in den ersten Lebensjahren ungünstig auf die weitere Entwicklung auswirken kann...“ (10/75/1156).
Der Berater vermeidet es jedoch die Ursachen des angesprochenen Fehlverhaltens auf bestimmte Umstände einzuschränken77, vielmehr wird oft eine ganze Palette möglicher Gründe angeführt: „Diese Umstände sind aber keineswegs die Ursache für die Nervosität vieler Heranwachsender. Vielmehr spielt hier die Veranlagung eine wesentliche Rolle... So vererben sich zum Beispiel der ‚Appetit’ auf Fingernägel, hastiges und nervöses Sprechen, unruhige Handhaltung und vieles mehr.“ (10/75/1156).
Aber auch besondere Sozialbeziehungen können als mögliche Ursache herangezogen werden: „Da auch Ihre Tochter allein aufwächst, sei hier nochmals erwähnt, dass wir Eltern dem einzigen Kind häufig mehr Aufmerksamkeit schenken, als dies bei einer größeren Familie der Fall ist. Wir geben gute Ratschläge, überwachen im Interesse des Kindes, ob sie richtig ausgeführt werden, regen (zu viel) an, greifen (zu oft) ein, was uns natürlich nicht immer bewusst ist. Obwohl wir es mit einer solchen Erziehung ernst und gut meinen, entsteht ein psychischer Druck, der sich schließlich in den von Ihnen genannten Symptomen äußern kann.“ (s. o., S. 1157).
Auffallend ist, wie sich der Ratgeber bemüht seine Antwort nicht zum Vorwurf an die Eltern geraten zu lassen. Das verbindende „Wir“ entlastet, mildert ab und bringt zum Ausdruck, dass wir alle, auch wenn wir es gut meinen, nicht vor Erziehungsfehlern gefeit sind.
In der Haltungsanalyse der elterlichen Aussagen werden also positive Formulierungen und Verständnis für Fehler besonders wichtig genommen, um die Eltern und potentielle Ratsuchende nicht zu verprellen. Der Briefschreiber soll ja nicht verärgert, sondern nachdenklich gemacht werden. „Formulierungen in der Möglichkeitsform und der Frageform sind dazu oft am besten geeignet.“78
Gegen Ende einer Antwort wird der Ratgeber nicht umhin können den fragenden Eltern eine Empfehlung zu geben. Ihr gilt in dieser Untersuchung ja vor allem unser Interesse. Im oben angeführten Fall aus dem „Ratgeber“ fällt die Antwort so aus: „Sie sollten also den Mut finden, mehr auf die Vorschläge und Initiativen des Kindes einzugehen, auch wenn am Anfang vielleicht manches danebengehen wird. Da Ihre Tochter ja keine schlechte Schülerin ist, sollten Sie ihr mehr freie Hand lassen, weniger Kontrolle ausüben, nicht dauernd fragen und bohren. Damit geben Sie ihr die Möglichkeit, Vertrauen zu sich selbst zu finden, sicherer zu werden, die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Dies dürfte im Endeffekt zu einer sichtbaren inneren und äußeren Ruhe führen. Im übrigen wäre es gut, künftig das, was Sie an Ihrer Tochter auszusetzen haben, für sich zu behalten.“ (s. o., S. 1157).
Die Eltern brauchen also an ihrem erwünschten Verhaltensziel, ‚innere und äußere Ruhe der Tochter’, keine Abstriche zu machen; geändert werden sollten jedoch Einstellung und Verhalten. Für Eltern und Tochter lassen sich im angeführten Fall im einzelnen folgende Normen des Verhaltens abstrahieren:
für die Eltern:
Akzeptanz und Empathie (Kinder annehmen wie sie sind, auf Vorschläge und Initiativen der Kinder eingehen)
Zurücknahme von Überwachungs- und Kontrollfunktionen (den Kindern freie Hand lassen, weniger Kontrolle ausüben)
Zurückhaltung in erziehlicher Hinsicht (nicht dauernd fragen und bohren, für sich behalten, was man auszusetzen hat)
für die Tochter:
Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung (Vorschläge machen, Initiativen ergreifen, den Wert der eigenen Person erfahren)
Freiheit durch Leistung (sich Freiheiten durch gute Schulleistungen verdienen)
Mitunter kommt es vor, dass der besprochene Problemfall für so schwerwiegend angesehen wird, dass eine ‚Lösung’ allein durch die Zeitschriftenberatung nicht möglich ist. Problematische Briefschreiber und solche, bei denen die Probleme der Kinder vermutlich neurotisch sind, werden dann an Erziehungsberatungsstellen verwiesen.