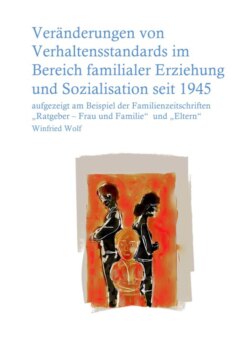Читать книгу Veränderungen von Verhaltensstandards im Bereich familialer Erziehung und Sozialisation seit 1945 - Winfried Wolf - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Sozialisation und Erziehung in der Jugendzeit
ОглавлениеProblemverhalten und Krisen der Erziehung:
Mit der Jugendzeit, der stärkeren Orientierung der Kinder und Jugendlichen an Dingen außerhalb der Familie, mit der allmählichen Ablösung vom Elternhaus, erwachsen den Eltern neue Problembereiche und Aufgaben der Erziehung.
Waren Kinder im Alter von 10, 11 Jahren für ihre Eltern noch Anlass zu ungetrübter Freude, da sie deren Ansichten „noch ohne Vorbehalte“ übernahmen (vgl. 9/61/884), so ist zu ihnen im Alter von 12 bis 16 Jahren „kaum ein inniges Verhältnis“ zu gewinnen. „Kluge Eltern vermeiden es daher, die Nase in ihre Geheimnisse zu stecken“. Empfohlen wird: Nicht zu viel fragen und keine Ratschläge geben, um die man nicht gebeten wird. Dennoch sollte man, meint der Ratgeber „den jungen Menschen auch in diesem Alter (16 Jahre, d. V.) noch nicht zu viel Verantwortung geben, denn sie sind in ihrem Urteil noch unreif.“ (9/61/885)
Das Bild der Jugend im Ratgeber der 50er Jahre ist uneinheitlich; die Skepsis allerdings überwiegt. Aus der Schule wird berichtet, viele Lehrer stellten fest, dass die „Oberflächlichkeit“ geradezu zu den Merkmalen ihrer Schüler gehöre (vgl. 5/60/454). Es wird die Befürchtung geäußert, dass eine „Generation der Anspruchslosen“ heranwachse, „die eigenes Bemühen für ‚lästig’, ja überflüssig hält, sofern es sich nicht um die mit Leidenschaft betriebenen Steckenpferde handelt... Der Großteil“, urteilt der Ratgeber, „huldigt gleichmütig dem Ideal der Lässigkeit, denn erwiesenermaßen geht es ‚auch so’.“ (vgl. 5/60/454)
Damit wird ein Thema angesprochen, das schon Mitter der 50er Jahre aktuell war, die „Halbstarken“, oder wie es in einer bereits ‚erklärenden’ Wortschöpfung heißt, die sog. ‚Luxusverwahrlosung’. Sie hat, wie uns der Ratgeber aufklärt, „keinerlei aus wirtschaftlicher Not geborene Gründe, sondern ganz im Gegenteil nicht zuletzt darin ihren Ursprung..., dass es den Betroffenen zu gut geht.“ Das überhitzte „Tempo der Zeit“, „Mechanisierung“ und „Überbeanspruchung durch berufliche, geschäftliche oder gesellschaftliche Pflichten“ sind Kennzeichen der Zeit und tragen ihren Teil zur Verschärfung des Problems bei. „Wie aber soll ein Vater“, fragt der Ratgeber, „der an den meisten Tagen der Woche kaum zu Hause ist..., eine Mutter, die vielleicht selbst noch halb- oder ganztags als Sekretärin oder Geschäftsfrau... arbeitet... ihrem Kind eine wirkliche Mutter sein?“ (vgl. 11/56/688) Dazu komme nach Auskunft des Ratgebers nicht selten noch das „Bestreben dem Kind das leben so bequem wie möglich“ zu machen. Wohin das führen kann, zeige der Schriftsteller H. Springe in seinem Roman „Geliebte Söhne“: Falsch verstandene Vaterleibe endet für den Sohn Oliver am Galgen. Der Ratgeber zieht daraus für seine Leser die Lehre, „dass man seinem Kind nicht nur Annehmlichkeiten, sondern auch Aufgaben und Pflichten gibt und es zu der Einsicht erzieht, dass man sich die Annehmlichkeiten selbst erst verdienen muss.“ Schon den kleinen Kindern müsse man lehren, „dass es noch andere und wertvollere Dinge auf der Welt gibt als Genuss und Großverdienen.“ (vgl. 11/56/688)
Ein etwas anderes Bild der Jugend zeichnet der Ratgeber im Oktoberheft des Jahres 1957. Danach sind „heutige Jugendliche... kritisch, sachlich, lebenstüchtig und tapfer. Sie sehen klar die unerbittliche Wirklichkeit unserer Zeit und stellen sich auf sie ein, ohne Sentimentalität, aber auch ohne Angst vor dem, was das Leben ihnen abfordern wird.“ (vgl. 10/57/670)
So sehr nun aber der „Sinn für die Realitäten“ bei den Jugendlichen geschätzt wird, ganz ‚geheuer’ scheint er den Erwachsenen, deren „Partei“ der Ratgeber vertritt, doch nicht zu sein: „Sie (die Jugendlichen, d. V.) scheinen uns manchmal allzu praktisch, allzu sehr Rechner und Materialisten mit ihrem fest abgesteckten, handgreiflichen Zielen“ zu sein. Und im gleichen Beitrag beklagt der Ratgeber stellvertretend für viele Väter, dass die Jugendlichen „keine Ideale“ mehr besäßen und kritisiert „das Phlegma der Jungen, die sich weder erregen noch begeistern könnten.“ (vgl. 10/57/670)
Hygiene, Kleidung und äußeres Erscheinungsbild:
Im Alter von 12, 13 Jahren wächst bei den Kindern der Wunsch, sich nach „eigenem Geschmack“ zu kleiden; zum eigenen Körper muss eine neue Einstellung gefunden werden. Das betrifft – überblickt man die Beiträge im Ratgeber, vor allem die Mädchen. So kann es passieren, dass eines Tages, wie uns der Ratgeber berichtet, die dreizehnjährige Tochter „ganz plötzlich rebelliert“ und nach „Kaltwelle“ und „modischem Schuhwerk“ verlangt, „weil die halbe Klasse schon „moderner“ sei als sie (vgl. 4/54/182). Hier nun erheben die Väter Einspruch und zwar „mit Recht“, wie der Ratgeber meint. Denn das moderne Mädchen im positiven Sinn „ist mit allem versehen, um immer sauber und gepflegt im Unterricht zu erscheinen.“ Sie trägt „glattes Haar“, im Handtäschchen hat sie „erfrischendes Talkpuder mit dezentem Duft“, ein „abwaschbares Chintz-Kosmetiktäschchen mit Seife“, „Kölnisch Wasser“, ein „Döschen Heilsalbe“, „Watte, Spiegel, Kamm“ sowie ein „Manikür Etui“ (s.o.).
In Fragen der Bekleidung „kann sie ihre Wünsche äußern und wird geschmacklich sacht in die Richtung gelenkt, die ihrem Typ am vorteilhaftesten ist“.“(vgl. 4/54/182)
Diese Sicht vom „modernen“ Mädchen scheint sich jedoch noch nicht allgemein bei den Eltern durchgesetzt zu haben, denn der Ratgeber lässt im gleichen Beitrag wissen: „In den meisten Familien ist der Gebrauch einer Serviette und die Benutzung von Messer und Gabel den Kindern von klein auf vertraut, Kosmetikwünsche dagegen werden von den Eltern häufig mit hochgezogenen Augenbrauen als völlig verfrüht überhört. Körperpflege will jedoch“, so der Ratgeber, „ebenfalls von jung auf geübt sein und nicht plötzlich mit neunzehn Jahren begonnen werden“.
Eine große Gefahr sieht der Ratgeber allerdings in der „Teenagerei“ am Ende der 50er Jahre auf die Jugend zukommen. Er weiß zu berichten, dass dieses von „geschickten Managern“ erfundene Klischee „bereits zu heftigen Reaktionen“ geführt hat. Die Eltern verspürten diesen „eigenen Stil“ der Jugend u. a. daran, „dass die bereits ihr eigenes Geld verdienenden Söhne und Töchter zu Hause mehr und mehr als Stützen des Familienhaushalts ausfallen“ und dass jene, die noch in der Ausbildung stehen, „ungeduldig und unzufrieden“ werden (vgl. 4/60/306). Die „allerorts angepriesenen neuen Teenager Korseletts ‚in allen Modefarben’“, so befürchtet der Ratgeber, würden überdies „die Figur noch mehr auf Sex trimmen“ als bisher schon (vgl. 4/60/307).
Umgangsformen:
Über eine um sich greifende Unsitte im Umgangston berichtet der Ratgeber in Heft 5 vom Jahre 1959, nämlich „die taktlose Manier, wildfremde ältere Leute mit ‚Oma’ und ‚Opa’ anzureden“. Nach Ansicht des Ratgebers fehle leider manchen Menschen der Sinn dafür, das Private im Umgang mit Fremden auszuschalten. „Seien wir also“, empfiehlt er, „bei Anreden lieber etwas zu formell als familiär, schließlich haben es die älteren Menschen verdient, dass man ihnen mit Respekt entgegenkommt“.“(vgl. 5/59/407)
Im Umgang mit dem anderen Geschlecht wird den jungen Mädchen geraten „jene weibliche Zurückhaltung“ zu zeigen, „die einen Spaß fröhlich mitmacht, aber immer weiß, wo er seine Grenzen hat.“ (vgl. 11/54/487)
Der Ratgeber verweist auf „das Gefühl für weibliche Würde und Selbstachtung, das nicht herausfordert, sondern leise an die wohl in jedem anständigen Mann schlummernde Bereitschaft, Schwachen zu helfen, appelliert....“ (11/54/487)
Seine Grenzen kennen, Zurückhaltung wahren und Respekt zeigen im Umgang mit älteren Menschen – das sind die Haltungen in den Formen des Umgangs mit anderen, die der Ratgeber seinen Lesern ans Herz legen will.
Freizeitverhalten:
Wie soll bzw. kann der Jugendliche seine Freizeit gestalten? Ein Thema, welches dem Ratgeber angesichts der ausgemachten Gefährdungen für Jugendliche als besonders brisant erscheint. Mit der Einführung der 5-Tage-Woche und dem damit verbundenen Zuwachs an Freizeit gewinnt dieser Problembereich für den Ratgeber zusätzlich an Bedeutung. „Gefährdet sind in dieser Hinsicht“, schreibt der Ratgeber 1957, „vor allem die heranwachsenden jungen Menschen, denen es vielleicht noch an Einsicht über den Wert oder Unwert der Dinge mangelt oder an seelischem Halt in der Familie und nicht zuletzt an den mancherlei Möglichkeiten der Erwachsenen ihre Freizeit auszufüllen durch die Pflege und Betreuung etwa eines Gartens... Wenn solche jungen Menschen erst einmal Gefallen gefunden haben an seichter oder sinnloser Unterhaltung, wird es nicht leicht sein, sie für andere, bessere Dinge zurückzugewinnen.“ (vgl. 6/57/377)
Was ist also zu tun? Der Ratgeber meint: „Je eher eine kluge, unmerkliche Lenkung nach dieser Richtung (Erziehung zum guten Geschmack und „sinnvoller“ Freizeitbeschäftigung, d. V.) einsetzt, desto größer wird der Erfolg sein“ (vgl. 6/57/377). Doch was ist unter einem „sinnvollen“ Freizeitverhalten zu verstehen oder anders gefragt, wie sollen sich Jugendliche in ihrer Freizeit nicht verhalten?
Sehen wir uns dazu ein Beispiel zum Thema „Feste feiern“ an. Im Februarheft vom Jahre 1956 nimmt der Ratgeber den Fasching zum Anlass für einige kritische Bemerkungen: „Der moderne Mensch sieht in der Faschingszeit nur eine Zeit des Übermuts, der Tollheit und gibt sich mit dem Narrenbrief selbst einen Freibrief für das, was er vielleicht des Guten zu viel tut“ (vgl. 2/56/74). Den Eltern wirf vorgehalten: „Der junge Mensch wird heute viel zu früh in den Trubel der Faschings-veranstaltungen hineingezogen... Der erste Ball, der früher für eine 17jährige erster Höhepunkt ihres jungen Lebens war, ist heute für sie vielfach längst ‚kalter Kaffee’! Sehr oft“, weiß der Ratgeber zu berichten, „enden diese vorzeitigen Ausflüge... mit einer Katastrophe, vor der dann die verantwortlichen Erzieher fassungslos stehen.“ (s. o.) Hier nützt „eine kluge Lenkung des jugendlichen Vergnügungsdranges und der Versuch, den Heranwachsenden zu Hause das zu geben, was sie sonst außerhalb des Hauses suchen würden.“(s. o., S. 76) Allerdings sei dieses Problem nach Meinung des Ratgebers nur schwer zu lösen, würden doch die Erwachsenen vom „Hetztempo“ und den Anforderungen der Zeit mehr in Anspruch genommen, als dies bei früheren Generationen der Fall gewesen sei. Doch gibt es „Auswüchse der Lustigkeit, denen schon eine vernünftige Erziehung im Elternhaus vorbeugen kann“ (vgl. 2/56/76). Mit besonderem Hinweis auf die Rolle des Alkohols dürfe überdies nicht vergessen werden, dass dieser „die verhängnisvolle Eigenschaft hat, unsere Selbstkritik einzuschläfern und sehr schnell vom ‚schwingengebenden’ Zauberer zum bösen Teufel zu werden“ (s. o.).
Dass es die Elterngeneration der 50er Jahre mit den Heranwachsenden unter den gegebenen Umständen besonders schwer hat, wird immer wieder im Ratgeber hervorgehoben und allzu oft werde vergessen, „dass eine genussgierige Umwelt heute mehr Reize an die Heranwachsenden heranträgt, als das früher der Fall war. Wenn wir aber bedenken“, fährt der Ratgeber fort, „dass unsere eigenen Töchter und Söhne zu den Gefährdeten gehören, weil wir daheim vielleicht versäumten, ihren noch schwankenden Willen rechtzeitig zu schulen und zu stützen, dann ahnen wir die Größe der auf uns liegenden Verantwortung.“ Und zusammenfassend fordert der Ratgeber: „Kinder müssen maßhalten lernen auch in den erlaubten Genüssen... Schon das Schulkind muss lernen... auch auf das Erlaubte freiwillig zu verzichten“ (vgl. 10/56/667).
Lassen wir zum Schluss dieses Abschnittes eine Mutter im Ratgeber noch ihre besondere Sorge mitteilen. Die Tochter will in die Tanzstunde gehen. Ihre Mutter berichtet: „Mir wurde etwas bange. Ich dachte an die wilde Horde junger Leute, die wir kürzlich in einem Lokal tanzen sahen und die sich so in das Vergnügen hineinwarfen, dass das nicht gutgehen kann. Man spürte förmlich“, erzählt uns die Mutter weiter, „die vielerlei Gefahren. Mir ist mein Mädel zu schade für so etwas“. Die ängstliche Frage der Mutter: „Soll die Tanzstunde der Anfang sein zu einem schlechten Weg?“ (vgl. 8/57/572).
Ein Verbot der Tanzstunde würde jedoch nach Meinung des Ratgebers möglicherweise dazu führen, dass das Mädchen in der Jugendgruppe in eine „Außenstellung“ gedrängt würde, gegen die ‚altmodischen’ Eltern einen Groll hegt und das Verbot für sie erst seinen „Reiz“ bekommt. Die von der Mutter gesehenen Gefährdungen mag nun aber auch der Ratgeber nicht leugnen, wenn ihnen auch der Junge „wesentlich mehr ausgeliefert“ ist als das Mädchen. Denn es liegt „in seiner Natur, durch aufreizende Musik und eine schwüle Atmosphäre leicht erregt und in seinen Sinnen entzündet zu werden“ (s. o.). Dies kann „schwere Konflikte“ für ihn bringen. Im Vergleich zum Jungen sei dagegen das Mädchen „wesentlich kühler und weniger gefährdet“. Den Eltern aber empfiehlt der Ratgeber „doch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Erziehung und zu dem Guten in unserem Sohn oder unserer Tochter“ zu haben. Die Eltern sollten vielmehr ihren Kindern Gelegenheit bieten, „sich in den mannigfachen Versuchungen... zu bewähren“. Sie sollten ihrem Kind helfen „auf dem rechten Weg zu bleiben, indem sie ab und zu gemeinsam mit ihm zu solchen Veranstaltungen gehen.“ Sie haben dann auch Gelegenheit die Gefährten ihrer Kinder kennenzulernen (vgl. 8/57/572).
Umgang mit den Medien – Medienerziehung:
Mit großen Vorbehalten steht der Ratgeber der 50er Jahre den Medien in ihrer Wirkung auf Kinder und Jugendliche gegenüber. Vor allem Film und Fernsehen stehen in Verdacht zu verführen, falschen Vorbildern zu dienen und im schlimmsten Falle zu „Raub und Mord“ anzustiften. Worin aber lauert nun eigentlich die vielbeschworene Gefahr? „In der Scheinwelt des Films und in der Nachahmung der Schauspieler“, klärt der Ratgeber seine Leser auf. (vgl. 6/56/348) „Da wir aber in einer harten und unbarmherzigen Alltagswelt leben, muss der junge Mensch mit seinen falschen Vorbildern und seiner fehlgeleiteten Schau vom Leben in Schwierigkeiten und Konflikte geraten.“ (s. o.) Nach Meinung des Ratgebers gehöre bis zum 8. Lebensjahr kein Kind in ein Kino, denn es sei weder „geistig in der Lage“ dem Geschehen auf der Leinwand zu folgen noch könne es „körperlich“ die Wirkung der „flimmernden Bilder“ mit den Tönen verarbeiten. Verantwortungsbewusste Eltern sollten sich auch nicht durch kindliche Bitten erweichen lassen die Kinder in einen Märchenfilm zu schicken. Bei älteren Kindern empfiehlt der Ratgeber: „Lass dein Kind nicht zu oft ins Kino und möglichst nicht allein.“ (s. o., S. 350)
Natürlich gibt es auch sehenswerte Filme, die „fördernd“ wirken können. Gedacht ist vor allem an Kulturfilme, an Landschafts- und Tieraufnahmen. „Soll man den Kindern wirklich die Illusion nehmen?“, fragt der Ratgeber am Schluss seines Beitrages. „Ja, man muss es sogar – will man die schädigenden Einflüsse bannen und die jungen Menschen für ihr Leben nicht unglücklich machen.“ (vgl. 6/56/350)
Eine neue Gefahrenquelle und ein Angriff auf das Familienleben wird im Fernsehen gesehen, das Mitte der 50er Jahre in der Bundesrepublik seine Ausbreitung begann. Auch hier bezieht der Ratgeber eindeutig Stellung: „Wenn wir versuchen“, so lesen wir in Heft 11 vom Jahre 1954, „unseren Kindern ein ruhiges, glückliches und geborgenes Leben in ihrer kleinen Welt zu erhalten, so lange das nur möglich ist, so werden wir, zumindest für sie, das Fernsehen ablehnen müssen. Kinder haben“, so wird argumentiert, „von selbst eine so reiche Phantasie... Für uns Erwachsene mag es anders aussehen...“ (s. o., S. 488)
Einen möglichen Einwand, wonach Radio und Fernsehen die Familie, die sonst allabendlich „in die verschiedensten Richtungen“ auseinandereile, wieder mehr zusammenführe, lässt der Ratgeber nicht gelten. (vgl. 11/54/488) Auch aus der „an sich segensreichen“ Erfindung des Rundfunks ergeben sich für den Ratgeber „böse Gefahren“, nicht zuletzt für die Kinder. Durch die „Überflutung mit fremden Ideengut“, durch das „Trommelfeuer der Töne“, kann der Rundfunk „zu geistiger Unselbständigkeit und Passivität verführen.“ (vgl. 7/57/501) „Es wird also darauf ankommen, was unsere Kinder im Rundfunk hören und vor allem auch darauf, dass sie mit Maß hören lernen... Der ‚Verzicht in der Kinderstube’, meint der Ratgeber, „muss auch für das Rundfunkhören gelten“ (s. o.) Den Eltern wird geraten, auch die größeren Kinder vor Sendungen zu bewahren, die einen ungünstigen Einfluss auf sie ausüben könnten.
Geschlechtsspezifische Sozialisation und Erziehung:
Der Ratgeber als Frauen- und Familienzeitschrift widmet der Mädchenerziehung naturgemäß mehr Raum als der Sozialisation und Erziehung der Jungen. Uns erwächst daraus für die Darstellung jedoch kein schwerer Nachteil, erfahren wir doch aus der Vorstellung des einen ‚Parts’ genügend über die Rolle des anderen. Die Rollenverteilung zwischen Mädchen und Jungen ist recht eindeutig gezeichnet. Unschlüssigen Eltern, die beispielsweise nicht wissen, was sie ihren Kindern zum Weihnachtsfest schenken sollen, wird in Erinnerung gerufen: „In jedem Mädchen steckt ein kleines Hausmütterchen... Denken wir... an die vielen kleinen Puppenmuttis... Jungen sind im Allgemeinen mehr für technische Sachen zu begeistern.“ (vgl. 12/56/762)
Das „Hausmütterchen“ im Mädchen wird jedoch, so befürchtet der Ratgeber, von den Mädchen selbst nicht mehr allzu hoch geschätzt. Mädchenerziehung ziele leider mehr und mehr „auf die Berufserziehung und dann erst auf die Erziehung zur eigentlichen Aufgabe der Frau, wie sie früher als selbstverständlich galt: einmal zu heiraten, einen Haushalt zu führen und Kinder großzuziehen.“ (vgl. 8/54/338) Es fehle, wie der Ratgeber meint, eine Vorbereitung auf die „psychologische Aufgabe“, die Ehe und Familie an die Mädchen stellen werde. Mahnend wird daran erinnert, wie viele Ehen schon daran zerbrochen sind, „dass an sich begabte und tüchtige Frauen auf allen diesen Gebieten versagten.“ (s. o.) Die Mütter hätten es selbst in der Hand, inwieweit sie ihren heranwachsenden Töchtern „statt sie aus Schwäche oder aus falschem Stolz auf das ‚gelehrte Fräulein Tochter’ vor jeder Berührung mit Hausarbeit zu schützen“ eine gewisse Grundlage an hauswirtschaftlichen Kenntnissen mitgeben zu wollen. (vgl. 8/54/838)
„Schön ist es“ daher auch, findet der Ratgeber, wenn von einem jungen Mädchen ein Beruf gewählt wird, „der die weiblichen Eigenschaften zur Entfaltung kommen lässt, also Berufe, die mit Menschen, Kindern, Pflanzen, Tieren zu tun haben.“ (vgl. 3/56/148) In vielen Berufen, die ausschließlich den „Verstand der Frau“ beschäftigen, mache sich, das zeige die Erfahrung, nach einigen Jahren „das Gefühl und Bedürfnis nach etwas zu Umsorgendem, zur Bestätigung der fraulichen Wärme und Güte, stark geltend.“ Es sei deshalb gut, meint der Ratgeber, wenn die Eltern für ihre Tochter einen Ausbildungsweg finden, „der ihr Freude macht, nicht nur des Geldes wegen gewählt wird und gleichzeitig ihrer Vorbereitung auf eine eventuelle Ehe dient.“ (3/56/148)
Liebe, Freundschaft und Freiheitsstreben:
Dem Thema Liebe und Freundschaft unter Jugendlichen widmet man sich im Ratgeber der 50er Jahre nur gelegentlich und eher am Rande. Tanzlokalen, Geburtstags- oder Faschingsfeiern als Gelegenheiten und Stätten der Begegnung zwischen Jungen und Mädchen begegnet man mit großer Skepsis (vgl. Abschnitt 4, Freizeitverhalten), wobei den Jugendlichen die Notwendigkeit des Sammelns von Erfahrung durchaus zugestanden wird, wenn auch möglichst unter Kontrolle der Eltern, die gut daran tun, ihren Sohn oder ihre Tochter aufzufordern die Freundin oder den Freund mit nach Hause „zur Begutachtung“ mitzubringen. (vgl. 8/57/572)
Mit den Außenkontakten der Kinder und Jugendlichen, den Freundschaften und Beziehungen zum anderen Geschlecht, wächst der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. Hier gilt es den „rosaroten“ Träumen möglichst frühzeitig die harte Realität gegenüberzustellen. Im Brief einer besorgten Mutter an ihre heranwachsende Tochter können wir lesen: „Es ist nämlich ein sonderbar Ding mit der Freiheit, der Ungebundenheit und dem ‚sein eigenes Leben leben’. All das schwebt einem wie ein lockender goldener Traum vor, wenn man siebzehn ist, wie eine schillernde, stolze Seifenblase, die – ja, die eines Tages zerplatzt und nur Leere, Enttäuschung und Schmerz hinterlässt. Um dich davor zu bewahren, vor dieser Enttäuschung und diesem Schmerz, deshalb ist Mutti so ‚altmodisch’.“ (1/54/2) In die gleiche Richtung zielt ein Beitrag in Heft 8 des Ratgebers vom gleichen Jahrgang: „Die charakterliche und moralische Reife, welche die junge Generation zwischen 18 und 25 Jahren mit besonderer Betonung für sich in Anspruch nimmt, ist leider nicht immer gegeben.“ (8/54/339) Was die jungen Menschen darunter verständen, habe nach Ansicht des Ratgebers weniger mit „Charakterfestigkeit und Verantwortungsgefühl“ zu tun, „es ist vielmehr eine vielleicht ungewollte, aber doch unverkennbare Überheblichkeit gegenüber den zahlreichen Problemen des Lebens.“ (vgl. s. o.)
Sexualverhalten:
„Es müsste uns Eltern doch zu denken geben“, schreibt der Ratgeber 1956, „wenn Leute, die es wissen könnten, darauf hinweisen, dass heute erschreckend wenig unberührt in die Ehe gehen...“ (10/56/666) Und das sei eigentlich auch gar nicht verwunderlich, wenn man daran denke, dass eine „genussgierige Umwelt heute mehr Reize an die Heranwachsenden heranträgt, als das früher der Fall war.“ (s. o.)
Wann soll man seine Kinder aufklären, fragt eine unsichere Mutter, die darüber schon die verschiedensten Ansichten gehört hat, den Ratgeber in Heft 9 vom Jahre 1956. „Der richtige Zeitpunkt ist dann“, befindet der Ratgeber, „wenn Ihr Kind Sie irgend etwas in dieser Richtung fragt. Das kann schon ein Vierjähriges, wenn es sich erkundigt, wo die kleinen Kinder herkämen, ob sie etwa vom Himmel heruntergebracht oder in der Klinik aus der großen Badewanne gefischt würden.“ (9/56/604) Allgemein sollte gelten: „Lieber etwas zu früh als zu spät von diesen natürlichen Dingen reden, denn es ist wichtig für später, von wem und auf welche Weise unser Junge oder unser Mädchen dies erfährt. Im Allgemeinen“, so fährt der Ratgeber fort, „wird die weitere Aufklärung größerer Jungen der Vater übernehmen oder, wenn er es sich nicht zutraut, ein bekannter Lehrer, Pfarrer oder Pate, zu dem der junge Mensch Vertrauen hat.“ (s. o.)
Zur Sexualität des Kindes und Jugendlichen und zum Thema Sexualaufklärung finden sich im Ratgeber der 50er Jahre nur versteckte Hinweise. Diese Feststellung mag an dieser Stelle genügen, ich werde im interpretativen Teil der Arbeit mich noch mit diesem Faktum auseinanderzusetzen haben. Einige Anmerkungen zu diesem Bereich familialer Sozialisation und Erziehung finden sich im Märzheft des Ratgebers vom Jahre 1960. Hier wird in allgemeinen Formulierungen, wenn auch nicht unkritisch, die Rolle der Eltern bei der Sexualaufklärung beschrieben. Laut Ratgeber nehmen sich zunehmend mehr Eltern vor „großzügiger zu erziehen, als sie es selbst erlebten... Sie haben“, berichtet der Ratgeber seinen Lesern, „den Klapperstorch abgeschafft und biologische Kenntnisse von Bienen und Fröschen aufgefrischt, um die Dinge möglichst natürlich erklären zu können.“ Nur wenn, so wird einschränkend bemerkt, die Kinder das Alter erreichen, in dem die wirklichen Probleme beginnen, dann „schweigen die Eltern“. (vgl. 3/60/180)
Doch wie sollen nun die Eltern das „heiße Eisen“ anpacken und vor allem, wie weit dürfen bzw. sollen sie in ihrer Aufklärung gehen? Darauf bleibt der Ratgeber den Lesern die Antwort weitgehend schuldig und belässt es bei Unverbindlichkeiten: „Wichtiger als Einzelheiten und tiefschürfende Formulierungen ist jedenfalls das Vertrauen der Kinder, dass ihre Eltern auch hier die erste Instanz sind und bei bestimmten Themen nicht plötzlich schweigen.“ (3/60/181) Den Eltern wird empfohlen nicht allzu „modern“ sein zu wollen und den Kindern mehr erzählen als diese zu wissen brauchen. (vgl. s. o.)
Erziehung zum Verzicht – Taschengeld:
Hier sei nun ein Abschnitt eingefügt, der zwar zu allen bisher angeführten Verhaltensbereichen quer verläuft und daher schon an verschiedenen Stellen angesprochen wurde, auf dessen besondere Hervorhebung ich aber mit Blick auf den interpretativen Teil nicht verzichten möchte. „Erziehung zum Verzicht“ – dies scheint mir ein wichtiger Topos der Erziehung in den 50er Jahren zu sein.
„Gelegenheit macht Diebe“ – der mit diesem Sprichwort angesprochene Sachverhalt ist für den Ratgeber oft die schlimme Folge falsch verstandener Erziehung und Elternliebe. Kinder gewöhnen sich daran, jedes Verlangen nach Genuss gleich zu befriedigen, wenn, wie der Ratgeber meint, „die Eltern zu oft der Bettelei ihrer Kinder nachgeben.“ (vgl. 10/56/666) Der Autor des Beitrages macht das „gedankenlose In-sich-hineingleiten-Lassen wertloser Zerstreuung und Genüsse“ für die Widerstandslosigkeit junger Menschen „gegen die Vielfalt der ihn bedrängenden Versuchungen“ verantwortlich. (vgl. s. o., S.667)
Der „Verzicht in der Kinderstube“ als Grundlage „guter Erziehung“ hat beim Rundfunkhören (vgl. 7/57/500) genauso seine Berechtigung wie beim Umgang mit dem Taschengeld. Maßlosigkeit verdirbt den Charakter. „Kinder können nicht früh genug damit vertraut gemacht werden, dass Sparen vor Ausgeben geht – und dass mit überlegtem Ausgeben am besten gespart wird. „Vorsicht vor Überbewertung des Materiellen!“, mahnt der Ratgeber (vgl. 4/57/214) Wie man seine Kinder zum rechten Umgang mit dem Taschengeld erzieht, verrät eine Mutter im gleichen Beitrag: „ich machte die allerbesten Erfahrungen mit einer Art ‚Buchhaltung’: Jedes meiner Kinder besitzt vom ersten Schuljahr an ein ‚Sparbuch’, in dem Soll und Haben genau notiert sein müssen. Nur wenn am Monatsende die ‚Bilanz’ stimmt und auch wirklich keine Ausgabe vergessen wurde, gibt’s neuen ‚Zahltag’.“ (s. o., S. 216) Die Hilfe in der Küche wird materiell nicht belohnt. Sie ist für die Kinder selbstverständliche Pflicht. Es kommt darauf an den Kindern beizeiten klarzumachen, dass Geld erst im Schweiße seines Angesichts verdient werden muss, bevor es ausgegeben werden kann. Das Sparen lernt man durch ein vernünftiges Ausgeben des Geldes. (vgl. s. o.)