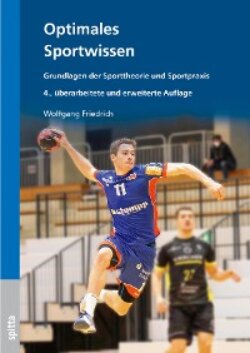Читать книгу Optimales Sportwissen - Wolfgang Friedrich - Страница 8
1 Theorie und Methodik des Trainings und Trainierens
ОглавлениеPraxisbeispiel
Trainingsbeispiele aus der Praxis
Zur Vorbereitung auf die Wettkampfsaison macht der Handballer eventuell 4- bis 5-mal pro Woche Waldläufe, während der Wettkampfsaison läuft er nur noch 1- bis maximal 2-mal. In einem Tischtennistraining wird der kleine weiße Ball in einer Trainingseinheit zum Teil mehrere tausendmal übers Netz gespielt, und die Trainer korrigieren die technische Ausführung der Schläge sehr genau. Hier spielt offensichtlich technische Perfektion eine große Rolle. Dafür absolvieren auf der anderen Seite professionelle Ausdauerathleten in der Leichathletik insgesamt Läufe über 150–200 km pro Woche, Radprofis fahren 40000–45000 km pro Jahr auf dem Rennrad.
Zur Lauftechnik sagt der Trainer eher wenig bis nichts, er gibt aber ständig Hinweise zur gelaufenen Zeit. Er nimmt dem Läufer immer wieder aus dem Ohrläppchen Blut ab und kontrolliert die Pulsfrequenz seines Pulsmessers. Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen dem Training in einer Individualsportart wie dem Tischtennis und dem in einer Mannschaftssportart wie dem Basketball? Schüler in der Schule wollen lieber Volleyball spielen und weniger gern – weil als monoton empfunden – das untere oder obere Zuspiel trainieren. Der Begriff „Training“ wirft viele Fragen auf.
Die Trainingslehre beschäftigt sich unter anderem damit, möglichst plausible Antworten auf die hier gestellten Fragen zu geben bzw. Erklärungen dafür zu finden.
Definition Trainingslehre:
Die Trainingslehre stellt eine systematische Sammlung allgemeiner handlungsrelevanter Aussagen zum Training dar, die einen Bezug zur Handlungsweise im Training haben und sich auf unterschiedliche Quellen beziehen, wie z.B. wissenschaftliche Untersuchungen oder Erfahrungswissen (vgl. Hohmann et al. 2007).
Ein erster Zugang zum „Trainieren“ ist über die unterschiedlichen Zielsetzungen der Trainierenden möglich (Abb. 1.1).
Abb. 1.1: Ziele des Trainings
Zum Zielbereich der Leistungssteigerung zählt neben dem Leistungserhalt auch das gezielte Abtrainieren, wenn z.B. Profis ihre aktive Laufbahn beenden.
Training auf unterschiedlichen Leistungsniveaus
Wie bereits oben angedeutet, gibt es natürlich prinzipielle Unterschiede im Training auf unterschiedlichen Leistungsniveaus. Nehmen wir an, ein Breitensportler und ein Fußballprofi trainieren mit dem gleichen Ziel, nämlich der Leistungssteigerung. Für einen Profi ist dieses Ziel schwieriger zu erreichen als für den Breitensportler. Je höher nämlich das sportliche Niveau ist, desto langsamer vollzieht sich die Leistungssteigerung. Hinzu kommt, dass die Trainingseinheit zwar vom Aufbau her gleich gestaltet sein kann, z.B. mit einleitendem Aufwärmteil, technischem Hauptteil und spielerischem Schlussteil, von der konkreten inhaltlichen Gestaltung her betrachtet, kann man jedoch deutliche Niveauunterschiede in technischer und konditioneller Hinsicht bei den Spiel- und Übungsformen feststellen. Beide trainieren sehr unterschiedlich. Ein Breitensportler trainiert vielleicht 1- bis 2-mal pro Woche, während ein Profi auf ca. 10 Trainingseinheiten pro Woche kommt. Das Training von beiden unterscheidet sich also trotz des gleichen Trainingsziels sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich voneinander.
Training findet also mit unterschiedlichsten Zielsetzungen und auf unterschiedlichsten Ebenen bzw. in unterschiedlichen Bereichen (Leistungsniveaus) statt (Abb. 1.2).
Bereiche von Training
Abb. 1.2: Bereiche von Training
Unabhängig von Zielsetzung und Niveau werden Trainingsprozesse jedoch immer dadurch begründet, dass einige typische – für Training charakteristische – Merkmale erfüllt sind.
Definition Training:
Training ist die geplante und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und -methoden) zur nachhaltigen Erreichung von Trainingszielen im Sport (vgl. Hohmann et al. 2007).
Wesentliche Bestandteile von Training
In dieser Definition sind wesentliche Bestandteile von Training enthalten:
• Planmäßigkeit: Sie ist dann gegeben, wenn Trainingsziele, Trainingsmethoden, Trainingsinhalte sowie Trainingsaufbau und -organisation unter Beachtung trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse sowie trainingspraktischer Erfahrung von vornherein festgelegt sind. Die Durchführung muss kontrolliert werden und die Wirkung muss mit entsprechenden Leistungskontrollen überprüft werden (vgl. Weineck 2019).
• Systematik: Für die Leistungsfähigkeit eines Sportlers sind Bedingungen und Prozesse verantwortlich, die in Wechselbeziehung zueinander stehen und somit ein System bilden. Die leistungsbestimmenden Komponenten (Einflussgrößen) sind in Abb. 1.3 und 1.4 dargestellt.
• Trainingsziele: Im Training sollen z.B. konditionelle Fähigkeiten oder sportliche Techniken auf Dauer verbessert, eine hohe Leistungsfähigkeit für den nächsten Wettkampf erarbeitet oder auch für den Gesundheitssport wichtige Entspannungsmethoden erlernt werden. Es wird gezielt an etwas gearbeitet.
•Trainingsinhalte und -methoden: Die Trainingsziele geben dem Sportler oder Trainer die Trainingsinhalte mehr oder weniger genau vor: Sämtliche praktische Maßnahmen, wie z.B. Sprünge zum Sprungkrafttraining, häufige Übungswiederholungen des Korblegers im Basketball zum Techniktraining, eine Wassergymnastik im Gesundheitssport oder ein 10-km-Ausdauerlauf zur Schulung der Grundlagenausdauer, also alle Maßnahmen, mit denen diese Trainingsziele planmäßig und systematisch angestrebt werden, bezeichnet man als Trainingsinhalte (vgl. ebd.).
Training als Handlungsprozess
Training ist ein sehr komplexer Handlungsprozess, der darauf ausgerichtet ist, angemessene Wirkung auf alle leistungsrelevanten Merkmale des Sportlers zu erzielen. Bei der Vielzahl der Komponenten der personeninternen Bedingungen wird deutlich, dass deshalb jeder Sportler/Athlet einen ganz individuellen Weg vom Anfänger zum Könner nimmt (Abb. 1.3). Diese personeninternen Bedingungen sind es letztendlich, welche es verhindern oder erst ermöglichen, zum Spitzensportler zu werden.
Abb. 1.3: Schema personeninterner Bedingungen sportlicher Leistungen und Erfolge (Weineck 2002)