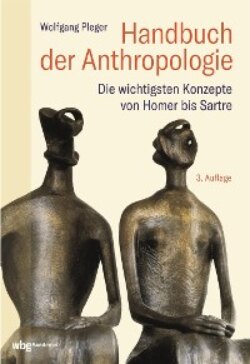Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die Sterblichen und die Unsterblichen (Homer)
Оглавление„Wie der Blätter Geschlecht, so ist auch das der Männer./
Die Blätter – da schüttet diese der Wind zu Boden, und andere treibt/
Der knospende Wald hervor, und es kommt die Zeit des Frühlings./
So auch der Männer Geschlecht: dies sproßt hervor, das andere schwindet“
(Homer: Ilias 6, 146–149).
„Nichts Armseligeres nährt die Erde als den Menschen unter allem, was auf der Erde Atem hat und kriecht. Da meint er, niemals werde ihm hernach ein Übel widerfahren, solange die Götter Gedeihen geben und sich seine Knie regen. Jedoch wenn die seligen Götter auch Bitteres vollenden, so trägt er auch dieses wieder nur murrend mit bedrücktem Mute“ (Homer: Odyssee 18, 130ff.).
„(...) dieses ist die Weise der Sterblichen, wenn einer gestorben ist. Denn nicht mehr halten dann die Sehnen das Fleisch zusammen und die Knochen, sondern diese bezwingt die starke Kraft des brennenden Feuers, sobald einmal der Lebensmut die weißen Knochen verlassen hat, die Seele aber fliegt umher, davongeflogen wie ein Traum“ (Homer: Odyssee 11, 196–224).
Homer lebte im 8. Jh. v. Chr. im ionischen Kleinasien. Über seinen genauen Geburtsort gibt es nur Vermutungen. Unter seinem Namen werden die beiden Versepen Ilias und Odyssee tradiert. Die Ilias, die die zehnjährige Belagerung und Eroberung Trojas behandelt, ist das älteste erhaltene Großepos der europäischen Literatur. Die später entstandene Odyssee berichtet von der zehnjährigen Irrfahrt und der Heimkehr des Odysseus, die durch göttliches Einwirken immer wieder verzögert wird. Die Frage nach dem Autor wird inzwischen durch die Annahme beantwortet, dass zum einen der schriftlichen Fassung der Epen eine möglicherweise jahrhundertelange mündliche Tradition vorausging und dass nur die Ilias, in der uns bekannten Form, Homer zuzuschreiben ist. Gleichwohl enthalten beide Epen eine in den Grundzügen übereinstimmende Anthropologie, die jedoch in der Odyssee eine Anreicherung durch sich differenzierende psychologische Einsichten erfährt.
In der Ilias thematisiert Homer nicht nur den Krieg um Troja, sondern erläutert in einem umfassenden Sinne seine Deutung der Welt. Gegensätze, Kampf, Krieg und Streit bilden ihre grundlegende Struktur. Die Welt ist zu verstehen als ein Ensemble von Auseinandersetzungen und Gegensätzen (vgl. Schadewaldt, 1978, 64). Solche Gegensatzpaare sind: Erde – Meer, Tag – Nacht, Alter – Jugend, Götter – Menschen, Worte – Taten, Hochzeit – Streit u.ä. Wollte man Homers poetische Ontologie auf eine Formel bringen, so ließe sich sagen: Die Welt existiert als Streit. Das von ihm betonte agonale Prinzip, das die griechische Lebensauffassung überhaupt spiegelt, ist eingesenkt in das Wesen der Dinge und der Menschen (vgl. Jens, 1978, 17).
Gleichwohl spielen sich alle Auseinandersetzungen in einem in sich geschlossenen, symmetrischen und harmonischen Weltbau ab. Homers Weltmodell – das Wort Kosmos zur Bezeichnung der Welt taucht bei ihm noch nicht auf – findet sich in einer Schildbeschreibung (Homer, Ilias 18, 478–608). Die Darstellung der Welt auf einem Schild macht bereits einen Grundzug des homerischen und des griechischen Denkens deutlich: den Entwurf von Modellen. Der beschriebene Schild gibt das anschauliche Modell der sichtbaren Welt. Es ist dadurch ausgezeichnet, dass Erde und Meer sich auf einer kreisrunden Scheibe befinden, die an ihrem äußersten Ende von dem Okeanos begrenzt wird und über die sich der Himmel als Kuppel wölbt. An ihr sind die Sterne befestigt. Die Erde wird belebt von Pflanzen, Tieren und Menschen. Die sie bestimmenden Gegensätze sind: Stadt – Land, Hochzeit – Streit, Angriff – Flucht, Arbeit – Genuss u.a.
Der sichtbare Teil der Welt ist zu ergänzen durch eine unter der Erde gelegene Halbkugel, die sich zu der des Himmels symmetrisch verhält. Sie repräsentiert den Hades. Die Erdscheibe halbiert so die insgesamt geschlossene Weltkugel. Von Bedeutung ist, dass Homer den Okeanos nicht nur als den Ursprung der Götter (Ilias 14, 201), sondern als Ursprung von allem bezeichnet (ebd. 14, 246). Die Rede vom Okeanos macht deutlich, dass Homers Weltmodell, so sehr es als ein physikalisches vorstellbar ist, mythischen Ursprungs ist. Es ist ambivalent, da es eine sachliche Seite enthält, die der unmittelbaren Anschauung entspricht, und eine im Mythos verwurzelte. Der Okeanos ist der alles umschließende Weltstrom und zugleich der göttliche Ursprung von allem.
Homers Götterwelt bildet nicht den Anfang in der Geschichte der Mythologie, sondern stellt bereits eine Neuerung dar. Sie grenzt sich gegen eine ältere ab, die in seinen Epen, aber auch bei Hesiod und in der Tragödie, stellenweise durchschimmert. Ziel der von Homer eingeführten olympischen Götterwelt ist es, den alten Mythos zu überwinden (Otto, 1987, 21ff.). Während es sich bei den homerischen Göttern des Olymps um personale und betont männliche Gestalten handelt, was auch für die Göttinnen gilt, sind die Götter der mythischen Vorzeit, die genauer vielleicht als göttliche Mächte zu bezeichnen wären, weiblich. Dazu gehören Er de, Zeugung, Blut und Tod, aber auch der Himmelsäther, die Winde, die Flüsse und die Meereswogen. Zu erwähnen sind die Erynien, die ‚Zürnenden‘, die Eumeniden, die ‚Töchter der Nacht‘, und die Moiren, die ihre Schwestern sind. Als Mächte des Schicksals verfügen sie über Geburt, Hochzeit und Tod. Die Moira, das Schicksal, hat Homer in seinen Mythos übernommen; es steht noch über der olympischen Götterwelt. Gegen das Schicksal zu kämpfen ist weder den Menschen noch den Göttern möglich, und wenn es versucht wird, ist die Übertretung von kurzer Dauer und die Strafe folgt unvermeidlich. Ebenso ist der Tod als eine der alten mythischen Mächte weder für Menschen noch für Götter zu besiegen, auch wenn diese selbst unsterblich sind. Der Erde kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie ist vor allem die Lebenspendende. Sie gibt dem Menschen die Nahrung und erhält ihn.
Den Göttern sind bei Homer bestimmte Wirklichkeitsbereiche zugeordnet, gleichzeitig aber repräsentieren sie diese Bereiche auch als Person. So ist Ares der Gott des Krieges und der Krieg selbst, Poseidon der Gott des Meeres und das Meer selbst, Aphrodite die Göttin der Liebe und die Liebe selbst u.a.m. Das führt zu der paradoxen Situation, dass Ares sich in einen Kampf mit einem Menschen einlässt und dabei verwundet wird (Fränkel, 1976, 82), während Athene dem Kontrahenten des Ares zu Hilfe kommt. Deshalb muss zwischen dem Gott, der einen Wirklichkeitsbereich repräsentiert, und der Wirklichkeit selbst unterschieden werden. Die dadurch entstehende Ambivalenz entwickelt sich zu dem Unterschied von Person und Sache; sie ist für die Entwicklung des griechischen Denkens von entscheidender Bedeutung. Indem sich die Götter bei Homer aus der unmittelbaren Einheit der alten mythischen Mächte mit den ihnen zugehörigen Wirklichkeitsbereichen lösen und unter Verwendung anthropomorpher Züge personale Qualitäten annehmen, wird die Wirklichkeit selbst der sachlichen Betrachtung zugänglich. Aus ihr entwickeln sich Wissenschaft und Forschung.
Das Verhältnis der Menschen zu den Göttern hat daher zugleich immer auch eine personale Qualität. Die Beziehungen zwischen den Menschen sind ebenso wenig ohne Spannung wie die zu den Göttern. Die Götter begleiten das menschliche Leben, planen die große Linie, teilen ihm sein Schicksal zu und intervenieren gelegentlich bei einzelnen Handlungen. Ein Beispiel hierfür findet sich gleich zu Beginn der Ilias. Dort ist von dem Zorn Achills die Rede, der wegen einer ihm von Agamemnon zugefügten Schmach erwägt: „Ob er, das scharfe Schwert gezogen von dem Schenkel,/Die Männer aufjagte und den Atreus-Sohn erschlage,/Oder Einhalt täte dem Zorn und zurückhalte den Mut“ (ebd. 1, 190). Doch noch während er überlegt, dann aber das Schwert zieht, erscheint die Göttin Athene. Sie ergreift seine „blonde Mähne“ und ermahnt ihn mit folgenden Worten: „Gekommen bin ich, Einhalt zu tun deinem Ungestüm, wenn du mir folgtest“ (ebd. 1, 207). Die Situation ist höchst aufschlussreich. Die Göttin ermahnt Achill, aber sie greift nicht in einem physischen Sinne in das Geschehen ein. Es bleibt seine freie Entscheidung, ihr zu folgen oder sich zu widersetzen; und so beschließt Achill aus eigener Einsicht, der Göttin zu folgen; „denn so ist es besser“. Seine Begründung lautet: „Wer den Göttern gehorcht, sehr hören sie auch auf diesen.“ (ebd. 1, 218).
Die Menschen sind bei Homer keine Marionetten in den Händen der Götter. Im günstigsten Fall also entsprechen sich göttliches und menschliches Handeln. So heißt es im 11. Buch der Ilias:
„Dorthin trat und schrie die Göttin groß und schrecklich/Hell auf und warf den Achaiern große Kraft einem jeden/In das Herz unablässig zu streiten und zu kämpfen. (...)/Der Atreus-Sohn aber rief und befahl, sich zu gürten (...)“ (ebd. 11, 10ff.).
Es ist Eris, die Göttin des Streites, die zum Kampf ruft und nach ihr, ihr entsprechend, Agamemnon, des Atreus-Sohn. Auf diese Weise macht er sich die Intention der Göttin zu eigen.
Mit dem hier angesprochenen Herzen ist ein Bereich des Menschen genannt, der für Planung und Durchführung einer Handlung von zentraler Bedeutung ist. Homer entwickelt eine ganz eigene Anatomie. Der Mensch stellt eine gegliederte Einheit von Fleisch, Sehnen und Knochen dar. Das, was seine Glieder zusammenhält und in Bewegung versetzt, ist sein Leben, seine Lebenskraft. Der Tod wird daher bei Homer auch als der ‚Gliederlösende‘ bezeichnet. In einem Zweikampf tötet Agamemnon seinen Feind so: Er „schlug ihm das Schwert in den Hals und löste die Glieder. So fiel dieser dort und schlief den ehernen Schlaf, der Arme,/Fern der vermählten Gattin“ (ebd. 11, 240ff.).
In der Ilias wird die Grausamkeit des Krieges deutlich beschrieben. Nicht selten wird das Töten mit schmähenden Worten begleitet. So spricht Odysseus zu seinem Feind:
„Ah, Elender! Wahrhaftig, jetzt trifft dich das jähe Verderben!/(...) Dir aber sage ich, wird hier der Tod und die schwarze Todesgöttin/Kommen an diesem Tag, und unter meinem Speer bezwungen/Gibst du mir Ruhm, die Seele aber dem rosseberühmten Hades!“ (ebd. 11, 441ff.).
Im Tod verlässt ein verkleinertes Abbild (eidolon) des Menschen den Sterbenden aus dem Mund oder aus der tödlichen Wunde. Dieses Abbild ist seine ‚psyche‘ (Rohde, o. J., 17). Sie fliegt in den Hades und führt dort ein trostloses Schattendasein. Im 11. Gesang der Odyssee wird dieser Vorgang anschaulich beschrieben. Der Hades ist der Ort, „wo die Toten wohnen, die sinnberaubten, die Schatten der müdegewordenen Sterblichen“. Daher kann es in ihm auch keinen Trost geben. Aus diesem Grund entgegnet der verstorbene Achill Odysseus bei seiner Unterweltschau:
„Suche mich nicht über den Tod zu trösten, strahlender Odysseus! Wollte ich doch lieber als Ackerknecht Lohndienste bei einem anderen, einem Manne ohne Landlos leisten, der nicht viel Lebensgut besitzt, als über alle die dahingeschwundenen Toten Herr sein!“ (Od. 11, 463ff.).
Der Mensch befindet sich in einem permanenten Kampf mit seinesgleichen und mit den Unsterblichen, die eine überlegene, unberechenbare Macht darstellen und deren unvorhersehbaren Eingriffen er sich fügen muss. Das Resümeé ist daher: Das Leben der Menschen ist elend. Es unterliegt dem allgemeinen Kreislauf der Natur. Die Menschen gleichen den Blättern des Waldes, die der Wind abreißt und die zu Boden fallen, während andere emporsprießen. Selbst im Vergleich zu den anderen Lebewesen ist er armseliger als alle anderen. Sein Vertrauen auf seine Kraft hat keine verlässliche Grundlage. Es wird durch das Eingreifen der Götter immer wieder erschüttert. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Mensch in den Epen Homers nicht resigniert. Er akzeptiert das ihm von den Göttern zugeteilte Schicksal. Das schließt sogar die Hinnahme der Sterblichkeit ein.
In einer einzigartigen Episode bietet die Göttin Kalypso Odysseus die Unsterblichkeit an, wenn er nur bei ihr bliebe und bereit wäre, auf seine Heimkehr zu verzichten. Doch Odysseus lehnt das Angebot ab, denn er sehnt sich nach der Liebe einer Sterblichen, seiner Frau Penelope, und daher begehrt er, nach Hause zu kommen, „und wollte mich auch einer der Götter abermals zerschmettern auf dem weinfarbenen Meere: dulden will ich es!“ (ebd. 5, 221ff.) Bedenkt man, welche intellektuelle Energie in der nachfolgenden Philosophie und Theologie aufgewendet worden ist, um dem Menschen, oder doch seiner Seele, oder zumindest einem Teil der Seele, die Unsterblichkeit zu sichern, so darf dieser Verzicht auf Unsterblichkeit als außerordentlich eingeschätzt werden. Die Unsterblichkeit der Seele ist für Homer schon deshalb kein erstrebenswertes Ziel, weil der Hades, der Ort der Seelen nach dem Tode, trostlos ist. Ein Wunsch nach Unsterblichkeit hätte nur dann einen Sinn, wenn dem Menschen wie den Göttern ein Leben in immerwährender Jugend geschenkt würde; doch gerade das ist ihm verwehrt.
Bei Homer bereitet sich die spätere dualistische Anthropologie von ‚psyche‘ und ‚soma‘ vor; aber besondere Aspekte sind zu beachten. Die Begriffe entsprechen nicht dem späteren Leib-Seele-Schema. Denn ‚Soma‘ ist nicht der lebendige Leib, sondern der Leichnam, der, nachdem die ‚psyche‘ den Menschen verlassen hat, zurückbleibt. Der Begriff Leben entspricht am ehesten dem Wort ‚menos‘, das man mit Lebenskraft übersetzen kann.
Der Einsicht in die Sterblichkeit entspricht die Ethik. Sie ist charakterisiert durch ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite ist sie bestimmt durch das durchgängige agonale Prinzip. Dass die Welt Auseinandersetzung und Streit ist, ist für den Menschen bei Homer ebenso selbstverständlich wie die Tatsache, dass er sich im Kampf zu bewähren hat. Dazu gehört auch das Streben nach Ruhm. Dieses wird in einer Gesellschaft, in der dem Adel die führende Rolle zukommt, höher eingeschätzt als das Leben selbst. Doch die Ruhmsucht birgt auch eine Gefahr. Es ist die der Hybris, d.h. der Selbstüberschätzung und der Überheblichkeit. Die Warnung vor Hybris ist daher das notwendige, immer wieder in Erinnerung zu rufende Korrektiv gegenüber der Ruhmsucht, die als Ausdruck des agonalen Prinzips zu verstehen ist. Der Appell, Maß zu halten, richtet sich an denjenigen, der seine Kräfte überschätzt und sich für unsterblich hält. Diesem Appell entspricht eine Ethik des Maßes.
Das Prinzip des Maßes spielt auch beim Tode Hektors eine besondere Rolle. Nachdem Achill Hektor getötet hat, bindet er den Leichnam an seinen Wagen und schleift ihn in maßloser Wut immer wieder um das Grabmal seines getöteten Freundes Patroklos. Nach griechischem Verständnis ist es ein maßloser Frevel, den Gefallenen nicht seinen Angehörigen zur Bestattung zu übergeben. Die Übergabe geschieht dann aber doch, als der greise Priamos im Schutze der Götter Achill am Abend aufsucht und um Freigabe des Leichnams bittet. Indem Achill ihm diese Bitte gewährt, kehrt er zurück zu dem menschlichen Maß. In dieser Geste findet nicht nur der Krieg ein Ende, sondern das Epos seinen Abschluss. Für Homer ist der Streit unlösbar mit dem Leben der Menschen verbunden, aber er propagiert ihn nicht. Vielmehr äußert er in seinem Werk den Wunsch nach einem Ende allen Streits. In anderer Weise kommt die Ethik des Maßes in der Odyssee zum Ausdruck. Ein Beispiel hierfür ist die Heimkehr des Odysseus. Dieser erblickt voller Zorn die „unverschämten Freier“ in seinem Hause, die sein „Gut verprassen“ und seine Frau bedrängen. Er möchte aufspringen und sie sofort erschlagen. Doch kluge Überlegung hält ihn zurück bis zu dem dafür geeigneten Zeitpunkt, und so führt er mit sich folgenden inneren Monolog: „Halte aus, Herz! Einst hast du noch Hündischeres ausgehalten (…). So sprach er und schalt sein Herz in der Brust. Da verharrte ihm das Herz ganz im Gehorsam und hielt aus unablässig“ (ebd. 20, 15–24). In dieser Rede bahnt sich ein spezifisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst an, ein Selbstverhältnis. Es bildet den Ausgangspunkt für die Ethik der Selbstbeherrschung.
Die Wirkungsgeschichte der Epen Homers ist kaum übersehbar. Im klassischen Griechenland gehörten sie zum allgemein anerkannten Bildungskanon. Homerzitate finden sich in großer Zahl in Platons Werk. Der Raub der Helena, der Krieg vor Troja, die Suche von Telemachos nach seinem Vater, die Heimkehr des Odysseus bildeten Motive für die bildende Kunst und die Literatur. Das Werk von James Joyce Ulysses ist ein spätes Zeugnis dafür. Entscheidender ist aber etwas anderes. Im Werk Homers spricht sich ein Grundmotiv europäischen Denkens aus: Es ist das agonale Prinzip. Zu ihm gehören Kampf, Auseinandersetzung, Konkurrenz, wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, aber auch Krieg und Leid. Das bedeutet: Weltgeschehen ist Streitgeschehen. Gegenüber dem agonalen Prinzip hat sich die in der Stoa vertretene Haltung des Gleichmuts ebenso wenig behaupten können wie christliche Meditation und Askese. Allerdings: Auch die Ethik des Maßes, die Homer als Gegengewicht zum agonalen Prinzip betonte, ist wenig erfolgreich gewesen.