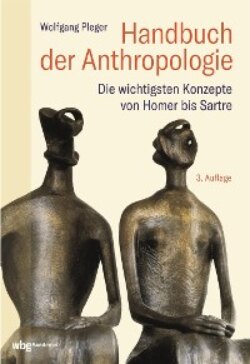Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die Erschaffung der Welt und des Menschen (Genesis 1–3)
Оглавление„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan (…) Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.“ (1. Mos. 1 V. 26ff; V. 31).
„Und Gott der HErr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der HErr pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte (…)
Und Gott der HErr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und Gott der HErr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.“ (1. Mos. 2 V. 7f.; V. 16ff.).
Der biblische Schöpfungsmythos hat eine klare Botschaft: Der Gott, der das Volk Israel errettet hat, es bewahrt und leitet, ist der eine und einzige Gott, der auch die Menschen und die Welt geschaffen hat. Er stellt die mythische Vorgeschichte nicht nur seines Volkes dar, sondern der Welt insgesamt und aller Menschen in ihr. Allerdings gibt es den Schöpfungsmythos in zwei Versionen. Sie stammen von zwei Verfassern. Der eine wird als der Jahwist (J) bezeichnet, der andere wird unter dem Titel Priesterschrift (P) zitiert. Daneben gibt es noch einen Redaktor (R), der die beiden Texte behutsam zu einem Ganzen zusammenfügte. Er hat großen Respekt vor den tradierten Texten und hütet sich, inhaltliche Differenzen zu löschen (vgl. Westermann, 1999, 4).
Der Text von J ist der ältere. Er „dürfte um 900 vor Christus seine Form gefunden haben“ (Flasch, 2005, 27). Gleichwohl beginnt die Genesis, das 1. Buch Mose, mit der jüngeren Schrift P, deren Entstehung in das „sechste vorchristliche Jahrhundert gehört“ (ebd.). Diese berichtet von der Erschaffung der Welt und des Menschen in einem Sechs-Tagewerk und seinem Abschluss am siebten Tag der Ruhe. J berichtet nur kurz von der Erschaffung der Welt, legt den Hauptakzent auf die Erschaffung Adams und Evas sowie der Vertreibung aus dem Paradies. Die Frage, warum der Redaktor den jüngeren Text vorangestellt hat, lässt sich nur mit einer Vermutung beantworten. Bei der von ihm vorgenommenen Anordnung ergibt sich ein Erzählbogen, der von der Erschaffung der Welt über die Erschaffung des Menschen bis zur Vertreibung aus dem Paradies und darüber hinaus führt. Dieser Bogen würde bei einer werkchronologischen Anordnung zerstört.
Beide Texte enthalten eine grundlegende Gemeinsamkeit. Sie besteht in der Aussage: Mensch und Welt sind eine Schöpfung Gottes. Das ist die kreationistische Grundthese der Bibel. In der Interpretation der Situation des Menschen in der Welt weichen sie jedoch in ganz erheblicher Weise voneinander ab. Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich nur durch einen Vergleich deutlich machen.
Der Text von P hat einen klaren Aufbau, der sich aus der Chronologie der sieben Tage ergibt und enthält eine eigene Strenge durch wiederholte formelhafte Wendungen.
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. Mit diesen Worten beginnt der erste Schöpfungstag. Neben der Erde werden das Wasser und die Finsternis genannt, der Gott sein Wort „Es werde Licht“ entgegensetzte. Zugleich schied er Licht und Finsternis und schuf damit Tag und Nacht. Der erste Schöpfungstag endet mit der formelhaften Wendung: „Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag“. Der zweite Schöpfungstag ist durch einen weiteren Akt der Scheidung bestimmt. Auch hier geschieht die Handlung durch ein Wort. Es ist die Scheidung des Wassers oberhalb einer Feste und unterhalb ihrer. Die Feste nannte er Himmel. Wieder folgt die Wendung: „Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag“. Der dritte Tag ist bestimmt durch zwei Schöpfungsakte, die Scheidung von Erde und Meer und das Wachsen von Gräsern, Kräutern und Bäumen. Beide werden von Gott als „gut“ beurteilt. Es folgt der formelhafte Schlusssatz. Der vierte Tag enthält die Erschaffung der Gestirne, „ein großes Licht“, das den Tag, und ein „kleines“, das die Nacht regiert, dazu die Sterne. Auch dieses Werk wird als „gut“ beurteilt und formelhaft abgeschlossen. Am fünften Tag werden Fische und Vögel geschaffen. Ihnen wird gesagt: „Seid fruchtbar und mehret euch“, abgeschlossen durch die Formel.
Der sechste Tag berichtet ebenfalls von zwei Schöpfungsakten: der Erschaffung der Tiere auf der Erde und der Erschaffung des Menschen (vgl. Text). Der Mensch erhält den Auftrag, über Fische und Vögel und alles Getier auf der Erde zu herrschen. Als Speise weist Gott ihnen „allerlei Kraut“ sowie die Früchte der Bäume zu, den Tieren als Nahrung „allerlei grünes Kraut“. An dieser Stelle folgen das Urteil, dass alles „sehr gut“ war, und der formelhafte Schluss. Im Zentrum des siebenten Tages steht die Aussage: „Und also vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn“ (Gn 2, 2f.).
Der Text erläutert die Ordnung der Welt durch eine Chronologie von Schöpfungsakten. Mit einer bewunderungswürdigen Intuition ergeben sich hinsichtlich des Lebens Aspekte einer Evolutionstheorie, die heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen standhält. Zur Bezeichnung der Schöpfungsakte gebraucht der Autor zwei Wendungen. Die eine lautet: „Und Gott sprach“ und die andere: „Gott machte“. Man unterscheidet daher einen Wortbericht von einem Tatbericht. Bei dem Wortbericht ist an eine Schöpfung zu denken, die durch ein Ins-Dasein-Rufen zu verstehen ist, bei dem Machen an ein handwerkliches oder künstlerisches Tun.
Von besonderer Bedeutung ist die Erschaffung des Menschen, die nicht nur der Reihe nach den Schluss bildet, sondern zweifellos als der Höhepunkt der Schöpfung gemeint ist. Die besondere Stellung des Menschen zeigt sich darin, dass er als Ebenbild Gottes bezeichnet wird. Das Bild weist eine Ähnlichkeit mit dem Original auf. Doch worin besteht diese? Es ist weder von körperlicher noch geistiger Ähnlichkeit die Rede. Der einzige im Text enthaltene Vergleichspunkt wird durch den Auftrag der Herrschaft gebildet. Ähnlichkeit entsteht durch Analogie. So, wie Gott über die ganze Welt herrscht, so soll der Mensch über alle Lebewesen herrschen und sich die Erde untertan machen. Beachtlich ist, dass bei der Erschaffung des Menschen Mann und Frau gleichursprünglich und damit gleichrangig genannt werden. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl den Menschen als auch den Tieren nur pflanzliche Nahrung zuge wiesen wird. Der siebente Tag weist auf die Sabbatruhe hin und gibt ihr ihre Legitimation.
Die Schöpfungsgeschichte des Jahwisten ist in ihrem Aufbau komplexer. Sie weist Erzählelemente auf, die ursprünglich wahrscheinlich eigenständig waren, doch sind sie von J zu einer Einheit verbunden worden. Daher ist es sinnvoll, den vorliegenden Text zur Grundlage der Interpretation zu machen: Die Erzählung beginnt mit dem Zustand der Welt, als die Erde noch keine Pflanzen trug und nur ein Nebel die Erde befeuchtete. Es folgt die Erschaffung des Menschen aus einem Erdenkloß (vgl. Text) und die Erschaffung des Garten Edens. In ihn setzt Gott „den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ (Gn 2, 9). Erwähnt werden vier Ströme, die z.T. Gold und Onyx enthalten, und die geographisch bekannten Euphrat und Tigris. Dann erhält der Mensch die Erlaubnis von den Bäumen des Gartens zu essen und das Verbot: „von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben“.
Danach folgt Gottes Aussage: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei“. Eingeschoben wird die Erzählung, dass Gott dem Menschen Tiere zuführte und ihn aufforderte, ihnen Namen zu geben. Den Anschluss an die ursprüngliche Absicht bildet der Satz: „aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre“ (Gn 2, 20). So lässt Gott den Menschen in einen Tiefschlaf fallen, entnimmt ihm eine Rippe und formt aus ihr „ein Weib“. Der Mann spricht: „Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“; ergänzt durch den Hinweis: „Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht“ (Gn 2, 25).
Es folgt die Verführung der Frau durch die Schlange, die „listiger“ war als alle Tiere. Sie erinnert an Gottes Erlaubnis, von den Früchten der Bäume zu essen. Doch dem Hinweis der Frau auf das Verbot, vom Baum „mitten im Garten“ zu essen, widerspricht die Schlange, indem sie sagt: Ihr werdet nicht sterben, sondern „sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist“. Gereizt durch die „lieblich“ anzusehenden Früchte und die Verführung durch die Schlange, isst sie davon und gibt auch ihrem Mann zu essen. Daraufhin erkannten sie, dass sie nackt waren, und sie flochten sich Feigenblätter, um sich zu bedecken. Sie verstecken sich vor Gott, dessen „Stimme“ sie hören als „der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war“ (Gn 3, 8). Adam, der mit den Worten angerufen wird: „Wo bist du?“, gibt als Grund seines Versteckens seine Scham über sein Nacktsein an und nennt als Grund für die Übertretung des Verbots das „Weib, das du mir zugesellt hast“. Das „Weib“ aber entschuldigt sich mit Hinweis auf die Schlange.
Es folgt die Bestrafung durch Gott: Die Schlange sei „verflucht“, sie soll auf dem Bauch kriechen und Erde essen. Feindschaft soll zwischen ihr und dem Weibe herrschen. Das Weib soll ihr den Kopf zertreten und sie soll sie in die Ferse stechen. An die Frau ergeht das Urteil: „du sollst mit Schmerzen Kinder gebären; und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein; und er soll dein Herr sein“. Und zu Adam: „verflucht sei der Acker um deinetwillen; mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen (…) Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist (Gn 3, 17ff.)“.
Erst im Schlussteil nennt Adam seine Frau Eva, „Mutter…aller Lebendigen“. Gott fertigt für sie „Röcke von Fellen“ und spricht: „Siehe, Adam ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber daß er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden“ (Gn 3, 22f.). Der Garten aber wird bewacht durch Cherubim, die mit Schwertern bewaffnet sind, „zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens“ (Gn 3, 24).
Im Zentrum des Paradiesmythos steht nicht die Erschaffung der Welt, sondern die des Menschen. Von Bedeutung ist, dass zunächst nur der Mann gemacht wird. Es werden die Tiere geschaffen und bemerkenswerterweise festgestellt, dass unter ihnen keine geeignete Hilfe für den Mann zu finden ist. Dann erst erfolgt die Erschaffung der Frau. Viel diskutiert wird die Rolle der zwei besonders erwähnten Bäume: der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis (vgl. Westermann, 1999, 291f.). Zwischen ihnen besteht ein Rangunterschied. Der Baum des Lebens ist der wichtigere. Das Essen von dem Baum der Erkenntnis gibt das Wissen von Gut und Böse, der Baum des Lebens aber das ewige Leben. Das aber ist ein Privileg Gottes, das von ihm eifersüchtig verteidigt wird. Die Vertreibung aus dem Paradies ist daher sowohl Strafe für die Menschen, mehr aber noch Schutz des Baums des Lebens vor menschlichem Zugriff. Aber auch der Baum der Erkenntnis wirft Fragen auf, die der Text nicht beantwortet: Warum soll der Mensch nicht erkennen, was Gut und Böse ist? Muss der Mensch vor der Übertretung des Verbots nicht bereits wissen, dass seine Missachtung böse ist? Und schließlich: In welchem Verhältnis steht die Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse mit der Entdeckung der Nacktheit und der Scham?
Im Verhältnis von Mann und Frau ist auf zwei Aspekte hinzuweisen. Der Mann existiert zunächst alleine. Doch dieser Zustand „ist nicht gut“. Die Schöpfung enthält bemerkenswerterweise „ein Ungenügen“ (Westermann, 1999, 309). Gott muss sie nachbessern. Zum anderen aber wird der Vorrang des Mannes klar ausgesprochen. Sie ist seine Gehilfin, nicht umgekehrt, und er soll ihr Herr sein.
Mit Blick auf die Strafe ist Folgendes von Bedeutung: Die ursprüngliche Strafandrohung wird nicht vollstreckt. Aus der angekündigten Todesstrafe wird eine Strafe auf Lebenszeit. Man kann darin eine Inkonsequenz Gottes sehen (vgl. Westermann, 1999, 306) oder aber auch eine gnädige Strafermäßigung. Doch auch so ist die Strafe hart genug. Sie wird für Schlange, Frau und Mann jeweils spezifisch verhängt. Die Bestrafung von Tieren gehört archaischem Rechtsdenken an. Die Bestrafung der Frau setzt bei ihrer Rolle als ‚Mutter aller Lebendigen‘ an. Diese Auszeichnung wird zwar nicht zurückgenommen, aber die Wertschätzung der Frau wird durch das ihr zugeteilte Leid doch erheblich gemindert. Auch die Bestrafung des Mannes setzt bei seiner Rolle an. Er hat durch Arbeit für den Unterhalt zu sorgen. Gedacht ist an schwere Feldarbeit, den Kampf gegen Dornen und Disteln, die schweißtreibende Anstrengung. Der Mann bleibt sein Leben lang gebunden an seine Scholle. Er bearbeitet die Erde bis zu seinem Tod, d.h. bis er schließlich selbst wieder zu Erde wird. Aber dies mühselige Leben hat er sich selbst zuzuschreiben. Es ist das Ergebnis seiner eigenen Verfehlung. Die Bibel nennt diese Verfehlung Sünde und gebietet dem Menschen, über sie zu „herrschen“ (vgl. Gn 4, 7).
Vergleicht man die beiden Schöpfungsgeschichten, so zeigen sie eine völlig unterschiedliche Anthropologie und Ethik. Für den Vergleich erscheint es sinnvoll, sich die Situation des Menschen vorzustellen, der sie durch die Erzählung einer mythischen Vorgeschichte zu deuten sucht. Dabei ergibt sich für die Priesterschrift folgendes Bild:
Sie beginnt bei der Schilderung der Schöpfung der Welt. Diese stellt eine äußerst gelungene Ordnung dar. Sie findet in der strengen Ordnung des Textes ihre Entsprechung. Alles ist sinnvoll angeordnet: Himmel und Erde, Wasser und Land, Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Fische und Vögel, Landtiere und Menschen, Kräuter und Früchte sowie schließlich Werktage und Ruhetag. Immer wieder wird bestätigt, dass das Geschaffene „gut“ ist. Das Werk als Ganzes ist sogar „sehr gut“.
Eine besondere Beachtung verdient die Stellung des Menschen in ihr. Mann und Frau sind gleichrangig. Sie haben eine herausgehobene Stellung auf der Erde, denn sie dürfen sich als Lebewesen verstehen, die von Gott ausgezeichnet sind. Sie sind ein Ebenbild Gottes. Als solche sind sie Herrscher über alle Lebewesen und machen sich die Erde untertan. Für ihre Ernährung ist gesorgt, Vermehrung ist ihnen aufgetragen. Angedeutet wird, dass auch sie die Unterscheidung von Werktag und Ruhetag in Anspruch nehmen dürfen. Die Priesterschrift schildert die Situation des Menschen ausschließlich mit positiven Aussagen. Es gibt keine negativen Aspekte, keinerlei Einschränkungen, nicht einmal Andeutungen dazu.
Ganz anders stellt sich der Schöpfungsbericht des Jahwisten dar, wenn man ihn aus der Perspektive der Situation heraus interpretiert, zu der dieser Bericht die mythische Vorgeschichte bildet: Die gegenwärtige und seit jeher erfahrbare Situation des Menschen stellt sich so dar: Das Leben des Menschen ist mühselig und qualvoll. Die Arbeit ist schwer, die der Erde abgetrotzte Ernte spärlich. Das Leben der Frau ist nicht besser. Die Schwangerschaft ist beschwerlich, die Geburten sind schmerzvoll. Außerdem hat sie sich ihrem Mann unterzuordnen; er ist ihr Herr. Es gibt keinen Genuss und keine Aussicht auf ein besseres Leben. Der Weg dazu ist versperrt. Am Ende eines arbeitsreichen Lebens steht der Tod. Dieses kümmerliche Leben ist das Ergebnis einer selbstverschuldeten Verfehlung. Mit seinen Verfehlungen, seiner Sünde, hat der Mensch das Leben verdient, das er führen muss. Er kann niemand anderen dafür verantwortlich machen.
Der Gegensatz beider Schilderungen könnte größer nicht sein. Will man die positive Botschaft der Priesterschrift auf eine anthropologische Formel bringen, so lautet sie: Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Die negativ gefärbte Anthropologie des Jahwisten lautet: Der Mensch ist ein Sünder. Beide bilden einen Kontrast. Nach den vorliegenden Texten schließen sie sich gegenseitig aus. Der Mensch, der ein Ebenbild Gottes ist, ist kein Sünder; der Sünder kein Ebenbild Gottes. Die ethischen Konsequenzen sind entsprechend unterschiedlich. Nach der ersten Schöpfungsgeschichte erhält der Mensch einen Auftrag: Als Ebenbild Gottes soll und darf sich der Mensch vermehren, über alle Lebewesen herrschen und sich die Erde untertan machen; nach der zweiten soll sich der Mensch als Sünder vor weiteren Verfehlungen hüten, um zusätzliche Strafen zu vermeiden.
Die Wirkungsgeschichte beider Bestimmungen des Menschen ist ebenfalls unterschiedlich. Die Ebenbild-Formel verläuft eher untergründig. Sie erlebt nach einer langen Phase der Latenz in der Renaissance eine kurze Blüte, so z.B. bei Pico della Mirandola, der dem Menschen die Annäherung an sein göttliches Urbild zutraut, um dann wieder zu verstummen. Lediglich das Gebot der Vermehrung nimmt die katholische Kirche sehr ernst.
Die Paradiesgeschichte hat ihre unverwechselbare Wirkung im Bereich der Religionsgeschichte und der Geschichte der Theologie gezeitigt. Das Christentum ist ohne sie nicht zu denken. Der Mensch ist nach seinem Verständnis der erlösungsbedürftige Sünder. Paulus betont: „der Sünde Sold ist Tod“ (Röm. 6, 23). Jesus tritt auf mit dem bereits von Johannes dem Täufer vorgetragenen Aufruf: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“ (Mt 3,2). Seine Kreuzigung wird im Christentum als Opfertod zur Erlösung der Menschen von den Sünden interpretiert. Ohne die Sündhaftigkeit des Menschen verlöre der Opfertod Christi seinen Sinn. Noch der gekreuzigte Jesus verspricht einem der mit ihm Gekreuzigten: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein“ (Luk. 23, 43). Dieses Verständnis hat die weitere Geschichte des Christentums bestimmt. Betont wird die Sündhaftigkeit des Menschen, nicht seine Ebenbildlichkeit im Verhältnis zu Gott. Für Augustinus stehen Erbsünde und Gnadenwahl im Zentrum seines Denkens. Luthers Rechtfertigungslehre ist ohne den Begriff der Sünde nicht denkbar, und Kierkegaard sieht in der Verzweiflung des Sünders vor Gott die einzige Möglichkeit der Rettung (vgl. Kierkegaard, 1962, 77).
In jüngerer Zeit hat Claus Westermann (Westermann, 1999) in seinem gründlichen und lehrreichen Genesiskommentar versucht, beide Definitionen des Menschen zu harmonisieren. Er vertritt mit anderen Theologen die erstaunliche These, dass „das Menschenverständnis der P kein grundlegend anderes ist als bei J“ (ebd. 794). Als einen beide Texte vermittelnden Begriff führt er im Anschluss an Karl Barth den des „Gegenüber“ ein. Danach ist der Mensch das personale Gegenüber Gottes. Auch der Mensch als „Ebenbild Gottes“ sei aus seiner „Verantwortlichkeit“ gegenüber Gott zu verstehen. Als Beleg wird Gottes Frage an den Menschen: „Adam, wo bist du?“ (ebd. 804) angeführt. Doch dieser Harmonisierungsversuch kann nicht überzeugen. Ein Begriff der Priesterschrift (Ebenbild Gottes) wird mit einem Zitat aus der Schrift des Jahwisten (Paradiesmythos) erläutert. Das ist methodisch fragwürdig. Im Gegensatz zu dieser Interpretation betont daher Kurt Flasch zu Recht: „Bei genauerem Hinsehen sind die beiden Erzählungen unvereinbar“ (Flasch, 2005, 26f.).
Nach der Priesterschrift erhält der Mensch von Gott einen Auftrag, den er zu erfüllen, nicht aber zu erörtern oder gar in Frage zu stellen hat. Obwohl der Mensch Ebenbild Gottes ist, bleibt Gott in einer erhabenen Distanz. Der Gedanke eines personalen Gegenübers hat lediglich in der Paradiesgeschichte seinen Ort. Nur hier gibt es den Wechsel von Frage und Antwort, von Anklage und dem Versuch der Rechtfertigung. Die Differenz bleibt bestehen: ‚Ebenbild Gottes‘ und ‚Sünder‘ sind im Kontext der Erzählungen, in denen sie verwendet werden, unvereinbare Gegensätze. Man wird sich damit abfinden müssen, dass die Genesis zwei sehr unterschiedliche Konzepte des Menschen entwirft. Allerdings, beide Texte stimmen in einer wesentlichen Aussage überein: Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes.