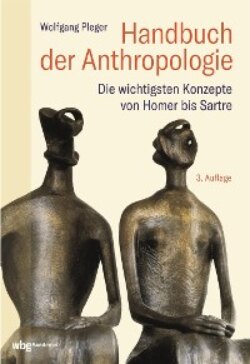Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Körper und Geist (Descartes)
Оглавление„Nun, erstens bemerke ich hier, daß zwischen Geist und Körper insofern ein großer Unterschied besteht, als der Körper seiner Natur nach stets teilbar, der Geist hingegen durchaus unteilbar ist. Denn, in der Tat, wenn ich diesen betrachte, d.h. mich selbst, insofern ich nur ein denkendes Wesen bin, so kann ich in mir keine Teile unterscheiden, sondern erkenne mich als ein durchaus einheitliches und ganzes Ding. Und wenngleich der ganze Geist mit dem ganzen Körper verbunden zu sein scheint, so erkenne ich doch, daß, wenn man den Fuß oder den Arm oder irgendeinen anderen Körperteil abschneidet, darum nichts vom Geiste weggenommen ist. Auch darf man nicht die Fähigkeiten des Wollens, Empfindens, Erkennens usw. als seine Teile bezeichnen, ist es doch ein und derselbe Geist, der will, empfindet und erkennt. Im Gegenteil aber kann ich mir kein körperliches, d.h. ausgedehntes Ding denken, das ich nicht in Gedanken unschwer in Teile teilen und ebendadurch als teilbar erkennen könnte, und das allein würde hinreichen, mich zu lehren, daß der Geist vom Körper gänzlich verschieden ist, wenn ich es noch nicht anderswoher zur Genüge wüßte.“ (R. Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg 1977, 153ff.).
René Descartes wird 1596 in La Haye in der Touraine geboren. 1604–1612 besucht er das jesuitische Collège Royale in La Flèche (Anjou). 1616 erwirbt er das Baccalaureat und Lizenziat der Rechte an der Fakultät zu Poitiers. Nach einer militärischen Ausbildung in Holland meldet er sich 1620 als Freiwilliger zum Kriegsdienst in den bayerischen Truppen und nimmt unter Tilly an einigen der ersten Feldzüge des Dreißigjährigen Krieges teil. 1628 emigriert er in die Niederlande. 1632 bekommt er Kontakt zu Constatin Huygens, dem Sekretär des Prinzen von Oranien. 1647 beginnt sein Briefwechsel mit der Königin Christine von Schweden, und 1649 folgt er ihrer Einladung nach Stockholm. Dort stirbt er 1650. Die Kirche setzt seine Schriften 1663 auf den ‚Index Romanus‘ (vgl. Schultz, 2001).
René Descartes lebte in einer Zeit geschichtlicher Umbrüche. Zwei von ihnen verdienen eine besondere Erwähnung. Der eine hat seinen Ausgangspunkt in theologischen Fragen, nimmt aber bald allgemeine politische Dimensionen an und weitet sich zu einem geschichtlichen Ereignis größter Tragweite aus. Es handelt sich um die Spaltung der Einheit der Kirche in zwei Glaubensrichtungen, die Europa erschüttert und im ‚Dreißigjährigen Krieg‘ ihren Höhepunkt findet. Descartes hat den 1648 abgeschlossenen Westfälischen Frieden nur um zwei Jahre überlebt.
Der andere Umbruch hat das Selbstverständnis der Menschen nicht weniger erschüttert. Er betraf die Ersetzung des geozentrischen Weltbildes durch das heliozentrische. Galilei, der seit 1610 sich öffentlich zu dem heliozentrischen Weltsystem von Kopernikus bekannte, wurde 1633 von der Kirche gezwungen, „seinem Irrtum“ abzuschwören. Descartes, der das neue Weltbild übernahm, verzichtete nun darauf, seine Schrift Le monde, die diese Lehre enthielt, zu veröffentlichen. Bereits 1628 hatte er seinen Wohnsitz in das liberale Holland verlegt. Gleichwohl vermied er einen Bruch mit den Autoritäten der katholischen Kirche. Vielmehr suchte er in seinen Schriften deren Einverständnis zu erreichen. So widmete er seine Meditationen der theologischen Fakultät der Universität von Paris und bemühte sich darzulegen, dass sein Gottesbeweis in besonderer Weise geeignet sei, auch Nichtgläubige zu überzeugen. Tatsächlich aber war sein eigener philosophischer Ansatz, der zu einer Neubegründung nicht nur der Naturwissenschaften, sondern der Wissenschaften überhaupt führen sollte, mit der von der Kirche vertretenen aristotelisch-scholastischen Methode nicht zu vereinbaren. Descartes sah sich deshalb gezwungen, in seinen Formulierungen zu lavieren, und er bekannte sich auch gegenüber Freunden zu dem Wahlspruch: ‚larvatus prodeo‘, d.h. ich trete mit einer Maske auf. Aber der Konflikt mit der Institution der Kirche war nur die äußere Erscheinungsweise eines tiefer gehenden Konflikts, und der betraf das Selbstverständnis des Menschen in seinen Fundamenten.
Descartes sah sich herausgefordert, diese Fundamente selbst neu zu legen. Die Metapher des Fundaments spielt daher in seiner Philosophie eine entscheidende Rolle. In dem Discours de la methode aus dem Jahre 1637 führt er als Beispiel an, „daß manch einer sein eigenes Haus abreißen läßt, um es wieder aufzubauen, und daß er manchmal sogar dazu gezwungen ist, wenn Gefahr droht, daß es von selbst einstürzt und seine Fundamente nicht ganz sicher sind“ (Descartes, 1990, 23). In dieser Situation aber sah Descartes sich und seine Zeitgenossen. Das Ziel seiner philosophischen Bemühungen war es, ein neues, unerschütterliches Fundament zu legen, ein „fundamentum inconcussum“. Auf ihm sollte ein neues tragfähiges wissenschaftliches Gebäude errichtet werden.
Dieses Konzept umfasste auch eine neue Wissenschaft vom Menschen. Wenn man genau hinsieht, ergeben sich sogar zwei Argumentationslinien für die Anthropologie. Nach der einen darf Descartes als Begründer der Philosophie der Subjektivität angesehen werden (vgl. Kap. XII), nach der anderen als Repräsentant einer dualistischen Substanzmetaphysik. In der weiteren Geschichte bilden sie den Ausgangspunkt für zwei auseinanderlaufende Linien. Bei Descartes sind sie jedoch noch miteinander verbunden. Seine Theorie der Subjektivität mündet ein in eine dualistische Anthropologie. Die Schritte seines Denkens folgen dabei dem von ihm entworfenen Bild des Abrisses und des Neubaus eines Hauses. Genau genommen sind es drei Schritte: a) Abriss des alten Hauses, b) Freilegung bzw. Entdeckung eines tragfähigen Fundaments und c) Bau eines neues Hauses.
Zunächst verabschiedet sich Descartes von dem tradierten Bücherwissen, d.h. von dem aristotelisch-scholastischen ‚Lehr-Gebäude‘ seiner Zeit, da er in ihm nur eine Ansammlung sich widersprechender Meinungen finden kann. Daher entschloss er sich, „kein anderes Wissen zu suchen, als was ich in mir selbst oder im großen Buche der Welt würde finden können“ (ebd. 17).
Descartes beginnt mit dem ‚Buch der Welt‘. Das dadurch gewonnene Wissen ist zunächst das der sinnlichen Wahrnehmung. Doch die ist voller Täuschung. So erscheint der in der Ferne wahrgenommene Turm rund, aus der Nähe betrachtet viereckig (vgl. Descartes, 1977, 137). Und selbst die eigene Körperwahrnehmung, die beglaubigt wird durch das Betasten mit den Händen, ist trügerisch, denn sie ist im Traum genauso gegeben. Unabhängig von diesen sinnlich wahrnehmbaren Dingen sind jedoch die mathematischen Gegenstände der Arithmetik und der Geometrie. Doch abgesehen von der stets gegebenen Möglichkeit des Irrtums, ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, dass „irgendein böser Geist“ (ebd. 39) ihn stets täusche.
Doch nun taucht der entscheidende Gedanke auf, der jede Skepsis überwindet und die Täuschungsversuche des „bösen Geistes“ ins Leere laufen lässt, denn „wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, daß ich bin. Er täusche mich, soviel er kann, niemals wird er doch fertigbringen, daß ich nichts bin, solange ich denke, daß ich etwas sei“ (ebd. 43). Daraus folgt, „daß dieser Satz: ‚Ich bin, ich existiere‘, sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist“ (ebd. 45). Descartes folgt hier im Wesentlichen der Argumentation von Augustinus (vgl. Kap. II, 2). Die Leistungen des Ichs beinhalten nicht nur Denken und Sprechen. Ein ‚denkendes Wesen‘ ist vielmehr „ein Wesen, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will und das sich auch etwas bildlich vorstellt und empfindet“ (ebd. 51). Entscheidend ist allerdings die Verbindung des Satzinhalts ‚ego cogito‘ mit dem Akt des Sprechens oder Denkens; denn nur im Akt des Denkens ist sich der Denkende seiner Existenz gewiss. Das räumt Descartes ein: „Denn vielleicht könnte es sogar geschehen, daß ich, wenn ich ganz aufhörte zu denken, alsbald auch aufhörte zu sein“ (ebd. 47). Bis zu diesem Schritt seiner Überlegungen bewegt sich Descartes in den Bahnen einer Philosophie der Subjektivität. Das Subjekt besteht in nichts anderem als in den Akten des Denkens.
Doch nun macht er einen bemerkenswerten Sprung. Dieser Sprung vollzieht sich unauffällig in folgenden Sätzen: „Ich bin also genau nur ein denkendes Wesen, d.h. Geist, Seele, Verstand, Vernunft (…). Ich bin aber ein wahres und wahrhaft existierendes Ding, doch was für ein Ding? Nun, ich sagte es bereits – ein denkendes“ (ebd. 47ff.). Aus den episodischen, d.h. zeitlich befristeten, Akten des Denkens ist eine Substanz geworden, die als Substanz den Charakter des ‚Zugrundeliegenden‘ und ‚Bleibenden‘ hat. Aus dem denkenden Subjekt ist eine Denksubstanz geworden. Edmund Husserl, der selbst ein Repräsentant einer Philosophie der Subjektivität ist, kritisiert in seinen Pariser Vorträgen Descartes, der „mit der unscheinbaren, aber verhängnisvollen Wendung, die das ego zur substantia cogitans (…) macht“ (Hua I, 9), sich von dem Konzept der Subjektivität verabschiedet habe. Husserls Einwand lautet: Mit dem Begriff der ‚denkenden Substanz‘ ist bei Descartes der Gedanke verbunden, „ein kleines Endchen der Welt gerettet“ zu haben, wohingegen das Subjekt gerade dadurch ausgezeichnet ist, dass es seine Weltlosigkeit akzeptiert (vgl. Kap. XII, 2).
Nachdem Descartes nun wieder in die Bahn der Metaphysik der Substanz eingebogen ist, geht es ihm im Folgende darum, von diesem unerschütterlichen ontologischen Fundament aus die Existenz der Welt, die in der konsequent angewendeten Methode des Zweifels verlorengegangen war, wiederzugewinnen, d.h. von dem kleinen „Endchen der Welt“ aus die ganze zu erschließen. Den Weg, auf dem er diesen Versuch unternimmt, geht er über den Gottesbeweis. Ähnlich wie Augustinus die „ungeheuren Räume seines Gedächtnisses“ durchmustert, geht Descartes vor. Er sagt:
„Ich werde jetzt meine Augen schließen, meine Ohren verstopfen und alle meine Sinne ablenken (…) mit mir allein will ich reden, tiefer in mich hineinblicken und so versuchen, mir mein Selbst nach und nach bekannter und vertrauter zu machen“ (Descartes, 1977, 61).
Dabei taucht eine Fülle von Vorstellungen auf, als deren Urheber er sich selbst annehmen darf.
Allein bei der „Vorstellung Gottes“ verhält es sich anders. Sie bedeutet „eine Substanz, die unendlich, unabhängig, allwissend und allmächtig ist und von der ich selbst geschaffen bin ebenso wie alles andere Existierende, falls es solches gibt“ (ebd. 83). Das Attribut ‚unendlich‘ kann seinen Ursprung nicht in der Verneinung der Endlichkeit haben, die das denkende Ich als Merkmal seiner selbst kennt, vielmehr ist umgekehrt die Endlichkeit als Einschränkung und Mangel gegenüber der Unendlichkeit und Vollkommenheit zu verstehen, die mit der Vorstellung Gottes verbunden wird. Descartes betont: Es ist offensichtlich, „daß mehr Sachgehalt (realitas) in der unendlichen Substanz als in der endlichen enthalten ist und daß demnach der Begriff des Unendlichen dem des Endlichen, d.i. der Gottes dem meiner selbst gewissermaßen vorhergeht.“ (ebd.).
Dieser Gottesbeweis folgt im Wesentlichen dem von Anselm von Canterbury. Für ihn folgt aus dem Begriff des ‚Größten‘ der Gedanke, dass nur das das ‚Größte‘ ist, dem auch Existenz zukommt, denn sonst fehlte ihm etwas und es gäbe etwas, das noch größer wäre. Der Schlüsselbegriff lautet bei Descartes ‚realitas‘, d.h. ‚Sachgehalt‘. Die Vorstellung Gottes meint einen ‚Sachgehalt‘ der Unendlichkeit und Vollkommenheit, die das denkende Ich, das schon aufgrund seiner Zweifel sich als mangelhaft, unvollkommen und endlich kennengelernt hat, nicht in sich enthalten kann.
Für Descartes eröffnet sich mit seinem Beweis der Zugang zu den Gegenständen der Welt. Zwar sind Irrtum und unzureichende Erkenntnis für den Menschen auch weiterhin nicht ausgeschlossen, aber zumindest ist nach dem Beweis eines allmächtigen und gütigen Gottes die Macht des „genius malignus“, d.h. eines bösen Geistes, gebrochen (ebd. 99). Das denkende Subjekt darf sich vielmehr darin sicher sein, dass es dort, wo es Sachverhalte in einer solchen Klarheit und Unterschiedenheit vor sich sieht wie die beiden elementaren Gewissheiten, nämlich der seiner selbst und der Gottes, die Wahrheit erkannt hat. Die Art dieser Gewissheiten zeigt, was unter Wahrheit zu verstehen ist. Die Formel lautet: ‚verum est quod clare et distincte percipitur‘, d.h. wahr ist das, was klar und unterschieden wahrgenommen wird (vgl. Descartes, 1990, 63). Die Gegenstände der Welt außerhalb der denkenden Substanz haben eine eigene Struktur. Ihre wesentliche Beschaffenheit ist die Ausdehnung. Sie sind im Unterschied zu der unteilbaren denkenden Substanz teilbar. Descartes folgt hier im Wesentlichen der Argumentation Platons. Teilbare, d.h. ausgedehnte Dinge fasst er unter den Begriff ‚res extensa‘, die unteilbare, denkende Substanz unter den Begriff ‚res cogitans‘. Ausdehnung ist das wesentliche Merkmal der Körper. Insofern der Mensch einen Körper hat, zugleich aber eine denkende Substanz ist, besteht er aus diesen beiden Substanzen: ‚res extensa‘ und ‚res cogitans‘. Die Bestimmung des Verhältnisses beider Substanzen zueinander ist Gegenstand der Anthropologie. Zunächst betont Descartes die relative Eigenständigkeit beider Substanzen, so etwa, wenn er sagt, dass der „Geist“ des Menschen unberührt bleibe, wenn seinem Körper ein Glied abgeschnitten wird, etwa ein „Fuß“ oder ein „Arm“ (vgl. Text).
Descartes hat zur Erläuterung des Gedankens der Unabhängigkeit des Körpers vom Geist den Körper auch mit einer Maschine verglichen, die den Charakter eines Automaten hat. Mit diesem Modell lassen sich sogar Krankheiten erklären. Ein kranker Körper funktioniert wie ein fehlerhafter Automat. Descartes führt diesen Gedanken so aus:
„Ja, ebenso wie eine aus Rädern und Gewichten zusammengesetzte Uhr nicht weniger genau alle Naturgesetze beobachtet, wenn sie schlecht angefertigt ist und die Stunden nicht richtig anzeigt, als wenn sie in jeder Hinsicht dem Wunsche ihres Konstrukteurs genügt, so steht es auch mit dem menschlichen Körper, wenn ich ihn als eine Art von Maschine betrachte, die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Haut so eingerichtet und zusammengesetzt ist, daß, auch wenn gar kein Geist in ihr existierte, sie doch genau dieselben Bewegungen ausführte, die mein Körper jetzt unwillkürlich ausführt und die also nicht vom Bewußtsein ausgehen“ (Descartes, 1977,151).
Nach diesem Modell gäbe es keine Verbindung zwischen Körper und Geist, denn die Abläufe in der Maschine verliefen automatisch. Der Geist könnte den Ablauf der Maschine beobachten, aber nicht beeinflussen.
Doch dieses Modell wirft Fragen auf, die Descartes sich selbst ebenfalls stellte und für die er eine Antwort fand. Das Beispiel von dem abgeschnittenen Arm macht das deutlich. In dem Moment, wenn der Arm abgeschnitten wird, entsteht im Geist, der nicht nur der Ort der Gedanken ist, sondern ebenso, wie Descartes ausdrücklich betont, der der Empfindungen, eine starke Schmerzempfindung. Und diese Gleichzeitigkeit wirft die Frage auf, ob diese in der Amputation ihre Ursache haben könnte. Dazu aber müsste es eine Verbindung von Körper und Geist geben. Und diese Verbindung nimmt Descartes auch tatsächlich an und identifiziert sie als ein besonderes Organ im Gehirn, nämlich die Zirbeldrüse („conarium“). Descartes beschreibt ihre Funktionsweise so:
„Sodann bemerke ich, daß der Geist nicht von allen Körperteilen unmittelbar beeinflußt wird, sondern nur vom Gehirn, oder vielleicht sogar nur von einem ganz winzigen Teile desselben, nämlich von dem, worin der Gemeinsinn seinen Sitz haben soll. Sooft sich dieser Teil nun in demselben Zustand befindet, läßt er den Geist dasselbe empfinden“ (ebd. 155).
Die Zirbeldrüse stellt eine Art Schaltstelle im Gehirn dar, die eine zweifache Funktion erfüllt. Zum einen führt sie dazu, dass z.B. ein schreckenerregender Eindruck beim Menschen eine bestimmte Reaktion hervorruft, z.B. Furcht oder Mut und Kühnheit und dementsprechend zu Flucht oder Verteidigung führt; zum anderen aber überträgt sie Handlungsabsichten des freien Willens auf den Körper und bewirkt bei ihm die entsprechenden Aktionen. Descartes bemerkt: „Alle Tätigkeit der Seele besteht aber darin, daß allein dadurch, daß sie irgendetwas will, sie bewirkt, daß die kleine Hirndrüse, mit der sie eng verbunden ist, sich in der Art bewegt, wie erforderlich ist, um die Wirkung hervorzurufen, die diesem Willen entspricht“ (Descartes, 1996, 69). Auch Descartes bleibt nicht bei einem reinen Dualismus stehen. Die beiden Substanzen müssen auf irgendeine Weise vermittelt werden. Für Descartes ist es eine Drüse. Die Einführung eines vermittelnden Organs wirft allerdings neue Fragen auf, denn es hat eine ganz eigene, einerseits körperlich lokalisierte, andererseits aber geistige Inhalte erzeugende Struktur.
Deutlich wird allerdings, dass Descartes den Menschen nicht zu einem ‚L’homme machine‘ macht, wie hundert Jahre später der Materialist La Mettrie (vgl. Kap. XI, 1). Es sind körperliche Vorgänge, die über das vermittelnde Organ im Gehirn an den Geist weitergeleitet werden. Umgekehrt steuern geistige Leistungen wie Gemeinsinn, Gedächtnis und Phantasie die körperlichen Organe und setzen diese mit Hilfe der sogenannten ‚Lebensgeister‘ (esprits animaux) in Bewegung (Descartes, 1990, 91). Es sind die geistigen Leistungen, die den Menschen auszeichnen und die ausschließen, dass es sich beim Menschen um eine Maschine handeln könnte. Den Beweis dafür liefert der Vergleich mit dem Tier. Das Tier kann man sich – so Descartes – als eine höchst komplizierte Maschine vorstellen; denn: „Wenn es Maschinen mit den Organen und der Gestalt eines Affen oder eines anderen vernunftlosen Tieres gäbe, so hätten wir gar kein Mittel, das uns nur den geringsten Unterschied erkennen ließe zwischen dem Mechanismus dieser Maschinen und dem Lebensprinzip dieser Tiere“ (ebd. 91ff.).
Dagegen kann man sich keine noch so komplizierte Maschine vorstellen, die mit einem Menschen verwechselt werden könnte. Der Grund dafür liegt in der menschlichen Sprache und der Fähigkeit, vernünftig zu handeln. Die Grenze der Maschine besteht in Folgendem: „man kann sich nicht vorstellen, daß sie die Worte auf verschiedene Weisen zusammenordnet, um auf die Bedeutung alles dessen, was in ihrer Gegenwart laut werden mag, zu antworten“ (ebd. 93). Ebenso ist es „unwahrscheinlich“, „daß es in einer einzigen Maschine genügend verschiedene Organe gibt, die sie in allen Lebensfällen so handeln ließen, wie uns unsere Vernunft handeln läßt“ (ebd.). Der Grund dafür liegt darin, dass die Maschinen „nicht aus Einsicht handeln, sondern nur zufolge der Einrichtung ihrer Organe“ (ebd.). Im Unterschied zu den Einzelfunktionen einer Maschine ist „die Vernunft ein Universalinstrument“. Ein Mensch kann daher weder mit einem Tier noch mit einer Maschine verwechselt werden.
Bei seinen moralischen Überlegungen lässt sich Descartes von dem Gedanken leiten, dass eine begründete Ethik erst möglich sei, wenn die Grundlagen für das neue wissenschaftliche Gebäude gelegt sind. Bis dahin sei es notwendig, sich mit einer provisorischen Moral (morale par provision) zu begnügen. Für sie entwirft er vier Grundsätze: Der erste kann als traditionalistisch bezeichnet werden. Er bedeutet, sich nach den bewährten Sitten des Landes, in dem er lebt, zu richten und alle Extreme zu vermeiden. Der zweite Grundsatz bedeutet, in seinem Handeln konsequent zu sein, d.h. eine einmal getroffene Entscheidung beizubehalten, gerade so, wie ein Wanderer, der sich in einem Wald verirrt hat, gut beraten ist, eine einmal eingeschlagene Richtung zu verfolgen und so sicher sein kann, ihn schließlich auch wieder zu verlassen. Der dritte Grundsatz kann als stoische Maxime bezeichnet werden. Er bedeutet die Bereitschaft, „eher mich selbst zu besiegen als das Schicksal, eher meine Wünsche zu ändern als die Weltordnung“ (ebd. 43). Der vierte Grundsatz beinhaltet die Entscheidung, an seiner bisher eingenommenen theoretischen Lebensweise festzuhalten.
Die Wirkungsgeschichte von Descartes verläuft in den beiden unterschiedlichen Bahnen: der Philosophie der Subjektivität einerseits und dem Körper-Geist-Dualismus andererseits. Die Theorie der Subjektivität bildet den Ausgangspunkt für erkenntnistheoretische Fragestellungen, so bei Kant und der sich an ihn anschließenden Wissenschaftstheorie. Sie bildet aber auch den Ausgangspunkt für spezifische anthropologische Fragestellungen, vor allem für das Problem der Intersubjektivität. Das dualistische Konzept dagegen findet seine Fortsetzung in medizinischen und psychologischen Fragestellungen der Psychosomatik und dem Körper-Geist-Problem, das heute in Theorien der Hirnforschung seinen Niederschlag findet. Die von Descartes thematisierten Lebensgeister (esprits animaux) werden dabei als ‚Botenstoffe‘ beschrieben, die körperliche und seelische Prozesse vermitteln.