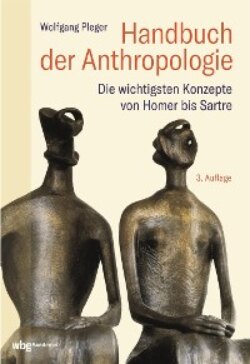Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Der Mensch als Bürger zweier Welten (Kant)
Оглавление„Nun findet der Mensch in sich wirklich ein Vermögen, dadurch er sich von allen andern Dingen, ja von sich selbst, so fern er durch Gegenstände affiziert wird, unterscheidet, und das ist die Vernunft. Diese, als reine Selbsttätigkeit, ist sogar darin noch über den Verstand erhoben: daß, obgleich dieser auch Selbsttätigkeit ist, und nicht, wie der Sinn, bloß Vorstellungen enthält, die nur entspringen, wenn man von Dingen affiziert (mithin leidend) ist, er dennoch aus seiner Tätigkeit keine andere Begriffe hervorbringen kann, als die, so bloß dazu dienen, um die sinnlichen Vorstellungen unter Regeln zu bringen (…), da hingegen die Vernunft (…) ihr vornehmstes Geschäfte darin beweiset, Sinnenwelt und Verstandeswelt von einander zu unterscheiden, dadurch aber dem Verstande selbst seine Schranken vorzuzeichnen. Um deswillen muß ein vernünftiges Wesen sich selbst, als Intelligenz (also nicht von Seiten seiner untern Kräfte), nicht als zur Sinnen-, sondern zur Verstandeswelt gehörig, ansehen; mithin hat es zwei Standpunkte, daraus es sich selbst betrachten, und Gesetze des Gebrauchs seiner Kräfte, folglich aller seiner Handlungen, erkennen kann, einmal, sofern es zur Sinnenwelt gehört, unter Naturgesetzen (Heteronomie), zweitens, als zur intelligibelen Welt gehörig, unter Gesetzen, die, von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern bloß in der Vernunft gegründet sein.“ (I. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant IV, 88).
Kant, der einer Handwerkerfamilie entstammt, wird 1724 in Königsberg geboren. Er besucht in seiner Heimatstadt, nach Absolvierung der Vorstädter Hospitalschule, das pietistische Friedrichskollegium. Die im Pietismus gepflegte ‚Herzensfrömmigkeit‘ hat in ihrer moralischen Intensität Kant vermutlich nicht unwesentlich beeinflusst. Kant bleibt seiner Heimatstadt zeitlebens verbunden. Er studiert an der Universität in Königsberg Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft. 1746 erscheint seine erste Abhandlung Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. In den Jahren 1746–55 ist er bei verschiedenen Familien in der Umgebung Königsbergs als Hauslehrer tätig. Nach seiner Dissertation und einer weiteren Schrift wird Kant 1755 Privatdozent an der Universität Königsberg und hält Vorlesungen über Philosophie, Naturwissenschaft, physische Geographie und Theologie. Nachdem er 1764 eine Professur für Dichtkunst abgelehnt hat, erhält er 1765 die Stelle eines Unterbibliothekars an der Königlichen Schlossbibliothek in Königsberg. 1770 wird Kant ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität und 1786 ein erstes Mal und 1788 ein zweites Mal ihr Rektor. Kant stirbt 1804 (vgl. Schultz, 1972).
Kants Denken ist nicht nur dem Pietismus und der Stoa verpflichtet, sondern darüber hinaus wesentlich der Aufklärung. Die Devise der Autonomie der Vernunft, der Gedanke des Fortschritts, der Meinungsfreiheit und der Respektierung bürgerlicher Rechte, bilden wesentliche Elemente dieses Ansatzes. Kant hat der Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? eine eigene Schrift gewidmet. Seine Antwort lautet: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (Kant VI, 53). Ihr Wahlspruch lautet: „Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ (ebd.). Dieser Mut fehle aber bei einem großen Teil der Menschheit. Kant bemerkt: „Es ist so bequem unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, usw.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen“ (ebd.). Aber nicht minder verhängnisvoll sind die „Vormünder“, die diese Situation ausnutzen und die Unmündigkeit künstlich verlängern, indem sie die Menschen wie „Hausvieh“ behandeln und wie in einem „Gängelwagen“ einsperren, damit sie ja keinen eigenen Schritt tun.
Daher ist es für den einzelnen Menschen schwer, sich aus dieser unseligen Mischung aus Bequemlichkeit und Bevormundung zu befreien. Den Ausweg sieht Kant in folgendem: „Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich“ (ebd. 54). Es ist das Prinzip der Öffentlichkeit, dem Kant den entscheidenden Faktor im Prozess der Aufklärung zuspricht. Von ihr verspricht er sich eine Reform des Denkens, die auch vor dem „Thron“ nicht haltmacht und so zu einer positiven Neuordnung der politischen Verhältnisse führen wird.
Kants Denken geht jedoch auch noch über das Programm der Aufklärung hinaus. Die Forderung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, macht die Prüfung der eigenen Verstandeskräfte nicht überflüssig, sondern geradezu zwingend notwendig, sollen nicht an die Stelle der Bevormundungen durch „Vormünder“ nur die eigenen ungeprüften Meinungen treten. Die Prüfung der Leistungsfähigkeit des menschlichen Verstandes wird daher zu einem zentralen philosophischen Anliegen Kants.
Für dieses Unternehmen gibt es in der Neuzeit eine bedeutende Vorgeschichte. Dazu gehören die rationalistischen Konzepte von Descartes und Leibniz ebenso wie die empiristischen von Locke und Hume. Aber Kants Unternehmen stellt eine ganz eigene Lösung dar, weil er den Ansatz des Rationalismus, der ihm selbst aus seinem Studium der Philosophie her vertraut war und der als das System von Leibniz und Wolff schulbildend gewirkt hatte, mit dem aus England stammenden Konzept des Empirismus in ein Verhältnis setzte. Für Kant erfolgte die Begegnung mit dem Empirismus durch die Auseinandersetzung mit Hume, der ihn, wie er selbst bekennt, aus dem „dogmatischen Schlummer“ riss.
Kant sah sich in seiner Philosophie vor die Aufgabe gestellt, die Ansprüche des Rationalismus und die des Empirismus zu prüfen, überzogene Ansprüche zurückzuweisen und die berechtigten zu akzeptieren. Die Art, dies zu tun, verglich er mit der Aufgabe eines Richters, der die Forderungen zweier streitender Parteien begrenzt und einen gerechten Ausgleich schafft. Die Rolle des Richters kann jedoch nur eine unbestrittene Autorität übernehmen, und das ist die Vernunft selbst. Kant spricht von dem juridischen Charakter der Vernunft. Die Kritik der Vernunft umfasst einen ‚genitivus subjectivus‘ und einen ‚genitivus objectivus‘. Es ist die Vernunft, die kritisiert und die mit Blick auf ihre Leistungsfähigkeit zugleich kritisiert wird. Das Ergebnis ist eine Selbstbegrenzung der menschlichen Vernunft. Diese Selbstbegrenzung ist notwendig, da beide Konzepte der Vernunft, das rationalistische nicht weniger als das empiristische, ihre Grenzen überschritten haben.
Die Begrenzung des rationalistischen Konzepts ist nötig, weil in ihm die Erkenntniskräfte der menschlichen Vernunft überschätzt wurden. Der Rationalismus glaubte, Gott, Welt, Unsterblichkeit der Seele und Freiheit in ihrer Existenz beweisen zu können. Aber diese Bereiche sind nicht ein Gegenstand der Erkenntnis, sondern Ideen der Vernunft. Das Wissen hat sich aus ihnen zurückzuziehen. Kant wirft dem Rationalismus im Übrigen vor, dass er nicht hinreichend Glauben und Wissen unterscheide. In der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft formuliert Kant diesen Gedanken so: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (Kant II, 33).
Ebenso aber galt es, den Anspruch des Empirismus in seinen Grenzen zu bestätigen, aber überzogene Ansprüche zurückzuweisen. Bereits Leibniz hatte die These von Locke, dass nichts in unserem Verstand sei, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen sei, dadurch kritisiert, dass er den Verstand selbst von dieser These ausnahm („Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi intellectus ipse“, Leibniz III 1, 103). Unabweisbar aber ist: Sinnlichkeit und Verstand, Erfahrung und Denken bilden einen Dualismus. Kant bestätigt und begrenzt die Rolle der Erfahrung für die Erkenntnis so:
„Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen (…) und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? (…) Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein Zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen (…) aus sich selbst hergibt“ (Kant II, 45).
Den ‚rohen Stoff sinnlicher Eindrücke‘ kann der Verstand nicht aus sich selbst erzeugen, er muss ihm gegeben sein. An dieser Einsicht des Empirismus hat Kant festgehalten und ihn gegen jede Kritik aus idealistischer Perspektive verteidigt. Dagegen ist der Verstand in seinen Kategorien, mit denen er den ‚rohen Stoff sinnlicher Eindrücke‘ zu Gegenständen der Erfahrung „verarbeitet“, autonom. Die Erkenntnissituation des Menschen ist dadurch charakterisiert, dass sie auf zwei Stämme zurückgreifen muss: den Bereich des Sensiblen und den des Intelligiblen. Kant bezeichnet sie sogar als zwei Welten: den ‚mundus sensibilis‘ und den ‚mundus intelligibilis‘.
In seiner Kritik der reinen Vernunft entwickelt Kant ein Konzept, den Dualismus zu überbrücken, der durch diese zwei Welten entsteht. Es ist die Verbindung des Sensiblen, das den Stoff repräsentiert, mit dem Intelligiblen, für das der Verstand steht. Die Aufgabe der Synthese überträgt Kant dem „transzendentalen Subjekte“ (ebd. 363). Das Sensible, das Material der Anschauung in seiner Mannigfaltigkeit, wird durch das Intelligible, das denkende Ich, als Repräsentant des transzendentalen Subjekts, zu einer Einheit verbunden. Kant nennt sie daher auch die „transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins“. Ohne diese synthetisierende Leistung des transzendentalen Subjekts bliebe die Anschauung pure Mannigfaltigkeit, ohne zu einem, mit sich identischen, Gegenstand der Erfahrung zu werden. Kant bezeichnet die für das Zustandekommen von Erkenntnis entscheidende Leistung des transzendentalen Subjekts als „ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption“ und formuliert sie durch folgenden Grundsatz: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können“ (Kant II, 136). Er begründet ihn so: „denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte“ (ebd.). Seine weitere Erläuterung lautet: „Diejenige Vorstellung, die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird“ (ebd.). In jedem Erkenntnisakt werden Anschauung und Denken durch das Subjekt verbunden und damit der Dualismus überwunden.
Das Problem des Dualismus setzt sich jedoch im Bereich der Ethik fort. Hier stehen sich Sinnlichkeit und praktische Vernunft gegenüber. Der Bereich der Sinnlichkeit ist hier aber nicht ein ‚roher Stoff‘, sondern Teil des Menschen selbst und als solcher mit Strebungen, Bedürfnissen und Motiven ausgestattet. Es ist vor allem das Glücksbedürfnis, das den Menschen zu Handlungen motiviert. Das Glücksbedürfnis ist im Menschen so tief verankert, dass er von ihm niemals absehen kann. Aber es zielt vor allem auf das eigene Wohl, es stellt ‚das liebe Ich‘ in das Zentrum seines Begehrens, es ist egoistisch.
Als Gegenspieler ist die praktische Vernunft anzusehen, die den Menschen als ein vernünftiges Wesen in Anspruch nimmt. Sie fordert ihn dazu auf, seine Handlungsmotive daraufhin zu überprüfen, ob sie mit dem Gesetz der praktischen Vernunft übereinstimmen. Das Gesetz der praktischen Vernunft orientiert sich nicht an dem Wohl des Einzelnen, sondern daran, ob eine Handlung der besondere Fall eines allgemeingültigen Gesetzes sein kann. Vorbild für Kants Gesetzesbegriff ist zum Einen der Gedanke der Widerspruchsfreiheit, der der Logik entstammt, und zum Zweiten die Allgemeingültigkeit von Naturgesetzen. So wie in der Natur allgemeine Gesetze gelten, und das ausnahmslos, so soll auch das menschliche Handeln einem allgemeingültigen Gesetz gehorchen. Egoismus, Ausnahmen und Privilegien, spezielle Vorlieben und Neigungen haben darin keinen Platz.
Die Formulierungen des kategorischen Imperativs, die diese Gedanken ausdrücken, lauten: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant IV, 51) und „handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte“ (ebd.). Bemerkenswert jedoch ist, dass Kant den kategorischen Imperativ in zwei weiteren Formulierungen zur Sprache bringt, in denen nicht die Allgemeinheit des Gesetzes im Zentrum steht, sondern der Gedanke der Person und der eines Reichs der Zwecke (vgl. Kap. X, 3).
In den genannten Formulierungen ergibt sich jedoch ein dualistisches Spannungsverhältnis zwischen dem am eigenen Wohl orientierten Glücksbedürfnis des Einzelnen und der im kategorischen Imperativ formulierten Allgemeingültigkeit. Während das Glücksbedürfnis sich als Neigung artikuliert, hat der kategorische Imperativ den Charakter einer Pflicht. Kants Ethik ist eine Pflichtethik. In ihr werden die vollkommenen und die unvollkommenen Pflichten unterschieden sowie die Pflichten gegen sich selbst und gegen andere. Die vollkommenen Pflichten haben den Charakter von Verboten, die unvollkommenen den von Geboten. Kant entwickelt an Hand von vier Beispielen folgendes Schema der Pflichten (vgl. ebd. IV, 52f.):
| Pflichten: | vollkommene | unvollkommene |
| Gegen sich selbst | Verbot des Selbstmordes | Gebot der Entwicklung eigener Talente |
| Gegen andere | Verbot des lügenhaften Versprechens | Gebot der Hilfe in der Not gegenüber anderen |
Das Beispiel der vollkommenen Pflicht gegen sich selbst bedeutet: Ein Mensch, der des Lebens überdrüssig ist und die Neigung spürt, seinem Leben ein Ende zu setzen, möge sich fragen, ob die Handlung ein allgemeines Gesetz werden könne. Er wird feststellen, dass das nicht der Fall ist, denn die Handlung ist ein Widerspruch einer zweckvollen Natur in sich selbst. Das Beispiel einer vollkommenen Pflicht gegen andere bedeutet: Ein lügenhaftes Versprechen kann kein allgemeines Gesetz werden; denn jede Lüge stellt einen Widerspruch in sich selbst dar, da in ihr die geäußerten Worte und der tatsächliche Wille sich widersprechen.
Das Beispiel einer unvollkommenen Pflicht gegen sich bedeutet: Zwar ist es widerspruchsfrei denkbar, dass jemand die Talente, die in ihm schlummern, unentwickelt lässt, aber es kann nicht der Zweck einer als vernünftig gedachten Natur sein. Das Beispiel einer unvollkommenen Pflicht gegen andere bedeutet schließlich: Zwar ist es möglich, sich widerspruchsfrei eine Natur zu denken, in der jeder nur auf sein Wohl bedacht ist, dem anderen nicht schadet, ihm aber auch in Not nicht hilft. Auch hier gilt: Dieses Handeln ist mit der Idee einer vernünftigen Natur nicht vereinbar.
Nun müssen Pflicht und Neigung keineswegs immer in einem Widerspruch stehen. In manchen Fällen entspricht ein pflichtmäßiges Handeln auch einem klugen Kalkül. So wird ein Kaufmann einen Kunden nicht betrügen, weil er diesen auf Dauer nicht verlieren möchte. Ein anderer hilft einem in Not Geratenen aus einem Gefühl des Mitleids heraus. Doch Kant lässt diese Fälle als Beispiele für moralisches Handeln nicht gelten; denn moralisch ist ein Handeln nur dann zu nennen, wenn das Motiv der Handlung der kategorische Imperativ ist.
Allerdings ergeben sich nun zwei Probleme: Zum einen entsteht die Frage, wie sich bei einer einzelnen Handlung das Motiv feststellen lässt. Kants überraschende Antwort lautet: Überhaupt nicht. Kein Mensch kann bei einer pflichtmäßigen Handlung weder bei einem anderen, noch auch bei sich selbst erkennen, aus welchem Motiv die Handlung erfolgte. Motivforschung stößt auf ein unergründliches Geheimnis.
Das zweite Problem ist nicht minder gravierend: Wie ist es überhaupt möglich, dass die praktische Vernunft zum Motiv einer Handlung wird? Selbst wenn unterstellt wird, dass der Mensch intellektuell dazu in der Lage ist, seine Handlung am Maßstab des kategorischen Imperativs zu prüfen und er dies auch tut, so ist damit keineswegs sichergestellt, dass diese Handlung auch ausgeführt wird. Wie kann das durch seine Sinnlichkeit bedingte, starke Motiv des Menschen, nur an das eigene Wohl zu denken, durch eine Vernunft überwunden werden, deren Reich das Intelligible ist? Kants überraschende Antwort lautet: Die Möglichkeit für ein vernünftiges Handeln besteht in der „Achtung für dieses praktische Gesetz“. Diese Achtung ist ein Gefühl. Auf den Einwand, ein Gefühl gehöre dem Bereich der Sinnlichkeit an, antwortet Kant so:
„Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl ist, so ist es doch kein durch Einfluß empfangenes, sondern durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gefühl und daher von allen Gefühlen der ersten Art, die sich auf Neigung oder Furcht bringen lassen, spezifisch unterschiedren. Was ich unmittelbar als Gesetz für mich erkenne, erkenne ich mit Achtung, welche bloß das Bewußtsein der Unterordnung meines Willens unter einem Gesetze, ohne Vermittelung anderer Einflüsse auf meinen Sinn, bedeutet“ (Kant IV, 27f. Anm.).
Mit dem Gefühl der Achtung verbindet sich die schwer zu beantwortende Frage: Wie kann die Vernunft ein Gefühl „erwirken“, das im Übrigen, wie Kant betont, eines ist, das „meiner Selbstliebe Abbruch tut“? Der Grund, weshalb Kant ein ‚Gefühl der Achtung‘ konzipierte, ist darin zu sehen, dass er, wie bei jedem dualistischen Denken, eine Instanz der Vermittlung brauchte, um den Anspruch der ‚Vernunft‘ gegenüber der natürlich gegebenen ‚Selbstliebe‘ zur Geltung zu bringen. Gehören Gefühle zwar generell dem ‚mundus sensibilis‘ an, so verleiht Kant dem Gefühl der Achtung vor dem Gesetz einen Sonderstatus. Er besteht darin, dass es sich bei ihm um ein von der Vernunft „selbstgewirktes Gefühl“ handelt. Als solches wird ihm die Aufgabe der Vermittlung von Sinnlichkeit und Vernunft nicht nur zugewiesen, sondern auch zugetraut.
Schließlich ist auf ein letztes Problem hinzuweisen: Ein Handeln aus Vernunft macht den Menschen glückswürdig. Aber die Glückswürdigkeit garantiert nicht die Erlangung des Glücks bzw. der Glückseligkeit. Daher ist es denkbar, dass ein Mensch, trotz aller Glückswürdigkeit, in seinem Leben unglücklich bleibt. Nicht selten bleibt dem rechtschaffenen Menschen das Glück versagt, während einem Kriminellen das Glück hold ist. Dieses grobe Missverhältnis verstößt gegen das Denken jedes moralischen Menschen. Doch die Vernunft findet für dieses Problem in diesem Leben keine Lösung.
Die Sehnsucht, dem Menschen möge ‚dereinst‘ ein seiner Glückswürdigkeit entsprechendes Glück zuteil werden, ist eine Hoffnung und gehört als solche in den Bereich der Religion. Kant formuliert diesen Gedanken, der nicht ohne Gott auskommt, so:
„Denn der Glückseligkeit bedürftig, ihrer auch würdig, dennoch aber derselben nicht teilhaftig zu sein, kann mit dem vollkommenen Wollen eines vernünftigen Wesens, welches zugleich alle Gewalt hätte, wenn wir uns auch nur ein solches zum Versuche denken, gar nicht zusammen bestehen“ (Kant IV, 238).
Die Einheit von Glückswürdigkeit und Glückseligkeit repräsentiert das „höchste Gut“. Es verbindet sich mit einer Hoffnung, die auf ein Leben im Jenseits gerichtet ist: „Also ist das höchste Gut, praktisch, nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich“ (ebd. 252).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Kants Denken bewegt sich in dualistischen Kategorien, die sich als Artikulation des Gegensatzes von Leib und Seele verstehen lassen. Entscheidend ist jedoch, dass er den Dualismus immer auch zu überwinden sucht. Beispiele sind dafür die Bereiche der Erkenntnis, der Moral und der Religion. Im Bereich der Erkenntnis ist es die Leistung des transzendentalen Subjekts, Sinnlichkeit und Verstand in der Einheit des Selbstbewusstseins zu verbinden. Im Bereich der Moral ist es das von der praktischen Vernunft hervorgebrachte Gefühl der Achtung vor dem Gesetz, Pflicht und Neigung zu vermitteln. Den Dualismus von Glückswürdigkeit und Glückseligkeit zu überwinden, ist schließlich die entscheidende Hoffnung der Religion.
Kants Wirkungsgeschichte im Bereich der Ethik ist bis heute ungebrochen, auch wenn Utilitarismus und Wertphilosophie zu anderen Lösungen kamen. Während die Wertphilosophie den Formalismus Kants kritisierte und an seine Stelle ein materielles ‚Wertfühlen‘ setzte, rehabilitierte der Utilitarismus die Moral des ‚klugen Kaufmanns‘.
Auch im Bereich der theoretischen Philosophie wurde Kants Lösung des Leib-Seele-Problems nicht allgemein akzeptiert. Für das 19. Jh. sei an eine im Jahre 1872 gehaltene, unter dem Stichwort Ignorabimus-Rede bekannt gewordene, Ausführung des Physiologen Emil Dubois-Reymond erinnert, der eine Erkenntnis der „Verbindung von Leib und Seele im Menschen“ für prinzipiell unmöglich hielt. Allerdings ist sein Ansatz ein völlig anderer als bei Kant. Er versteht die Erkenntnis nicht als eine synthetisierende Leistung des Subjekts, sondern fragt nach der Evolution des Geistes aus der Materie. Die Grenze der Naturerkenntnis sei mit der Annahme überschritten „als könnten durch die Kenntnis der materiellen Vorgänge im Gehirn gewisse geistige Vorgänge und Anlagen uns verständlich werden“ (vgl. Du Bois-Reymond, 1967, 41). Sein definitives Urteil lautet: ‚Ignoramus – Ignorabimus‘: ‚Wir wissen es nicht und wir werden es nicht wissen!‘
An diese Rede erinnert im Jahre 2000 der Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt a. M. Wolf Singer, indem er im Rückblick auf weitere, über 130 Jahre währende neurophysiologische Forschungen zur Frage der Erzeugung geistiger Vorgänge durch das Gehirn bemerkt: „Ich schicke voraus, um keine falschen Erwartungen zu wecken, daß ich der Überzeugung bin, daß diese höchsten Hervorbringungen unserer Gehirne (…) der neurobiologischen Erklärung nicht direkt zugänglich“ sind (Singer, 2002, 62). Die Produktion geistiger Vorgänge durch materielle Vorgänge im Gehirn, von der Du Bois-Reymond sprach, bleibt daher nach wie vor rätselhaft. Zumindest das ‚Ignoramus‘ von Du Bois-Reymond ist bislang nicht überwunden worden.