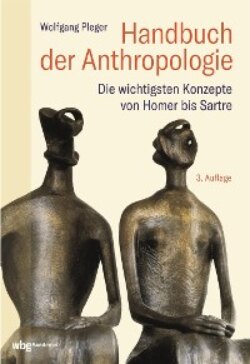Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Erbsünde und Gnadenwahl (Augustinus)
Оглавление„Denn als Gott die Tiere schuf, teils ungesellig (…), teils gesellig, (…) da hat er von beiden Sorten nicht etwa zunächst bloß Einzelwesen geschaffen, aus denen dann die Nachkommen erwachsen sollten, sondern gleich mehrere. Anders den Menschen. Seiner Natur wies er eine Art Mittelstellung an zwischen Engeln und Tieren. Wenn er, dem Schöpfer als seinem wahren Herrn untertänig, sein Gebot in frommem Gehorsam erfüllte, sollte er in den Kreis der Engel aufgenommen werden und, ohne erst sterben zu müssen, die selige, nie endende Unsterblichkeit erlangen; wenn er aber den Herrn, seinen Gott, unter Mißbrauch des freien Willens hochmütig und ungehorsam beleidigte, war ihm bestimmt, dem Tode überantwortet tierisch zu leben, Sklave seiner Lüste zu sein und nach dem Tode der ewigen Verdammnis zu verfallen. Ihn nun schuf Gott als Einzigen und Einzelnen, freilich nicht um ihn allein und ohne menschliche Gesellschaft zu lassen (…). Darum gefiel es ihm, auch das Weib, das dem Manne zugesellt werden sollte, nicht so zu schaffen wie ihn, sondern aus ihm, so daß also das Menschengeschlecht von einem einzigen Menschen sich ausbreitete. (…) Gott wußte freilich, der Mensch werde sündigen und, dem Tode preisgegeben, sterbliche Nachkommen erzeugen, die es in ihrem Sündenfrevel dahin bringen sollten, daß die vernunftlosen Tiere (…) sicherer und friedlicher mit ihren Artgenossen leben als die Menschen (…).“
(Augustinus: Vom Gottesstaat. Buch 11–22, München 1991, 98f.).
Augustinus wird 354 n. Chr. in Thagaste (dem heutigen Souk Ahras in Algerien) geboren. In den Jahren 370–373 studiert er in Karthago Rhetorik. Die Schriften Ciceros und die akademische Skepsis machen einen großen Eindruck auf ihn. Eine erste weltanschauliche Orientierung bietet ihm der Manichäismus, dem er in den Jahren 373–382 angehört. Es handelt sich um eine dualistische Religion der Spätantike, die im Anschluss an ihren persischen Gründer Mani (216–277) die sichtbare Welt, das Reich der Finsternis, als das Werk eines bösen Demiurgen ansieht. Ihr steht die Herrschaft des wahren Gottes, das Reich des Lichts, entgegen. Es gibt Erwählte, Kinder des Lichts, die vom Boten des Lichts erweckt, sich von der sichtbaren Welt, z.B. durch geschlechtliche Enthaltsamkeit, abkehren und so erlöst werden. 375/76 übt Augustinus eine Tätigkeit als Rhetoriklehrer in Thagaste und Karthago aus und 383 in Rom. 384 erhält er eine Stelle als ‚magister rhetoricae‘ in Mailand, wo er auch den Bischof Ambrosius kennenlernt. Dieser hat eine maßgebliche Bedeutung für die Bekehrung Augustins zum Christentum. Außerdem spielen einige Werke des Neuplatonismus, so die von Plotin und Porphyrios, dabei eine wichtige Rolle.
In das Jahr 386 fällt sein Bekehrungserlebnis, das er in seinen confessiones (Bekenntnisse) anschaulich schildert. 387 wird er durch den Bischof Ambrosius getauft. Nach seiner Rückkehr nach Thagaste und Karthago im Jahre 388 wird er im Jahre 390 in Hippo Regius (Nordafrika) – eher unfreiwillig – zum Priester gewählt und 395 ebendort zum Bischof geweiht. In diese Zeit fällt auch der Konflikt mit den Donatisten, eine in den unteren Volksschichten beheimatete religiöse Bewegung, die die sittliche Reinheit der Priester zur Vorbedingung für die Gültigkeit der Sakramente machen will und für die Trennung von Kirche und Staat eintritt. Im Jahr 396 orientiert sich Augustinus theologisch neu. Er entwickelt das Konzept der Gnadenlehre. Nach ihr ist es dem Menschen nicht möglich, sich durch eigenes Nachdenken und sittliches Wollen auf die Gnade vorzubereiten. Vielmehr gebe es einige wenige, die von Gott durch seine unerforschliche Gnade erwählt werden, und die große Zahl der Verworfenen. Dieses neue Konzept führt zu einer heftigen Auseinandersetzung mit den Pelagianern, den Anhängern des Pelagius, die die Bedeutung der Freiheit des Willens und das eigene sittliche Streben betonen und Augustinus den Rückfall in den Manichäismus vorwerfen. Seit dem Jahre 400 bildet seine Gnadenlehre auch die Grundlage für sein Werk De civitate dei (Vom Gottesstaat) das in den Jahren 413–27 entsteht. Augustinus stirbt im Jahre 430, während der Belagerung Hippos durch die Vandalen (vgl. Marrou, 1984; Horn 1995).
Beeinflusst durch die spätantike Philosophie einerseits und die christliche Religion andererseits, bemühte sich Augustinus in seinem Denken darum, zu einer angemessenen Bestimmung des Verhältnisses von Glaube und Vernunft (fides et ratio) zu gelangen. Es war nicht sein Ziel, das vernunftbestimmte Wissen durch den Glauben zu ersetzen, wohl aber zwischen ihnen ein Fundierungsverhältnis auszusprechen. Es ist das Wissen, das in einem Glauben begründet ist. Der Glaube selbst aber kann nicht mehr in Wissen überführt werden.
Das Verhältnis von Glaube und Wissen darf nicht verwechselt werden mit der antiken Gegenüberstellung von Meinung (doxa) und Wissen (episteme). Ziel der antiken Philosophie war es, die Meinungen in Wissen zu überführen. Augustinus dagegen kam es darauf an, den Glauben als unhintergehbaren, letzten Grund allen Wissens aufzudecken. Das Verhältnis von Glaube und Vernunft wird von Augustinus in zweifacher Weise erörtert: zum einen als das Verhältnis zweier Lehrgebäude zueinander, nämlich der Theologie und der Philosophie, zum anderen aber als Verhältnis von zwei Arten der Gewissheit im einzelnen Menschen.
Zu diesem zweiten Aspekt ist folgendes Beispiel erhellend: Für Augustinus gibt es drei Gewissheiten, die sich so formulieren lassen: „Denn wir sind, wissen, daß wir sind, wir lieben dies unser Sein und Wissen“ (Augustinus, 1991, 42f.). Diese Gewissheiten lassen sich auch durch keinen Einwand der Skeptiker widerlegen. Auf ihre Frage: „Wie, wenn du dich täuschst?“ antwortet er vielmehr: „Wenn ich mich täusche, bin ich ja. Denn wer nicht ist, kann sich auch nicht täuschen; also bin ich, wenn ich mich täusche“ (ebd.) Die unbezweifelbare Selbstgewissheit ist ein Wissen, wie Augustinus ausdrücklich betont. Es gibt aber eine Frage, die über dieses wie über jedes Wissen hinausgeht.
Es ist die nach dem Ursprung des eigenen Seins. Der Ursprung des eigenen Lebens lässt sich nur glauben, nicht wissen. Augustinus formuliert diesen Gedanken so:
„Ich frage dich: Wenn man alles das nicht glauben darf, was man nicht weiß, wie sollen dann Kinder ihren Eltern gehorchen und ihre Liebe erwidern, wenn sie nicht glauben, daß dies ihre Eltern sind? Das kann man ja unmöglich aufgrund vernünftiger Einsicht (ratione) wissen. Vielmehr glaubt man in der Frage der Vaterschaft der Aussage der Mutter aufgrund ihrer Autorität. Was die Mutterschaft angeht, so glaubt man gewöhnlich nicht einmal der Mutter, sondern Geburtshelferinnen, Ammen, Dienerinnen“ (Augustinus, 1992, 157).
Darüber hinaus gibt es weitere Fälle, in denen an die Stelle des Wissens der Glaube an eine Autorität tritt. Das ist überall dort der Fall, wo das eigene Wissen zur Beurteilung eines Sachverhalts nicht ausreicht. Jeder „halbwegs einsichtige Mensch erkennt (…) daß es für die Unwissenden nützlicher und heilsamer ist, den Maßregeln der Weisen Folge zu leisten, als nach eigenem Gutdünken ihr Leben zu führen“ (ebd. 159).
Der Übergang vom Wissen zum Glauben spielt aber nicht nur für das Leben des einzelnen Menschen eine entscheidende Rolle, sondern auch im Verhältnis von Philosophie und Theologie. Ein wichtiges Beispiel stellt die Frage der Kosmologie dar. Für die antike Philosophie besteht die Welt von Natur aus, d.h. sie besteht von sich aus. Sie ist eine Ordnung, die ihren natürlichen Kreisläufen unterworfen ist. Dieses Weltverständnis kann Augustinus als christlicher Theologe nicht akzeptieren. Deshalb entwickelt er auch hier einen Gedanken, der von der der Vernunft zugänglichen Existenz der Welt zu ihrem Ursprung führt. Dieser kann nur geglaubt werden. Augustinus formuliert das so:
„Von allem Sichtbaren ist die Welt das größte, von allem Unsichtbaren Gott. Daß aber eine Welt vorhanden ist, sehen wir, daß Gott ist, glauben wir. Daß aber Gott die Welt geschaffen hat, glauben wir niemandem sicherer als Gott selber. Wo haben wir ihn gehört? Nun, einstweilen nirgendwo besser als in der Heiligen Schrift, wo sein Prophet spricht: ‚Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde‘“ (Augustinus, 1991, 6f.).
Die Existenz der Welt ist der Anschauung und damit der Vernunft zugänglich, ihr Ursprung aber kann nur geglaubt werden. Mit dem Glauben an die Erschaffung der Welt verbindet sich aber ein weiterer Gedanke. Es ist der von einem zeitlichen Anfang und einem zeitlichen Ende der Welt. Damit ist der antike Gedanke des Kreislaufs unvereinbar. Kreislauf, das bedeutet für Augustinus die ewige Wiederkehr des Gleichen. Das aber bedeutete, dass Plato „schon unzählige Male in weiter zurückliegenden Jahrhunderten (…), dieselbe Schule und dieselben Schüler“ gehabt hätte. Er fährt fort: „Ausgeschlossen, so etwas zu glauben! Denn einmal nur ist Christus für unsere Sünden gestorben, ‚auferstanden aber von den Toten, stirbt er hinfort nicht mehr (…)‘“ (ebd. 81). Wenn es aber keine ewigen Kreisläufe gibt, sondern einen bestimmten Anfang und ein bestimmtes Ende der Welt, dann muss auch die Zeit selbst etwas Endliches sein. Genau das behauptet Augustinus. Mit der Welt hat Gott die Zeit selbst erschaffen (vgl. Augustinus, 1994, 311). Es gibt keine Zeit vor dem Anfang der Welt. Das Fazit ist: Der Glaube an die Erschaffung der Welt gründet sich auf den Glauben an die Autorität der ‚Heiligen Schrift‘. Bemerkenswert ist jedoch, dass Augustinus den Glauben außerdem auch auf das Argument einer natürlichen Theologie stützt. Er sagt:
„Denn auch abgesehen von den Prophetenstimmen verkündet die Welt selber, obschon stillschweigend, durch ihre wohl geordnete Wandelbarkeit (…) und die wundervolle Formschönheit alles Sichtbaren, sowohl daß sie geschaffen ist als auch, daß nur der unsagbar und unfaßlich (...) schöne Gott sie geschaffen haben kann“ (Augustinus, 1991, 7).
Diese Aussage hat jedoch nur den Charakter eines Hilfsarguments. Der Hauptakzent liegt auf der Autorität der Bibel. Der Glaube an die Autorität der Bibel verbindet sich für Augustinus in zunehmendem Maße mit dem Glauben an die Autorität der katholischen Kirche, die als einzige legitime Interpretin des Glaubens verstanden wird. Mehr noch: Als Bischof setzt er zur Durchsetzung der kirchlichen Autorität und zur Erfüllung des Missionsauftrags auch Gewalt ein.
Bei einem Blick auf die Anthropologie sei auf zwei Aspekte hingewiesen: Es ist zum einen die Dimension der Innerlichkeit, und es sind zum anderen seine Aussagen über den Menschen als Geschöpf Gottes. Der Bereich der Innerlichkeit erhält bei Augustinus eine bis dahin nicht gekannte Aufmerksamkeit. Die antike Devise der Selbsterkenntnis stößt bei ihm in neue Dimensionen vor. Bereits in seiner Schrift De vera religione – Über die wahre Religion – von 391 hat Augustinus den Weg nach Innen postuliert: „Geh nicht nach draußen, kehr wieder ein bei dir selbst! Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit“ (Augustinus, 1991 a, 123). In seinem Buch Bekenntnisse führt er diese Devise aus, indem er die Leistung der ‚memoria‘, d.h. des Gedächtnisses, beschreibt. Angemessener wäre es, das Wort mit ‚Bewusstsein‘ zu übersetzen, denn es umfasst neben der Erinnerung und dem Gedächtnis ebenso die Phantasie und das Selbstbewusstsein. Augustinus führt aus:
„Ich unterscheide den Duft der Lilie von dem des Veilchens, obgleich ich nichts davon rieche, und ziehe in bloßer Erinnerung, nichts schmeckend oder befühlend, Honig dem Most, das Glatte dem Rauhen vor./Im Innern tue ich dies, im ungeheuren Raume meines Gedächtnisses. Dort sind mir gegenwärtig Himmel, Erde, Meer und alles, was ich von ihren Dingen mit meinen Sinnen fassen konnte, nur jenes nicht, was ich vergessen habe. Dort begegne ich auch mir selbst und erlebe es noch einmal, was und wann und wo mein Tun gewesen und was ich bei diesem Tun empfunden. (…) Groß ist die Macht meines Gedächtnisses, gewaltig groß, o Gott, ein Inneres, so weit und grenzenlos. Wer ergründet es in seiner ganzen Tiefe? Diese Kraft gehört meinem eigenen Ich hier an, sie ist in meiner Natur gelegen, und gleichwohl fasse ich selber nicht ganz, was ich bin. So ist der Geist zu eng, sich selbst zu fassen. (…) Ein groß Verwundern überkommt mich da, Staunen ergreift mich über diese Dinge./Und da gehen die Menschen hin und bewundern die Höhen der Berge, das mächtige Wogen des Meeres, die breiten Gefälle der Ströme, die Weiten des Ozeans und den Umschwung der Gestirne – und verlassen dabei sich selbst“ (Augustinus, 1961, 178f.).
Der Text beschreibt das Staunen des Menschen über sich selbst. Es ist eine ähnliche Mischung aus Bewunderung und Beklemmung, die auch in dem Chorlied in Sophokles’ Antigone angesprochen wird. Doch hier sind es nicht die erstaunlichen Leistungen des Menschen in der Welt, die dieses Gefühl auslösen, sondern das Innere des Menschen, eine Dimension, die er als eigene Kraft begreift, die zugleich aber sein Fassungsvermögen übersteigt. Es ist auch nicht der Mensch überhaupt, der Staunen erregt, sondern das eigene Ich.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich eröffnet die Möglichkeit des Selbstbewusstseins und des Selbstgesprächs. Augustinus hat unter dem Titel Soliloquia (Selbstgespräche) dazu ein eigenes Buch verfasst. Für ihn erweitert sich das Selbstgespräch zu einem Gespräch mit Gott. In einem Dialog mit der personifizierten Vernunft macht er deutlich, was ihn allein interessiert: „Vernunft: Was willst du also wissen? (…) Augustinus: Gott und die Seele will ich erkennen. Vernunft: Weiter nichts? Augustinus: Gar nichts“ (Augustinus, 1986, 19).
Der zweite Bereich seiner Anthropologie betrifft den Menschen als Geschöpf Gottes. Hier interpretiert Augustinus den biblischen Schöpfungsmythos (vgl. Text). Er verbindet beide Schöpfungsgeschichten zu einer Einheit, bei der, der christlichen Theologie entsprechend, der Paradiesmythos den Leitfaden bildet. Und doch ist die Art der Verbindung beider bei ihm bemerkenswert:
Zunächst betont er, dass im Unterschied zu den Tieren der Mensch als Einzelwesen geschaffen wurde. Die Diskrepanz zum Ebenbild-Mythos und die dort betonte Gleichursprünglichkeit von Mann und Frau wird dabei übergangen. Der Ursprung der Menschheit aus einem Menschen hat für ihn eine doppelte symbolische Bedeutung. Indem Gott Adam als „Ahnherrn der großen Menge“ schuf, verband er mit ihm den Gedanken, „daß dank dieser Mahnung bei den Vielen Eintracht und Einigkeit gewahrt bleibe“ (Augustinus, 1991, 106). Die zweite Bedeutung ergibt sich aus der Erschaffung Evas. Indem sie aus Adams Rippe entsteht, wird zum Ausdruck gebracht, „wie innig vertraut die Verbindung von Gatte und Gattin sein soll“ (ebd.). Mit dieser Interpretation gibt Augustinus dem Paradies-Mythos eine neue Wendung, die die Gleichrangigkeit von Mann und Frau stärker betont.
Der zweite Aspekt betrifft die Mittelstellung des Menschen „zwischen Engeln und Tieren“. Hier klingt die Ebenbild-Formel deutlich an, die Augustinus wenig später auch nennt. Er macht einen eindeutigen Unterschied zwischen der Situation des Menschen vor und nach dem „Sündenfall“. Vor dem Sündenfall ist der Mensch frei und hat die Möglichkeit, in den „Kreis der Engel“ aufgenommen zu werden. Ihm wird sogar – im Gegensatz zum Wortlaut des Textes – Unsterblichkeit zugebilligt. Den „freien Willen“ hat er jedoch missbraucht und durch eine einzige Handlung zugleich verloren. Nun ist er ein „Sklave seiner Lüste“, dem „Tode überantwortet“ und gezwungen, „tierisch zu leben“. Mehr noch: Statt der ihm zugedachten Eintracht führt er Kriege, wie sie bei Tieren nicht stattfinden; denn „weder haben Löwen untereinander Kriege geführt noch Drachen, wie die Menschen es tun“ (ebd. 99f.). Die Sündhaftigkeit des Menschen bildet auch die Grundlage seiner Ethik. In ihr setzt er sich mit der stoischen Ethik seiner Zeit auseinander. Ihre Ziele seien die Lust, die Tugend oder die Ruhe oder eine Kombination von ihnen. In jedem Fall aber „wollen sie in erstaunlicher Verblendung hier glückselig sein und durch sich selbst glückselig werden“ (ebd. 529). Doch dieser Versuch kann nicht gelingen:
„Denn wer vermöchte es wohl, und ergösse sich seine Beredsamkeit wie ein Strom, das Elend dieses Lebens zu schildern? (…) Verlust oder Schwächung von Gliedern zerstört des Menschen Unversehrtheit, Entstellung seine Schönheit, Siechtum seine Gesundheit, Mattigkeit seine Kraft, Steifheit oder Lähmung seine Beweglichkeit; und was von alledem könnte nicht auch über des Weisen Leiblichkeit hereinbrechen?“ (ebd. 529f.).
Ebenso lassen die Fähigkeiten der Sinne im Alter nach. Doch nicht nur der Körper, auch die geistigen Kräfte sind vor Zerstörung nicht gefeit: „Die Vernunft aber und das Erkenntnisvermögen, wohin entweichen, wo schlummern sie, wenn infolge einer Erkrankung der Geist sich verwirrt?“ (ebd.). Das Fazit ist: Das von den Philosophen gelehrte Glück ist in diesem Leben nicht zu erreichen. Das höchste Gut ist das „ewige Leben“, und das liegt im Jenseits. Doch wer darf dieses für sich erhoffen? Die Antwort auf diese Frage gibt Augustinus in seiner Sünden- und Gnadenlehre. Ihre Ausführung bildet das Thema seines Werkes De civitate dei.
Die deutsche Übersetzung Vom Gottesstaat gibt den Begriff nur unzureichend wieder. Es handelt sich nicht um einen Staat im Unterschied zur Gesellschaft, sondern er ist eher als eine Gemeinschaft zu verstehen. Der richtige Begriff ergibt sich aus seinem Gegensatz, der ‚civitas terrenae‘. Es ist der Gegensatz zwischen einer Gott zugewandten Gemeinschaft und einer an der Welt orientierten. Ausgangspunkt für das Entstehen dieser beiden Gemeinschaften ist der mit Adam eingetretene „Sündenfall“. Die durch ihn entstandene Schuld überträgt sich auf alle seine Nachkommen, d.h. auf die gesamte Menschheit. Das Tradieren der Sünde auf die Nachkommen heißt Traduzianismus; sein Thema ist die „Erbsünde“. Augustinus bemerkt:
„Denn Gott, der Urheber der Naturen, nicht der Gebrechen, hat den Menschen wohl gut erschaffen, doch der, durch eigene Schuld verderbt und dafür von Gott gerecht verdammt, hat verderbte und verdammte Nachkommen erzeugt“ (ebd. 1991, 124).
Durch die Erbsünde sind nicht nur alle Menschen, von Geburt an, schuldig, sie können sich auch nicht aus eigener Kraft von dieser Schuld befreien. Zwar gibt es Stellen, in denen Augustinus den Menschen vor eine freie Wahl zu stellen scheint, so wenn er sagt: „In jedem Menschen wohnt innen ein Imperator (…). Gott wollte in deinem Willen sein, biete ihm Raum, Gott oder dem Teufel. Wenn du ihm Raum gegeben hast, wird er herrschen“ (Flasch, 1994, 190). Doch dieser Gedanke wird wieder zunichte gemacht durch die von ihm entwickelte Gnadenlehre. Nach ihr sind alle Menschen „ein einziger Klumpen Dreck“ oder „ein Haufen der Sünde“. Das bedeutet: „Seitdem gebührt allen, sieht man von der Barmherzigkeit Gottes ab, die ewige Verdammung“ (ebd. 198). Die Tatsache, dass Gott für einige wenige Auserwählte von der Verdammung absieht, ist ein unerforschlicher Akt der Gnade. Ausgangspunkt für diesen Gedanken bildet eine Stelle bei Paulus, in der dieser betont, dass Gott durch eine „freie Wahl“ sich für Jakob und gegen Esau entschied, indem er sagte: „Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehaßt“ (Röm. 9, 13). Diese Wahl erfolgte, wie Paulus betont: „Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten“ (ebd.).
Augustinus greift diesen Gedanke auf und betont: Gott ist nicht ungerecht, wenn er nicht allen Menschen ihre verdiente Strafe zukommen lässt, sondern barmherzig, wenn er einige davon ausnimmt. Die wenigen Auserwählten gehören dem Gottesstaat an, ihnen wird das ewige Leben versprochen. Augustinus sagt: „Wir müssen annehmen, daß mit diesem ersterschaffenen Menschen, zwar nicht sichtlich für uns, aber dem Vorherwissen Gottes bereits offenbar, die beiden Gemeinschaften, gleichsam zwei Staaten, im Menschengeschlecht ihren Anfang genommen haben. Denn aus jenem ersten sollten alle Menschen hervorgehen, um nach Gottes zwar verborgenem, aber gerechtem Gericht teils als Genossen der bösen Engel verdammt, teils als Genossen der guten ewig belohnt zu werden“ (Augustinus, 1991, 106). Die kreationistische Grundthese der Bibel erfährt bei Augustinus eine besondere Zuspitzung: Der Mensch ist nicht nur überhaupt ein Geschöpf Gottes, sondern er ist entweder ein erwähltes oder aber ein verdammtes Geschöpf. Die Wirkungsgeschichte von Augustinus, der als Kirchenlehrer in der katholischen Kirche seit jeher ein großes Ansehen genießt, ist wechselvoll. Vor allem seine Erbsünden- und Gnadenlehre stieß auf Widerspruch. Bemerkenswerterweise war es gerade Martin Luther, der sich in seiner Rechtfertigungslehre auf Paulus und Augustinus berief. In seiner Schrift De servo arbitrio (Daß der freie Wille nichts sei) beschreibt er den Menschen als ein „Lasttier“ (Luther, 1954, 46f.), das unabhängig von seinem Willen entweder von „Gott“ oder vom „Satan“ geritten wird und betont immer wieder, dass der Mensch nicht aus eigener Kraft, nicht durch gute Werke, sondern allein durch das Geschenk des Glaubens, d.h. durch die Gnade Gottes, gerechtfertigt werden könne (vgl. Pleger, 2017, 54).