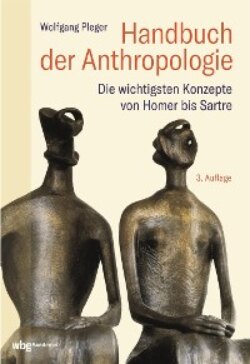Читать книгу Handbuch der Anthropologie - Wolfgang Pleger - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Natur und Gnade (Thomas von Aquin)
Оглавление„Wie aber das Seiende das erste ist, das überhaupt aufgefaßt wird, so ist das Gute das erste, das von der praktischen Vernunft aufgefaßt wird (…). Weil aber das Gute den Sinn von Zweck und das Böse den des Gegenteils hat, deshalb erkennt die Vernunft alles, wozu der Mensch eine natürliche Neigung hat (…). Daher richtet sich die Ordnung der Gebote des Naturgesetzes nach der Ordnung der natürlichen Neigungen. Zuerst wohnt dem nämlich Menschen die Neigung zu einem Guten entsprechend der Natur inne, in der er mit allen Substanzen übereinkommt; sie besteht darin, daß jede Substanz die Erhaltung ihres Seins begehrt, wie es ihrer Natur entspricht. Dieser Neigung zufolge gehört zum Naturgesetz solches, durch das das Leben des Menschen erhalten wird, während das Gegenteil verboten wird. – Zweitens wohnt dem Menschen eine Neigung zu einigen inne, (…) die er mit den anderen Lebewesen gemeinsam hat. Demzufolge zählt man das zum Naturgesetz, ‚was die Natur alle Lebewesen gelehrt hat‘, so die Verbindung des Männlichen und Weiblichen, die Aufzucht der Nachkommen und ähnliches. – In einem dritten Sinn wohnt dem Menschen die Neigung zum Guten entsprechend der Vernunftnatur inne, die ihm eigentümlich ist: So neigt der Mensch von Natur aus dazu, die Wahrheit über Gott zu erkennen, und dazu, in Gesellschaft zu leben.“
(Thomas von Aquin. Opera omnia Bd. 7. Summa theologica, Rom 1892. K. Flasch (Hg.), Geschichte der Philosophie Bd. 2, Stuttgart 1988, 324f.).
Thomas von Aquin (1224/25–1274) wird auf dem Schloss Roccasecca bei Aquino in der Nähe von Neapel als Sohn einer adligen Familie geboren. 1239 wird er Student an der Universität von Neapel und erhält außer theologischer Unterweisung eine Einführung in die griechische Philosophie, unter anderem in die aristotelische. Als 20-jähriger tritt er in den Dominikanerorden ein. Studienjahre in Paris folgen. Hier lernt er Albertus Magnus (1200–1280) kennen, der die griechische Philosophie, und speziell die aristotelische, mit der Theologie zu verbinden sucht. Er folgt seinem Lehrer nach Köln. 1256 wird er Magister an der Universität Paris und beginnt ab 1258 mit seinem Werk Summa contra Gentiles. Nach dreijähriger Lehrtätigkeit kehrt er nach Italien zurück. Am päpstlichen Hof lernt er Wilhelm von Moerbeke kennen, der für ihn aristotelische Schriften übersetzt. 1269–72 ist er wieder in Paris. In diese Zeit fällt die Abfassung seiner Summa Theologiae. Ab 1272 ist Thomas wieder in Italien und wirkt nun am Ordensstudium der Universität zu Neapel mit. Auf der Reise zum Konzil von Lyon stirbt er 1274 im Zisterzienserkloster zu Fossanova (vgl. Chenu, 1992).
Für Thomas von Aquin bildet eine Neubestimmung des Verhältnisses von Theologie und Philosophie, von Glauben und Wissen (fides et ratio), das Zentrum seines Denkens. Im Vergleich zu Augustinus aber hatte sich dieses Verhältnis durch die Entdeckung der aristotelischen Schriften vollständig verändert. Bildete noch für Augustinus der Neuplatonismus den Hintergrund seiner philosophisch-theologischen Überlegungen, so entstand mit Aristoteles eine neue philosophische Herausforderung. Sie bestand in der Bedeutung, die die aristotelische Philosophie der wissenschaftlichen Erörterung einzelner Bereiche der Wirklichkeit gab, und radikaler noch, der prinzipiellen Bedeutung des Einzelnen im Gegensatz zum Allgemeinen.
Waren bis 1200 nur einzelne logische Schriften von Aristoteles im lateinisch sprechenden Westen bekannt, so verfügte die arabische Welt bereits seit der Mitte des 10. Jh.s über eine vollständige Übersetzung der aristotelischen Schriften. Abu Ali ibn Sid (980–1037), der in Bagdad lebte und im Westen Avicenna genannt wurde, und Ibn Rushd (1126–1198), genannt Averroes, der im arabisch beherrschten Cordoba lebte, verfassten bedeutsame Aristoteles-Kommentare. Erst ab 1210 wurden an der Artistenfakultät zu Paris Vorlesungen über die aristotelische Physik und Metaphysik abgehalten, und erst um 1240 lag eine vollständige lateinische Übersetzung der aristotelischen Schriften vor. Doch die Irritation, die von Aristoteles für die offizielle Lehre der katholischen Kirche ausging, war so groß, dass der Papst 1210 zum ersten Mal, 1231 erneut und 1263 zum letzten Mal die Aristoteles-Lektüre verbot.
Für Albertus Magnus und für Thomas führte das Aristoteles-Studium zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Theologie. Der Anspruch von Philosophie und Wissenschaft wurde als eigenständige Möglichkeit der Erkenntnis ernst genommen. Für Thomas bedeutete der Neuansatz die Möglichkeit, einen anderen Weg der Erkenntnis als den traditionellen, neuplatonisch inspirierten, einzuschlagen. Ausgangspunkt wurde für ihn das ‚lumen naturale‘, die dem Menschen von Natur aus zukommende Vernunft. Es galt, ihre Reichweite auszuloten. Allerdings galt auch für ihn: Diese ist begrenzt und jenseits ihrer beginnt das Reich des Glaubens, das ein Geschenk der Gnade ist. Thomas entwickelte für ihr Verhältnis zueinander die einprägsame Formel „gratia perficit naturam“, d.h. die Gnade vollendet das in der Natur des Menschen liegende, aber unvollkommene, Streben nach dem Guten und Wahren. Er sagt:
„Die Geschenke der Gnade fügen sich auf solche Weise zur Natur, daß sie diese nicht aufheben, sondern eher vollenden. Darum auch löscht das Licht des Glaubens, das gnadenhaft in uns einströmt, das Licht der natürlichen Erkenntnis nicht aus, das unsere natürliche Mitgift ist“ (Thomas von Aquin, 1946, 116).
Das neue Zutrauen in die Kräfte der menschlichen Vernunft und der Philosophie führte auch dazu, dass der Versuch von Gottesbeweisen einen neuen Auftrieb erhielt. Für Augustinus war die Existenz Gottes eine Angelegenheit des Glaubens, in die das Wissen nicht vordringt. Das belegt seine Aussage: „Daß aber eine Welt vorhanden ist, sehen wir, daß Gott ist, glauben wir“ (Augustinus, 1991, 6). Anselm von Canterbury (1033–1109) hat demgegenüber einen bedeutsamen, neuplatonisch inspirierten Gottesbeweis vorgelegt. Er definiert Gott als „etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann“ (Anselm, 1984, 85). Er argumentiert so: Das angenommene Etwas, das als Gott definiert wird, ist nur dann das Größte, wenn ihm auch Existenz zukommt, denn sonst könnte etwas gedacht werden, dass größer wäre, nämlich etwas, das die Existenz einschließt.
Bemerkenswerterweise verwirft Thomas diesen Gottesbeweis mit zwei Argumenten. Zum einen betont er, „daß vielleicht der, der diesen Namen Gott hört, nicht einsieht, es werde damit etwas bezeichnet, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, da einige geglaubt haben, Gott sei ein Körper“ (Weischedel, 1979, 135). Sein zweiter Einwand ist gravierender. Er sagt: Selbst wenn jemand dieses Größte als Gott bezeichnet, „so folgt doch daraus nicht, daß er einsieht, das, was durch den Namen bezeichnet wird, sei in der Natur der Dinge, sondern (nur, es sei) in der Auffassung des Verstandes“ (ebd. 136). Kurz gesagt: Aus dem Begriff Gottes als einem Verstandesbegriff lässt sich nicht seine Existenz „in der Wirklichkeit“ ableiten. Thomas entwickelt seinen eigenen Gottesbeweis in fünffacher Weise (quinque viae):
Der erste Beweis geht von der Erfahrung aus, dass es Bewegtes gibt. Alles Bewegte aber muss von etwas bewegt werden. Der erste unbewegte Beweger ist Gott. Thomas entnimmt den Gedanken des unbewegten Bewegers der Metaphysik von Aristoteles und bezeugt damit einmal mehr seine Nähe zu ihm.
Der zweite Beweis argumentiert ähnlich: Alles in der Wirklichkeit Gegebene hat eine Ursache; es gibt für jedes Seiende eine ‚causa efficiens‘. Nur die erste Ursache ist selbst nicht verursacht, sie ist ‚causa sui‘, Ursache ihrer selbst; und das ist Gott.
Der dritte Beweis thematisiert das Verhältnis von Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit. Wir treffen auf Dinge, so erläutert Thomas, die entstehen und vergehen, bald sind, bald nicht sind. „Es ist aber bei allem Derartigen unmöglich, immer zu sein, weil, was die Möglichkeit des Nichtseins hat, auch einmal nicht ist. Wenn also alles in der Möglichkeit steht, nicht zu sein, so war irgendeinmal nichts an Dingen da. Wenn das aber wahr ist, so gäbe es auch heute nichts, weil, was nicht ist, nur durch eins, was da ist, dazusein beginnt“ (Thomas von Aquin, 1985, 24). Dieses Eine aber, so folgert er weiter, kann nur ein Notwendiges sein, und das ist Gott.
Der vierte Beweis geht von der Unterscheidung des Vollkommenen und des Unvollkommenen aus. Um das Unvollkommene als Unvollkommenes erkennen zu können, bedarf es eines Maßstabs, und der ist das Vollkommene selbst. Thomas folgert: „Es gibt also etwas, das allen Seienden die Ursache des Seins und der Gutheit und jeglicher Vollkommenheit ist: und das nennen wir Gott“ (ebd. 25). Dieser Beweis ist im eminenten Sinne platonisch. Platon bezeichnet dieses vollkommene Sein als Idee.
Der fünfte Beweis geht von dem Gedanken der in der Natur anzutreffenden Zwecke aus. Diese sind vorauszusetzen, auch wenn den Dingen selbst die Erkenntnis eines Ziels fehlt. Dasjenige, was ohne Erkenntnis einem Ziel zustrebt, kann das Ziel nicht aus sich haben. Es gibt daher in den Naturabläufen „ein Vernünftiges, von dem alle Naturdinge zu einem Ziele hingeordnet werden: und das heißen wir Gott“ (ebd. 25). Dieser Beweis greift den aristotelischen Gedanken der Teleologie auf. Es ist der der ‚causa finalis‘.
Die Gottesbeweise von Thomas sind in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: Sie beabsichtigen zum einen, die Existenz Gottes zu beweisen; sie geben zum anderen Hinweise auf sein Wesen, und schließlich machen sie deutlich, dass alle Dinge dieser Welt, den Menschen eingeschlossen, ihre Ursache in Gott haben, d.h. eine Schöpfung Gottes sind.
Fasst man die Argumente zusammen, so ergeben sich für das Wesen Gottes folgende Aussagen: Gott ist als unbewegter Beweger der Anfang von allem Bewegten, er ist die Ursache alles Seienden, er ist das einzige, notwendig Existierende, das vollkommene Sein und schließlich das Ziel allen Strebens. Er ist zugleich Anfang, Maßstab und Ziel der Schöpfung. Aber er ist selbst nicht ein Seiendes, auch kein erstes oder höchstes.
Das, was Maßstab des Seienden ist, kann selbst nicht ein Seiendes sein. Gott ist das Sein selbst, „das ipsum esse per se subsistens“ (Hirschberger I, 1976, 482). Als solches ist es unvergleichbar mit jedem Seienden. Alles Sprechen über das Sein selbst ist unzulänglich. Es hat nur den Charakter einer Analogie (analogia entis). Zugleich aber wird auch deutlich, dass das Sein des Seienden seinen Grund im Sein selbst hat, d.h. in Gott. Da Gott das Sein selbst ist, bedeutet Schöpfung, etwas aus dem Nichts ins Sein hervorbringen. Schöpfung ist „creatio ex nihilo“. Die Alternative dazu bot die griechische Philosophie, die die Ewigkeit der Welt betonte, so auch Aristoteles.
Es spricht für seine intellektuelle Redlichkeit, dass Thomas den Schöpfungsgedanken ausdrücklich als einen Glaubenssatz bezeichnet. Er betont, dass das Konzept einer ungeschaffenen, ewigen Welt mit vernünftigen Argumenten nicht zu widerlegen ist. In seiner Summa Theologiae formuliert Thomas den Einwand der natürlichen Vernunft so:
„Nun ist es aber ein Glaubenssatz, daß Gott der Schöpfer der Welt ist in der Weise, daß die Welt zu sein einen Anfang genommen hat (…). Allein mit dem Glauben wird festgehalten, und es läßt sich nicht beweisen, daß die Welt nicht immer gewesen ist“ (Thomas von Aquin, 1985, 209).
Das bedeutet aber auch: Seine Beweise der Existenz eines Schöpfergottes haben eine theologische Prämisse, und sie verlieren ohne sie ihre Beweiskraft (vgl. Chenu, 1992, 104; Hirschberger I, 506).
In ähnlicher Weise verbinden sich theologische und philosophische Motive in seiner Anthropologie. Die Lehre von der Erschaffung des ersten Menschen entnimmt Thomas der Bibel. Die Bildung Evas aus Adams Rippe hat für ihn vornehmlich den Zweck, die Fortpflanzung der Menschheit zu sichern.
Doch daneben gibt es bei ihm eine Lehre von der Entstehung des einzelnen Menschen. Sie umfasst Zeugung, Entwicklung und den Wesensaufbau des Menschen. Thomas definiert den Menschen mit Aristoteles als ‚animal rationale‘. Bei dem Menschen handelt es sich um einen Körper, der durch Selbstbewegung, Ernährung, Fortpflanzung, Sinnesempfindungen und Vernunft ausgezeichnet ist. Diese Vermögen hat der Körper nicht aus sich selbst; denn sie kommen nicht jedem Körper zu. Sie bezeichnen seine Seele.
Die Seele ist das Lebensprinzip bei allen Lebewesen; sie hat einen Stufenaufbau. Mit den Tieren verbinden den Menschen vier Stufen oder Seelenpotenzen. Es sind die vegetative (pflanzliche), die sensitive (Sinnesempfindungen), die appetitive (das instinktive Streben) und die motible (Ortsveränderung). Die menschliche Seele zeichnet sich jedoch durch ihr intellektives, rein geistiges Vermögen aus, das Denken und freies Wollen umfasst (vgl. Hirschberger I, 1979, 510f.). Das Denken beinhaltet auch die Fähigkeit, sich auf sich selbst zurückbeugen zu können, d.h. die Fähigkeit der Reflexion. Sie ist nicht an die Sinnlichkeit gebunden, sondern hat ihr gegenüber eine Selbständigkeit. Diese „Geistseele“ ist etwas selbständig Existierendes, sie ist eine Substanz. Aus diesem Grund ist sie auch unsterblich.
Bemerkenswert sind die Ausführungen von Thomas zur Entstehung des einzelnen Menschen, die eine Embryologie einschließen. Die Entwicklungsstufen stellen sich wie folgt dar (vgl. Hirschberger I, 1979, 513f.): Den Ausgangspunkt bildet das „Mutterblut“. Durch Kombination einer Reihe von Faktoren, wie Gott, Himmelsgeister, die Sonne und das Sperma des Vaters, wird das Mutterblut zu einem Lebewesen, das auf der Stufe des vegetativen Lebens steht, ohne jedoch einer bestimmten Pflanze zugeordnet werden zu können. Danach beginnt es Lebensfunktionen auszuüben, wie Ernährung und Wachstum. Nach dem Erreichen einer bestimmten Gestalt erhält es die Stufe des animalischen Lebens, und zwar zunächst nur dem Sein nach; später auch aufgrund seiner Tätigkeiten der Sinneswahrnehmung und der Bewegung. Es gehört keiner spezifischen Tierart an. Erst nach einer weiteren Entwicklung des Embryos wächst dieser zur menschlichen Gestalt heran, und die bis dahin entstandene animalische Seele muss der menschlichen weichen. Die menschliche Vernunftseele wird von Gott für jedes Individuum eigens geschaffen und ihm zugeteilt. Jetzt gehört der ‚foetus‘ der Spezies Mensch an. Auch hier geht das Sein dem Handeln voran. Der Foetus hat nur das Vermögen vegetativer und sensitiver Tätigkeit (homo actu primu). „Erst wenn das Kind zum Gebrauch der Vernunft gelangt ist, ist es auch lebenstätiger Mensch (homo actu secundo)“ (ebd. 514). Der Mensch durchläuft also die drei von Aristoteles bezeichneten Lebensstufen: Pflanze, Tier, Mensch.
Die markantesten Kennzeichen dieses Konzeptes bestehen darin, dass es, im Anschluss an Aristoteles, die Entwicklung des Menschen von der Zeugung bis ins Kindesalter als einen natürlichen Prozess beschreibt. Von Bedeutung ist auch der Gedanke, die Schöpfung nicht als einen mit dem Anfang der Welt abgeschlossenen Akt anzusehen, sondern als eine fortdauernde Schöpfung, eine ‚creatio continua‘. Dazu gehört auch der Ansatz einer Sukzessivbeseelung, die die Beseelung als einen nach und nach sich ereignenden Vorgang ansieht, im Unterschied zu dem der Simultanbeseelung, der davon ausgeht, dass dem Menschen von Anfang an eine menschliche Seele zukomme.
Auch in seiner Ethik schließt sich Thomas direkt an die Philosophie von Aristoteles an. Dessen Aussage, mit der die Nikomachische Ethik beginnt, man habe „mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt“ (Aristoteles, EN, 1094 a), geben den Rahmen, in dem sich die ethischen Überlegungen von Thomas bewegen (vgl. Text). Er zitiert die angeführte Stelle, wenn er das Gute als das bestimmt, „was alle begehren“. Der Mensch strebt von Natur aus das Gute an. Die Gebote der Natur bilden eine Ordnung der „natürlichen Neigungen“. Sie stellen ein Naturgesetz dar. Für Thomas gibt es drei Stufen dieser natürlichen Neigungen: Die erste besteht in dem Prinzip der Selbsterhaltung, die zweite in der Verbindung von Mann und Frau und in der Erzeugung und Aufzucht von Nachkommen. Erst die dritte Stufe umfasst das spezifisch Menschliche. Sie besteht in der Erkenntnis der Wahrheit Gottes und in dem Prinzip des Zusammenlebens in einer Gesellschaft. Die menschliche Gesellschaft unterscheidet er dabei eindeutig von jeder tierischen, und man kann nur vermuten, dass er sich dabei von denselben Kriterien leiten lässt wie Platon und Aristoteles, die die politische Ordnung als eine Rechtsordnung interpretierten, die es im Tierreich nicht gibt. Doch auch das Streben nach der Erkenntnis der Wahrheit Gottes entspricht ganz dem aristotelischen Ansatz, für den die theoretische Lebensweise durch die Erkenntnis des Göttlichen bestimmt war.
Wenn aber der Mensch von Natur aus nach dem Guten strebt, stellt sich die Frage nach dem Bösen. Thomas interpretiert es als einen Mangel. Er definiert das Böse so: „Wie unter dem Wort ‚gut‘ das Vollkommene verstanden wird, so unter dem Wort ‚böse‘ nichts anderes denn der Verlust des Vollkommenseins“ (Thomas von Aquin, 1946, 25). Diese Definition beinhaltet auch den Gedanken, dass das Gute seinem Wesen und seinem Ursprung nach dem Bösen vorangeht: „Wie das Gute von Natur früher ist als das Böse, das seinen Verlust bedeutet, so sind auch die Regungen der Seele, deren Gegenstand das Gute ist, von Natur früher als die Regungen, deren Gegenstand das Böse ist, und die deshalb aus jenen entspringen. Und darum haben Haß und Traurigkeit ihre Ursache in einer Liebe, einem Verlangen, einer Lust“ (ebd. 29). Das Böse ist ein irregeleitetes Streben nach einem Guten. Das bedeutet: „Alles Böse wurzelt in einem Guten“ (ebd. 30).
Aber Thomas geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: „Wenn das Böse gänzlich von der Wirklichkeit ausgeschlossen würde, so bedeutete das, daß auch viel Gutes aufgehoben würde. Es liegt also nicht in der Meinung der göttlichen Vorsehung, das Böse völlig von der Wirklichkeit auszuschließen, vielmehr das Böse, das hervortritt, auf ein Gutes hinzuordnen“ (ebd. 31f.). Das allerdings ist die Sicht der Dinge aus der Perspektive Gottes. Für den Menschen gilt das Gebot: „Das Böse ist auf jegliche Weise zu meiden; darum darf man auf keine Weise Böses tun, damit daraus etwas Gutes erwachse“ (ebd. 29).
Warum aber gibt es überhaupt böse Handlungen? Die Antwort von Thomas ist die, die bereits Platon und Aristoteles gegeben haben. Es ist die „Unwissenheit der Vernunft“, die den Menschen veranlasst, statt des erstrebten Guten ein Böses oder Sündhaftes zu tun. Das Streben nach dem Guten ist aber nicht zu verstehen als eine Determination. Thomas legt großen Wert auf die Betonung der Freiheit des Menschen. Gott ist die erste Ursache der Welt; aber damit sind nicht alle weiteren Folgen und Ursachen determiniert. Es gibt vielmehr den eigenen Bereich der Zweitursachen. Hier hat die menschliche Freiheit ihren Ort. Thomas bemerkt: „Gott bewegt alle Wesen gemäß ihrer Weise. Und darum haben an der Bewegung durch Gott einige Wesen auf die Weise der Notwendigkeit teil, die geistbegabte Natur aber auf die Weise der Freiheit“ (ebd. 115). Die „geistbegabte Natur“ ist die des Menschen. Die Freiheit richtet sich darauf, für das angestrebte Ziel die geeigneten Mittel zu wählen. Allerdings, auch hier kann sich der Mensch irren und statt der guten Mittel böse wählen. Das führt zu einer entscheidenden Konsequenz: „Sich für das Böse entscheiden können, gehört nicht zum Wesen des freien Willens; es folgt jedoch aus dem freien Willen, sofern dieser in einem geschaffenen Wesen wohnt, das also des Versagens fähig ist“ (ebd. 62). Das bedeutet umgekehrt: „Wo immer geistige Erkenntnis ist, da ist auch freier Wille“ (ebd.). In seiner Staatsphilosophie betont Thomas die Unterordnung der weltlichen Obrigkeit unter die geistliche. Das kreationistische Credo von Thomas lautet: Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, dessen natürliches Streben nach dem Guten durch die Gnade vollendet wird.
Die Wirkungsgeschichte von Thomas ist bedeutend. Für die katholische Kirche stellt er nach wie vor die entscheidende Lehrautorität dar. Die von ihm gesuchte Nähe zu den Wissenschaften führte dazu, auch weiterhin wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Glaubenswahrheiten als vereinbar zu betrachten. Das gelang nicht immer. So bekämpfte die katholische Kirche entscheidende neuzeitliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Trotzdem weist Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Fides et Ratio aus dem Jahre 1998 erneut auf die zentrale Bedeutung des „hl. Thomas“ hin. Ihm komme „das große Verdienst zu, daß er die Harmonie, die zwischen Vernunft und Glaube besteht, in den Vordergrund gerückt hat“ (Papst Johannes Paul II, 1998, 46). Er betont, allerdings nicht ohne eine gewisse Einschränkung: „Die Bezugnahme auf die Naturwissenschaften ist in vielen Fällen nützlich“ (ebd. 71).