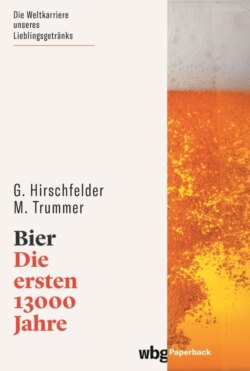Читать книгу Bier - Gunther Hirschfelder - Страница 17
Goldenes, rotes oder lieber süßes Bier:
Die Brautechnik im Zweistromland
ОглавлениеDer Wissenschaftshistoriker Peter Damerow (1939–2011) hat eine wertvolle Entwicklungsgeschichte des Bieres in Sumer und seinen Nachfolgekulturen entworfen.12 So zeigen bereits die frühesten keilschriftartigen Tafeln aus der Zeit um 3200 v. Chr. wahrscheinlich neun Biersorten, die sich – repräsentiert durch verschiedene Schriftzeichen für Gefäße – in Inhalt und Menge unterschieden. Zwei Grundstoffe, jeweils aus Gerste hergestellt, zählen in dieser frühen Epoche zu den zentralen Bestandteilen des Bieres. Zum einen erwähnen die Quellen grob gemahlene Gerstenkörner, zum anderen ein Produkt, bei dem es sich wohl um bereits kontrolliert gemälzte Gerste handelt. Die Gerste selbst fand ihre Repräsentation im Zeichen einer Getreideähre ŠE. Neben den Grundbestandteilen aus der Gerste überliefern die Quellen der frühesten Epoche zudem das Zeichen ŠIM, ein Gefäß mit einer Art Ausguss am unteren Ende.13
Um die Mitte des 3. vorchristlichen Jahrtausends unterscheiden die Schriften die unterschiedlichen Biersorten auch anhand ihres Namens. Die von Damerow analysierten administrativen Dokumente erwähnen unter anderem goldenes Bier (kaš kal), dunkles Bier (kaš ge), süßes dunkles Bier (kaš ge du-ga) oder rotes Bier (kaš sa). Während die älteren Quellen als Grundbestandteile nur Gerste kannten, erwähnen die Texte nun auch Emmer (imgaga) als Inhaltsstoff, der zuvor zwar bereits bekannt war, aber nicht im Kontext von Texten des sumerischen Brauwesens auftauchte.
Auf Tafeln aus den Archiven der Stadt Girsu (dem heutigen Tello) nennt Damerow den Begriff munu, der mit großer Wahrscheinlichkeit das aus der Keimung der Gerste gewonnene Malz bezeichnet. Ein anderer wichtiger Begriff, der auch im Hymnus an Ninkasi auftaucht, heißt bappir und bezeichnet wohl eine bestimmte Menge speziell vorbereiteter Gerste. Aufgrund des verwendeten Schriftzeichens handelte es sich bei bappir wohl bereits um verarbeitetes „Bierbrot“. Eine weitere Unsicherheit ergibt sich in der Deutung der unterschiedlichen Biersorten. Wir verfügen kaum über Anhaltspunkte, was das „goldene Bier“ vom „roten Bier“ unterschied. Lediglich zu zwei Sorten kann Damerow weitere Inhaltsstoffe nennen. So beinhaltete das dunkle Bier auch titab, wobei es sich wohl, ähnlich wie bei bappir, um zu Brot verarbeitete, teils gemälzte Gerste, womöglich als Gärungsstarter handelte. Im „süßen dunklen Bier“ findet sich dagegen gar tamma, das mitunter als verarbeitetes Malzextrakt gedeutet wird.14
Die einzelnen Biersorten unterschieden sich auch in ihrer Qualität. Bei Frauen aus höheren Gesellschaftsschichten stand ein süßes, mit Honig verstärktes Emmerbier hoch im Kurs, was sich auch in seinem hohen Preis niederschlug. Die Quellen differenzieren weiterhin zwischen feinem Bier und normalem Bier, zwischen Dünnbier und Mischbier, zwischen erst-, zweit- und drittklassigem Bier.15 Bier wirkt so auch als sozial strukturierendes Getränk. Bereits in späterer assyrischer Zeit, etwa um das 8. Jahrhundert, schickt der Bürgermeister der Stadt Nippur einen aufsässigen Untertanen mit den Worten weg: „Gebt dem Bürger von Nippur einen Knochen und eine Sehne, gebt ihm eine Kanne drittklassiges Bier zu trinken, schickt ihn weg und werft ihn zur Tür hinaus.“16
Die spätsumerische Epoche an der Schwelle zum 2. vorchristlichen Jahrtausend ging mit einer Expansion der bürokratischen Strukturen einher.17 Neben neuen Maßeinheiten geben die Quellen nun auch Qualitätskriterien für das Bier an, die die Menge der verwendeten Gerste berücksichtigen. So bezeichnet kaš du gewöhnliches Bier, während kaš saga für gutes Bier steht. Aus Rechnungen und Schriftverkehr der oberen Gesellschaftsschichten geht hervor, welche beträchtlichen Mengen von Bier produziert und konsumiert wurden. Hinter den hohen Hektolitermengen steht eine professionalisierte und im großen Maßstab betriebene Bierökonomie, die die Herstellungs- und Verbreitungsprozesse standardisierte. Dies wird etwa dadurch belegt, dass in den Rechnungsbüchern der großen Bierbrauer keine bereits verarbeitete Gerste mehr auftaucht – ein Hinweis darauf, dass die Produktionsschritte nun im eigenen Betrieb stattfanden. Große Lagerkapazitäten und eine hohe Arbeitskraft wurden erforderlich. Emmer verschwand dagegen als Grundbestandteil nahezu völlig.
Wenngleich bei der Anwendung Literarischer Quellen auf historische Brautechnik stets Vorsicht geboten ist, lässt sich der mesopotamische Brauvorgang zumindest bruchstückhaft rekonstruieren. Das wichtigste Dokument hierzu bildet der Haupttext des bereits erwähnten Hymnus an die Bier- und Braugöttin Ninkasi. Seine Bedeutung erhält das Werk durch die vielen Details, die es liefert. In der deutschen Übersetzung von Walther Sallaberger aus dem Jahr 2012 besingt der Hymnus die Göttin in den einzelnen Arbeitsschritten des Brauprozesses:
„Dein aufgehender Teig, wurde der mit der stattlichen Spatel geformt,
ein Aroma von weichem Honig, der durchmischte Sauerteig,
Ninkasi, dein aufgehender Teig, wurde der mit der stattlichen Spatel geformt,
ein Aroma von weichem Honig, der durchmischte Sauerteig,
deine Sauerteig(klumpen), wurden sie im stattlichen Ofen gebacken,
sind sie sauber angeordnete Garben von gunida-Emmer.
Ninkasi, deine Sauerteig(klumpen), wurden sie im stattlichen Ofen
gebacken, […]
Dein Malz, wurde der Grieß bereitgelegt, Wasser hineingegossen,
ist es Ungeziefer von der Art sich zu krümmen und zu kringeln.
Ninkasi, dein Malz, wurde der Grieß bereitgelegt, Wasser hineingegossen,
[…]
Deine Maische, wurde im Gefäß Wasser dazugegeben,
sind es Wellen, die sich heben, Wellen, die sich senken.
Ninkasi, deine Maische, wurde im Gefäß Wasser dazugegeben,
[…]
Dein Treberkuchen, ist er auf einer stattlichen Matte ausgebreitet,
ist er die Sanftmut, die den Gott ergriffen hat.
Ninkasi, dein Treberkuchen, ist er auf einer stattlichen Matte
ausgebreitet,
[…]
Dein großes Trockenbier, liegt es verarbeitet bereit,
ist es Honig und Wein, die gemeinsam Saft geben.
Ninkasi, dein großes Trockenbier, liegt es verarbeitet bereit,
[…]
Dein Filterbier, hat es sich in den Bier-Pithos ergossen,
ist es, als hätte man auf Euphrat und Tigris geachtet.
Ninkasi, dein Filterbier, hat es sich in den Bier-Pithos ergossen,
ist es, als hätte man auf Euphrat und Tigris geachtet.“18
Auf die Nähe von Brot und Bier in den vorderorientalischen Kulturen des 3. und 2. Jahrtausends verweist der Eingangsvers. Als ersten Schritt im Brauvorgang erwähnt der Hymnus das Kneten und Backen des Sauerteigs aus Gerstenschrot.19 In einem separaten Schritt wässert Ninkasi das Malz, das vorher ausgebreitet und zur Keimung gebracht wurde, in einem Gefäß.20 Dann wurde die Maische abgeschöpft. Aus dem darin enthaltenen Treberkuchen entstand ein getrocknetes „Gemisch“ – eine Art Trockenbier, das jederzeit frisch angerührt werden konnte – das früheste Instantgetränk der Geschichte!21 Die Substanz wurde daraufhin mit Honig und Wein vermengt und in ein eigenes Filtergefäß geschüttet. In einem letzten Arbeitsschritt wurde das gefilterte Bier in ein größeres Lagergefäß umgefüllt, das sich unter dem Filtergefäß befand. Daraus schenkte es die Biergöttin direkt an die Trinkenden aus. Das Bier erfuhr eine derart große Wertschätzung, dass der Hymnus es mit dem Rauschen von Euphrat und Tigris gleichsetzte.22