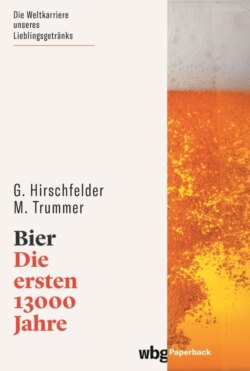Читать книгу Bier - Gunther Hirschfelder - Страница 8
Trinken und Essen:
Kultureller Akt mit Symbolkraft
ОглавлениеUnser Interesse am Bier steht in der Fachtradition der Vergleichenden Kulturwissenschaft beziehungsweise der Europäischen Ethnologie wie auch der Geschichtswissenschaft.6 Damit ist es einem weiten Kulturbegriff verpflichtet. Kultur in dieser Lesart umfasst nicht lediglich die Spitzenleistungen der menschlichen Schöpferkraft, die Theaterstücke Shakespeares, die Gemälde Michelangelos oder die Lyrik Hölderlins. Kultur versteht sich auch nicht als zivilisatorische Norm, als „feines Benehmen“ oder als Bildung. Kultur umfasst hier vielmehr die Gesamtheit der menschlichen Lebensweisen, Wertehaltungen und Kommunikation. Dazu zählen immaterielle Formen, etwa Muster des Erzählens oder Praxen des Glaubens, ebenso wie Dinge und ihr Gebrauch, zum Beispiel Mode, Kleidung oder Möbel. Des Weiteren gehört dazu aber eben auch der kulturelle Akt der Ernährung.
Bei der Auswahl von Getränken und Speisen lässt sich der Mensch von unterschiedlichen, kulturell determinierten Faktoren leiten. Unsere Trinkkultur ist keineswegs statisch. Das Gegenwärtige lässt sich vor dem Hintergrund gewaltiger historischer Entwicklungen interpretieren. Die Art wie, wann und wo wir Bier konsumieren und wie wir den Konsum von Alkoholika bewerten, ist von außergewöhnlich widerständigen kulturellen Traditionen und Normen beeinflusst, die sich regional und national unterscheiden können. Auch Erziehung und Sozialisation prägen den Umgang mit der Trinkkultur. Ob ein Rauschmittel wie Bier als legal oder illegal gilt, hängt von den jeweiligen herrschenden Normen ab sowie von geschlechts-, alters- oder lebensstilspezifischen Konsumgewohnheiten und -regeln. Auf diese Weise wird Bier in seiner historischen, geographischen und sozialen Bewertung selbst kultural. Der Genuss von Bier – oder anderen Getränken – kommuniziert symbolisch Zugehörigkeiten, aber auch Grenzen zwischen Personen, Gruppen, Glaubensgemeinschaften oder Nationen. Noch heute verlaufen trotz allgemeiner Verfügbarkeit der Getränke deutliche Trennlinien zwischen den Weinkulturen des mediterranen Raums und den Biertrinkern nördlich der Alpen. Auch zwischen Menschen aus dem christlichen und dem islamischen Kulturraum markiert der Bierkonsum kulturelle Schranken: Er gerät zum Symbol von Zugehörigkeit oder Fremdheit.
Bier kann heute viele kommunikative Funktionen erfüllen. Es kann sogar zum Prestigeprodukt werden, dessen demonstrativer Konsum eine herausragende gesellschaftliche Stellung unterstreicht. Über den Genuss und den Besitz von Bier drücken Menschen die Zugehörigkeit zu kulturellen Eliten aus: Bier wird zum exhibitionistischen Attribut eines exklusiven Lifestyles, in dessen Rahmen Individuen ihre finanziellen Ressourcen in einer anonymer und individualistischer werdenden Gesellschaft nach außen hin sichtbar machen.7 In der Geschichte des Bieres stößt man bereits in der römischen Republik des 2. vorchristlichen Jahrhunderts auf diesen Symbolgehalt, wenn zwischen dem edlen Weizenbier cervesia der reichen und adligen Gallier und dem gewöhnlichen Gerstenbier der breiten Bevölkerung unterschieden wird. Elitären Status auf exklusiven Tafeln genoss auch das Einbecker Bier des späten Mittelalters, das in Qualität und Geschmack dem faden, alltäglichen Braunbier überlegen war. Heute haben junge, urbane Eliten exklusive und teure „Craft-Beer“-Abfüllungen als Distinktionssymbol gegenüber der industriellen Bierkultur des 21. Jahrhunderts entdeckt.
Der russische Ethnologe Sergei Alexandrowitsch Tokarev (1899–1985) unterteilte in einem 1971 erschienenen Aufsatz Nahrungsmittel nach ihrer kommunikativen Leistung in einer konkreten sozialen Situation. Er unterschied dabei zwischen „Nahrung, die die Menschen vereinigt, und d[er] Nahrung, die sie trennt“.8 Natürlich grenzt auch Bier nicht nur ab; vielmehr verbindet es meistens. Gemeinsames Trinken im Brauhaus oder Stadion stiftet Gruppenidentität: Wer mittrinkt, gehört dazu. Bier wirkt dann als sozialer Kitt – und übernimmt damit eine aus frühester Zeit bekannte Funktion: Erhaltene Rechnungsbücher aus dem ptolemäischen Ägypten belegen, dass bereits damals gerade in Vereinen und sozialen Gemeinschaften regelmäßig Bier getrunken wurde. Diese Funktion zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Bieres. In England ist Bier seit der Industrialisierung das typische Getränk der arbeitenden Klasse und in der Musikszene, etwa der des Heavy Metal. Bier genießt als Rauschmittel Nummer eins die symbolische Bedeutung eines gruppenspezifischen Getränks. Die große zeichenhafte Kraft von Bier in kollektiven Identitäten tritt vor allem im Rahmen regionaler oder nationaler Zuschreibungen zutage. Die Bezeichnung „Bayerisches Bier“ dient heute nicht mehr lediglich dem gruppenkonformen „Mia-san-Mia“-Gefühl des Freistaates, sondern ist auch eine geschützte geographische Angabe im Rahmen von EU-Lebensmittel- und Agrarverordnungen.9
Bier kann auf individueller ebenso wie auf kollektiver Ebene Sicherheit und Orientierung geben. Das symbolisch überhöhte gemeinsame Feierabendbier nach einem anstrengenden Arbeitstag im Kreise von Kollegen sorgt nicht nur für den Abbau von Spannungen, sondern auch für situative Sicherheit in einer informelleren Kommunikationsumgebung. Noch weit bis ins 19. Jahrhundert hinein verfügte Bier über eine dezidierte symbolische Qualität als nahrhaftes, gesundes Produkt. Anders als das oft verunreinigte Wasser genoss Bier den Ruf eines unbedenklichen Erzeugnisses, das gerade auch von Schwangeren und Kindern getrunken werden konnte. Amtsärztliche Protokolle aus dem ostbayerischen Raum beklagen noch um 1860 den hohen Alkoholkonsum von Kindern.10