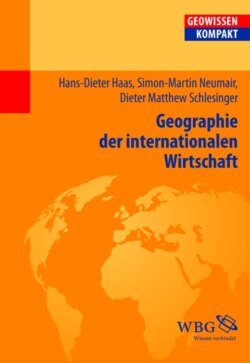Читать книгу Geographie der internationalen Wirtschaft - Hans-Dieter Haas - Страница 12
1.4 Geographie der internationalen Wirtschaft aus relationaler Perspektive
ОглавлениеVerzicht auf sektorale Vorgehensweise
Was Aufbau und Gliederungssystematik vorliegenden Lehrbuchs angeht, wird auf die in älteren Werken zur Weltwirtschaftsgeographie (z.B. BOESCH 1966), aber auch in jüngeren Lehrbüchern zur Allgemeinen Wirtschaftsgeographie (z.B. VOPPEL 1999, KULKE 2008) praktizierte Einteilung nach Wirtschaftssektoren verzichtet. Eine solche Vorgehensweise erscheint als nicht mehr zeitgemäß, da viele Unternehmen heutzutage über mehrere Wirtschaftsbranchen hinweg operieren und die Grenzen zwischen den einzelnen Sektoren (Landwirtschaft und Rohstoffe, Industrie, Dienstleistungen) zunehmend verschwimmen. Als beispielhaft gelten u.a. große agroindustrielle Konzerne, welche neben der landwirtschaftlichen Güterproduktion vor allem in der Ernährungsindustrie aktiv sind, multinationale Bergbaukonzerne, die Bodenschätze nicht nur abbauen, sondern auch industriell aufbereiten, oder der Maschinen- und Anlagenbau, der von mehreren komplexen Dienstleistungen (z.B. Konstruktion, Montage, Wartung) begleitet wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes stets Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben anfallen, welche statistisch nicht gesondert ausgewiesen werden. Kommt es zur Auslagerung derartiger Tätigkeitsbereiche, die vorher in der Rubrik „sekundärer Sektor“ auftauchten, nimmt der tertiäre Sektor statistisch zu, obwohl die reale Beschäftigungsstruktur unverändert bleibt (vgl. KLOHN 2008, S. 7). Ferner geht bei einer rein sektoralen Betrachtung der Blick für das einzelne Unternehmen als Akteur der internationalen Wirtschaft, seine Strategiewahl und Entscheidungsprozesse verloren, was damit eine akteurszentrierte Betrachtungsweise erschwert.
Relationale Grundperspektive
Aufgrund dieser Schwächen wird hier eine relationale Betrachtungsperspektive gewählt. Der von BATHELT und GLÜCKLER (2002, 2003) in die deutsche Wirtschaftsgeographie eingeführte Ansatz der relationalen Wirtschaftsgeographie markiert eine wirtschaftssoziologisch inspirierte handlungs- und akteursorientierte Perspektive und beachtet das gesellschaftliche, soziale und kulturelle Umfeld wirtschaftlicher Akteure und deren Einbindung in solches.
Merkmale des relationalen Grundverständnisses
Das relationale Grundverständnis zeichnet sich durch drei grundlegende Merkmale aus (vgl. BATHELT/GLÜCKLER 2002, S. 36 und 2003, S. 250; GLÜCKLER 2004, S. 88f.; NEUMAIR 2009, S. 5ff.):
Die Kontextualität meint, dass ökonomisches Handeln als soziales Handeln immer vor dem Hintergrund eines spezifischen Handlungskontextes stattfindet. Damit wird eine Sichtweise des ökonomischen Handelns in eine strukturelle Perspektive des Handlungskontextes integriert und steht für die Einbettung ökonomischer Aktivitäten in sozioinstitutionelle Beziehungssysteme, womit ökonomisches Handeln als raumzeitlich situiert anzusehen ist. Im Rahmen einer Geographie der internationalen Wirtschaft gilt es in diesem Zusammenhang das Handlungsumfeld international tätiger Unternehmen zu bestimmen, das heute überwiegend durch eine globale Wirtschaft als moderne geographische Formation sowie die daraus resultierenden Rahmenbedingungen und unternehmerischen Herausforderungen strukturiert ist.
Da jeder Handlungskontext eine spezifische Entwicklung auslöst, transformiert sich die Kontextualität des Handelns in eine dynamische, pfadabhängige Entwicklung (Pfadabhängigkeit). Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung weltweiter wirtschaftlicher Aktivitäten und Raummuster in unterschiedlichen historischen Epochen bis heute zu betrachten.
Die Kontingenz bringt zum Ausdruck, dass ökonomisches Handeln keinen universellen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, sondern stets individuell geprägt ist. Daher sind die Internationalisierungsstrategien von Unternehmen sowie die räumlichen Verteilungs- und Verknüpfungsmuster ihrer Wertschöpfungsaktivitäten zu untersuchen.
Aufbau der Geographie der internationalen Wirtschaft
Der Konzeption der relationalen Geographie folgend, werden in diesem Buch zuerst – im Sinne der Pfadabhängigkeit – weltwirtschaftliche Beziehungen in unterschiedlichen historischen Epochen dargelegt (Kap. 2). Ferner ist für das Verständnis der weltwirtschaftlichen Entwicklung die Konkretisierung des komplexen Begriffs Globalisierung notwendig, um z.B. die heutigen Auswirkungen auf politische Gestaltungsmöglichkeiten oder im soziokulturellen Umfeld darzustellen. Die Erläuterung des Kontexts, in dem die Weltwirtschaft eingebettet ist bzw. in dem sich ihre Akteure bewegen, erfolgt durch die strukturelle Erfassung des Weltwirtschaftsraums (Kap. 3) sowie die Darlegung der geographisch relevanten Rahmenbedingungen einer internationalen Wirtschaft (Kap. 4). Der Weltwirtschaftsraum lässt sich dabei durch Ländertypen und -gruppen, den Entwicklungsstand, Aspekte der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, Städte als Knotenpunkte globaler wirtschaftlicher Prozesse und regionale Integrationssysteme (u.a. NAFTA, MERCOSUR oder Europäische Union) strukturieren. Unter die Rahmenbedingen fallen der weltweite Außenhandel, globale Direktinvestitionen, weltweite Infrastruktureinrichtungen, der Einfluss von Kulturen auf das Wirtschaftssystem, Länderrisiken sowie Möglichkeiten einer nachhaltigen Weltwirtschaft. Im Rahmen der Kontingenz werden abschließend die Möglichkeiten des individuellen Handelns von Akteuren, hier Unternehmen, anhand von Modellen der Internationalisierung, Internationalisierungsstrategien sowie der Gestaltung globaler Wertschöpfungsprozesse dargelegt.