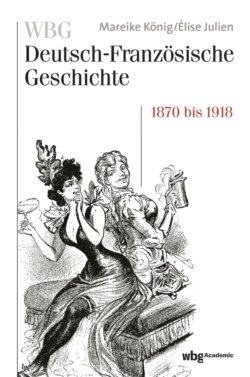Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 10
Die Angemessenheit historischer Zugänge für das Problem und den gewählten Blickpunkt
ОглавлениеFür die Fragen, die wir aus unserem Blickpunkt an den Kriegsausgang stellen, funktionieren die üblicherweise von Historikern benutzten Analyserahmen, die Untersuchung des Sozialen, Ökonomischen, Politischen und Kulturellen nicht – auch wenn sie für Einzelstudien über die eine oder andere Frage oder für Vergleichsdarstellungen durchaus aussagekräftig sind19. Es geht auch nicht darum, lediglich die „Beziehungen“ zwischen den zwei Ländern zu untersuchen, seien es nun diplomatische Beziehungen oder, in einer neueren Perspektive, die Kontakte und Transfers zwischen den verschiedensten transnationalen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen.
Ebenso wenig soll die zentrale Frage nach dem Vermächtnis des Ersten Weltkriegs beantwortet werden, indem man sich damit zufriedengibt, zwei Antworten nebeneinanderzustellen – so treffend diese Differenzierung auch sein mag: auf der einen Seite eine Siegermacht, auf der anderen Seite ein besiegtes Land. Dieser Vergleich würde es verhindern, die gemeinsame Dynamik und die „Verflechtungen“ zu erfassen, die beide Gesellschaften gleichermaßen betrafen.
Um auch diese Frage beantworten zu können, haben wir uns entschieden, „in Fällen zu denken“20, auch wenn die Auswahl bisweilen willkürlich erscheinen mag. Wir werden dabei von Inhalten ausgehen, die es erlauben, ganz nahe an die Fragen des Kriegsausgangs und des Traumas mit seinen Auswirkungen in der untersuchten Epoche heranzugehen – notfalls anhand von sehr genau beschriebenen Beispielen.
Dennoch ist diese Herangehensweise nicht willkürlicher als die klassische nationale oder binationale Analyse – wie die deutsch-französische Perspektive – oder die Untersuchung einer Epoche21, die in unserem Fall eine Relevanz für die deutsche Geschichte besitzt – jene von Weimar, 1918–1932/33 –, aber auf den ersten Blick weitaus weniger wichtig für Frankreich ist.
Für Marc Bloch und die Annales-Historiker findet sich alles in der gestellten Frage. Im Mittelpunkt des vorliegenden Werkes steht ein Problem: die Verletzungen zweier Gesellschaften – die eine siegreich, die andere besiegt – und ihre Auswirkungen als Vermächtnis des Krieges und seiner unmittelbaren Folgen. Dieses Problem mittels einiger spezifischer Themen anzugehen, sollte den Tunnelblick verhindern, durch den uns andere miteinander verbundene und voneinander abhängige Geschichten, andere „geteilte Geschichten“ entgangen wären.
Tatsächlich blickt Deutschland nicht nur gen Westen und auf Frankreich. Die Beziehung Frankreichs zu seinem alten besiegten Gegner wiederum ist keineswegs eine exklusive gegenüber anderen, genauso wichtigen Zusammenhängen.
Die Auswahl einiger Inhalte erlaubt es außerdem, die Ergebnisse neuerer Forschungen und Herangehensweisen zu würdigen und zu präsentieren, welche die Untersuchungen zur deutsch-französischen Zeitgeschichte in den letzten Jahren nachhaltig beeinflusst haben. Hartmut Kaelble hat darauf hingewiesen, dass die vergleichende Geschichte, die Geschichte von kulturellen Transfers, die transnationale Geschichte, die historischen Verflechtungen oft von den Praktizierenden der deutsch-französischen Geschichte initiiert, getragen und ausprobiert – und sogar kritisiert – wurden.22
Es überrascht also nicht, dass sich hier Kapitel zur vergleichenden Geschichte ebenso finden wie andere, die kulturelle Transfers in den Mittelpunkt stellen oder versuchen, historische Verflechtungen aufzuzeigen. Ein Ziel dieser verwandten, aber doch verschiedenen Methoden ist es dabei, neue Fragen aufzuwerfen.