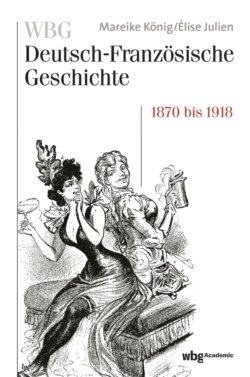Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 18
2. Den Krieg trotz allem hinter sich lassen: Die Demobilisierung der Soldaten in Deutschland und Frankreich 2.1. Eine überwundene Krise
ОглавлениеObwohl der Krieg in seinen Grundzügen in verschiedenen Bereichen fortgesetzt wurde, sehnten sich die französischen und deutschen Gesellschaften in großen Teilen nach Frieden und einer Rückkehr zum Alltag. Der Friede wird in der Tat mit enormer Erleichterung begrüßt. Ernst Troeltsch spricht sogar von einem „Traumland der Waffenstillstandperiode“104.
Die Rückkehr zur Normalität verlief zunächst und vor allem durch die Rückkehr von ungefähr fünf Millionen französischer und sechs Millionen deutscher Soldaten nach Hause und ins Zivilleben. Die Sehnsucht, ein normales Leben wiederzuerlangen, was Jay Winter als „Nostalgie“105 bezeichnet, hatte sich nach und nach während des Konflikts herausgebildet und ging, bisweilen bei ein und derselben Person, mit der bereits erwähnten Hoffnung auf einen Sieg einher. Sobald Gewissheit über das Ende herrschte, erleichterte diese Sehnsucht die Rückkehr der Soldaten nach Hause und zur Arbeit sowie die gleichzeitige Rückkehr der Frauen von den Fabriken an den heimischen Herd106. Die Soldaten konnten sich gewiss sein, dass sie Anerkennung finden würden, beziehungsweise, dass gegen ihre Vorgesetzten und die Niederlage revoltiert werden würde. Allerdings teilten die Soldaten die erwähnte Nostalgie mit der Bevölkerung hinter der Front, was den Erfolg der beiden Demobilisierungen teilweise zu erklären vermag. Auch andere Faktoren erklären diese ruhige Rückkehr107, darunter diffuse Ängste der führenden Eliten in Deutschland wie in Frankreich, etwa vor einer revolutionären Ansteckung. Diese Eliten sahen – vor allem im Falle Deutschlands – die sozio-ökonomische Krise am Kriegsende voraus, welche die wirtschaftliche Wiedereingliederung der Demobilisierten erschwerte, und fürchteten dabei die Unzufriedenheit der Soldaten, die so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren wollten. Sie entschieden sich nach und nach, den teuren Preis zu zahlen, damit sich die Demobilisierung so gut wie möglich abspielte. Aber dorthin musste man erst noch gelangen. Dieser „Übergang“ war in der Tat entscheidend. De facto war er stark ritualisiert und eingeteilt in „drei Phasen, die den auf Übergangsriten spezialisierten Ethnologen wohlbekannt sind“108:
„Während einer Trennungsphase verabschiedet sich der Soldat gleichzeitig vom physischen Kontakt mit der Kampfzone, der Gesellschaft einiger seiner Kameraden, der Nähe der Toten (…) Daran schließt sich eine einleitende Phase an (…), in der sich der Veteran nach und nach eine neue Identität schafft. Schließlich, in einer mehr oder weniger langen Eingliederungsphase, integrieren sich die Männer – oder versuchen, sich zu integrieren – in das zivile Wirtschaftsleben, in die Regeln der Zivilgesellschaft, in die alltäglichen Familien- und Freundschaftsbeziehungen“109.
Hieran wird noch einmal deutlich, wie wichtig der Erfolg dieser Operation für das künftige Gleichgewicht der Nachkriegsgesellschaften ist, die zu diesem Zeitpunkt, 1918–1920, Gesellschaften im Übergangszustand sind, im „Dazwischen“110. Der Fall Frankreichs kann angesichts des herannahenden Sieges von vornherein als weniger schwierig betrachtet werden als jener Deutschlands. Vielleicht sind daher die mit der Demobilisierung verbundenen konkreten Probleme von französischer Seite weniger gut vorausgesehen worden111.
Wie dem auch sei, der Sieg erlaubt es eher, den gesamten Maßnahmen der Anerkennung einen Sinn zu verleihen. Darüber hinaus ist die politische Lage weit weniger chaotisch, und trotz sehr starker sozialer Spannungen erscheint die Möglichkeit einer Revolution weniger wahrscheinlich.
Im deutschen Fall macht die Niederlage Anerkennungsmaßnahmen schwieriger, und die Revolution ist bereits da. Die neuen republikanischen Führer müssen diese gleichzeitig erhalten, die neuen republikanischen Institutionen schaffen und es vermeiden, von einer noch viel radikaleren Revolution überschwemmt zu werden, während es ihre größte Angst ist, dass die bewaffneten und häufig ausgehungerten Soldaten sich den Gegnern des Regimes auf der Rechten oder Linken anschließen. Sie müssen die Soldaten demobilisieren, um sie zu entwaffnen, und dabei gleichzeitig ein bewaffnetes Kontingent zu ihrem eigenen Überleben behalten.
De facto hatte das Deutsche Kaiserreich, auch wenn es seit 1916 Demobilisierungpläne besaß112, nicht damit gerechnet, dass es diese in einem Kontext der Niederlage, der Revolution, des politischen Regimewechsels und des Chaos würde ausführen müssen. Doch schließlich verwandeln sich diese chaotische Situation und die von den Alliierten aufgezwungenen Einschränkungen, die eine rasche Demobilisierung und einen Rückzug vom linken Rheinufer fordern, zu einer Ressource, die es erlaubt, die Demobilisierung zu beschleunigen und die Hauptforderung der Soldaten, nach Hause zurückzukehren, zu erfüllen. Am 1. Dezember 1918 haben sich bereits eine Million von ihnen selbständig auf den Weg gemacht und sich damit selbst demobilisiert113. Richard Bessel beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen: „Die übereilte und chaotische Natur der militärischen Demobilisierung war nicht notwendigerweise schlecht“114. Im Gegensatz zu Frankreich, wo sie notwendig war, wäre eine progressive Demobilisierung in Etappen, so wie sie vorgesehen war, unnötig und angesichts des starken Willens, nach Hause zurückzukehren, sogar gefährlich gewesen.
Aber diese Rückkehr schuf Probleme hinsichtlich der Logistik, des Transports und der Aufrechterhaltung der Ordnung. Unruhe, Verbrechen und Straftaten aufgrund der Unordnung stiegen an, und die Soldaten zögerten nicht, ihre Waffen, ihre Pferde und alles von Wert zu verkaufen. Die Regierung schätzte, dass 1920 fast 1,9 Millionen Gewehre und 8500 Maschinengewehre im Land zirkulierten115. Die Soldaten hingegen waren von der schleppenden Versorgung mit Nahrungsmitteln und Zivilkleidung irritiert.
Ein Mittel, um die Geister zu beruhigen, lag darin, eine „moralische Ökonomie der Anerkennung“ zu schaffen. Es ging darum, die Soldaten in ihren Garnisonsstädten und daheim gut zu empfangen und ihnen die Anerkennung der Familie, der Stadt, der ganzen Nation auszudrücken. In genau diesem Kontext entstand die Legende der auf dem Feld unbesiegten Armee. Damals hatte diese Legende eine unmittelbare soziale Funktion. Weil man die Soldaten so sehr fürchtet, dass man beschließt, sie zu ehren, organisieren die Gemeinden, die Soldatenräte bis hin zu Ebert Zeremonien, um ihnen für ihre Opfer zu danken. All die Triumphbögen, Dekorationen, Girlanden und Fanfaren sollten diese Anerkennung ausdrücken.
Jeder hatte verstanden, dass die Rückkehr zur Ruhe – sogar die Verteidigung der Revolution und der Republik in diesem unentschiedenen und unruhigen Monat Dezember – zu diesem Preis erfolgte. In diesem Kontext muss auch die Rede Eberts im Dezember verstanden werden, als er die Soldaten unter dem Brandenburger Tor empfängt, dem Symbol der preußischen Siege. Wie die Mehrheit der Amtsträger jener Zeit, unterstreicht er am 10. Dezember, dass die tapferen Soldaten „auf dem Schlachtfeld unbesiegt“116 zurückgekehrt seien, um nachdrücklicher auf der Anerkennung des Landes zu bestehen.
Wenn dies auch nicht bedeutete, das Ebert die Niederlage als solche bestritt117, konnte diese Art von Reden mittelfristig aus ihrem Zusammenhang gerissen werden und zum Glauben an den Dolchstoß beitragen, denn sie verlieh ihm letztlich ein notwendiges Argument: die Tatsache, dass die Armee nicht besiegt worden war und man daher die Gründe für die Niederlage woanders suchen musste118.
Für den Augenblick funktionierte jedoch die Politik der moralischen Anerkennung gegenüber den Soldaten im Großen und Ganzen, denn die von den Soldaten gewünschte Rückkehr entwickelte sich zwischen 1918 und 1920 nicht zu einem Sturz der Republik. Trotz der Putschversuche und der Aufstände der extremen Rechten schloss sich die Mehrzahl der Soldaten zunächst zumindest der Revolution und der Republik an, blieb passiv oder akzeptierte es sogar, der bewaffnete Arm der gemäßigten Republik gegen die Anhänger einer radikaleren Revolution auf der Linken zu sein.
Die symbolische Reintegration und die Demobilisierung in einem politisch unruhigen Kontext Ende 1918 und Anfang 1920 war allerdings nicht das einzige Problem, das es zu lösen galt. Es war überdies die notwendige wirtschaftliche und soziale Wiedereingliederung in einer dafür ungünstigen Periode zu bewältigen.
Wenn auch in Frankreich weitaus weniger Chaos herrschte, so war es doch mit einer Reihe spezifischer Probleme konfrontiert. Weil der Waffenstillstand nicht das Kriegsende bedeutet – man muss sicherstellen, dass die Deutschen die Bedingungen erfüllen werden –, demobilisiert er nicht sofort, auch wenn die Soldaten verlangen, nach Hause gehen zu können.
Zudem muss Frankreich relativ kurzfristig in der Lage sein, eine bestimmte Truppenzahl in Bereitschaft zu lassen, die bestimmte Waffenstillstandsklauseln (v.a. die Besetzung des linken Rheinufers) garantieren und den Status Frankreichs als große Siegermacht, vor allem im Osten des Kontinents, sicherstellen sollen. Das Chaos in Deutschland betont diese Notwendigkeit zusätzlich. Ende April 1919 zählt die französische Armee noch 2,3 Millionen Mann119, nachdem eine erste Demobilisierungsphase bereits zwischen November 1918 und April 1919 stattgefunden hat. Schließlich kann eine bestimmte Anzahl Demobilisierter wegen der Kriegsschäden auf französischem Boden nicht zu sich nach Hause zurückkehren.
Alle diese Faktoren und eine relativ mangelhafte Vorbereitung der Regierenden – ein Unterstaatssekretariat zur Demobilisierung wird erst am 6. Dezember 1918 geschaffen – führen dazu, dass die Demobilisierung zunächst chaotisch verläuft und dass die Unzufriedenheit der Soldaten auf besorgniserregende Weise ansteigt120. Die Entscheidung, die Soldaten zugleich nach Alterskategorie gemäß Dienstalter, nach der Familiengröße und der Anzahl der Getöteten in der Familie zu demobilisieren121 – und nicht Einheit für Einheit –, verstärkte zudem die Ungewissheit der Soldaten bezüglich des Zeitpunkts ihrer Demobilisierung, stimmte aber mit den egalitären Prinzipien überein, denen die Soldaten meist „zutiefst verbunden“122 waren.
Wie dem auch sei, die Langsamkeit der Demobilisierung schürte die Unzufriedenheit der Soldaten, die es eilig hatten, nach Hause zu kommen. So konnte General Gérard von der 8. Armee am 25. März 1919 nur notieren: „Beinahe alle finden den Fortgang der Demobilmachung und vor allem die Friedensverhandlungen nach ihrem Geschmack zu langsam“123.
Die Kräfte können nur gesteigert werden, wenn die zu entlassenden Soldaten nach Hause gelangen. Zahlreiche Zwischenfälle begleiten diese Rückkehr, die gekennzeichnet ist von den charakteristischen widersprüchlichen Gefühlen dieses Übergangsmoments: Ungeduld, Zorn und Freude mischen sich. De facto werden einige Offiziere angerempelt, die Züge der Soldaten werden beschädigt (13.000 Glasschäden und 400 zerstörte Türen durchschnittlich jeden Monat124).
Mit ihrer Rückkehr an den heimischen Herd legten sich die Ungeduld und der Zorn der Soldaten nicht unbedingt. Paare und Familien konnten durch den Krieg zerstört worden sein – das war eines der Themen der Kriegsliteratur, sehr präsent bei Roland Dorgelès oder Henri Poulaille beispielsweise, und sogar des Kinos mit der ersten Version von J’accuse (Ich klage an) von Abel Gance125. Außerdem florierte die sozio-ökonomische Lage nicht, sodass sich der Kontrast zwischen den Erwartungen der Soldaten und der Realität wiederum als überaus problematisch herausstellen konnte. General Nollet beschrieb die geistige Verfassung der Soldaten im April 1919 mit folgenden Worten:
„Der Krieg hat bei den Männern eine gewisse Sorglosigkeit gegenüber der Zukunft hervorgebracht, die Unterstützungszahlungen haben ihren Familien den Unterhalt gesichert, für die Zukunft zählen sie auf den Staat. Es ist eine Desillusionierung zu befürchten, deren Konsequenzen ernst sein können … schon jetzt beklagen sich einige Leute, man halte die gegebenen Versprechen nicht“126.
Ziemlich häufig stellt sich in diesem Moment der Bruch zwischen der Front und dem Hinterland heraus, der schon während des Krieges empfunden wurde, und wird zum Topos in der Kriegserinnerung der Soldaten. Die zurückgekehrten Soldaten beschuldigen die Zivilisten nicht nur, dass diese hinterhältig gewesen seien, sondern auch, dass sie ihnen ihren Platz, ihre Arbeit weggenommen hätten und sich weigerten, diese zurückzugeben127. Diese Rhetorik zeigt sich bis ins Manifest der Association des écrivains combattants (AEC) vom Juli 1919:
„Aber nach diesen Jahren der Strapazen, der Angst und der Qualen wollen wir wieder unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Hier gibt es verarmte oder dezimierte Häuser. Das Vergessen, in dem wir uns fünf Jahre lang befanden, in das wir abgeschoben wurden, verstärkte die Dunkelheit. Wer wäre nicht bewegt von der packenden Gerechtigkeit unserer Sache? Man hält uns für heftig Reuige, Schwankende. Man fürchtet uns nicht mehr. Die Kampagne, die gegen die Schriftsteller und die Bücher des Krieges geführt wird, bezeugt es. Sie enthüllt die unausstehlichen Intentionen derjenigen, die während unserer Abwesenheit unsere Plätze eingenommen haben und überdies unsere Inbrunst verhöhnen und uns in die Armut und in den Schatten zurückstoßen wollen. (…) Und diese uneingestandene, aber aktive Feindseligkeit, die wir bei unseren Stellvertretern spüren, die nicht gekämpft haben, wird von unserem versammelten Bataillon gebrochen werden“128.
Die Demobilisierten demonstrieren bisweilen ihre Unzufriedenheit auf der Straße, vor den Präfekturen. Der berühmte Satz von Clemenceau – „Sie haben Ansprüche an uns“ – bestätigte implizit die Soldaten in ihren Forderungen nach Integration und Anerkennung.
Eine der Lösungen, um mit dieser „außergewöhnlichen Bewegung von Männern“129 fertigzuwerden, lag, wie in Deutschland, im Bereich der Symbolik. Es ging darum, die fünf Millionen Männer zu empfangen, die in ihre Häuser zurückkehrten. Auf lokaler Ebene wurden, wie übrigens auch in Deutschland, zahlreiche Zeremonien veranstaltet, vor allem in den Garnisonsstädten zur Rückkehr der Regimenter. Auf nationaler Ebene wurden sowohl finanzielle als auch symbolische Maßnahmen beschlossen.
Anfang des Jahres wurde ein Gesetzt verabschiedet, das eine Demobilisierungszahlung in der Höhe von etwa zwei Monaten Lebenshaltungskosten vorsah130. Ein Abgeordneter erklärte, dass diese finanzielle Maßnahme eine sehr unzureichende Form der Gegenleistung sei im Verhältnis zu den immensen dargebrachten Opfern: „Der Gedanke, der uns (diesen Gesetzesvorschlag) diktiert hat, ist ein Gedanke der Gerechtigkeit und der Achtung gegenüber den Frontsoldaten (…) Diese Vergütung ist keine Entschädigung“131. Die Prämien wurden gemäß der Dauer der Mobilisierung und der Präsenz an der Front verteilt.
Da die Mehrheit der Soldaten den Wunsch äußerte, ein greifbares Souvenir ihrer Anwesenheit an der Front zu behalten, erhielten sie die Erlaubnis, ihren Helm aufzubewahren, und man verteilte auch eine offizielle Plakette, auf der „Soldat des Ersten Weltkriegs“ eingraviert war. Laut Bruno Cabanes hatte diese symbolische Geste eine große Bedeutung bei der Demobilisierung, indem sie den Soldaten gestattete, ein konkretes Zeichen ihrer vergangenen Identität und der Anerkennung ihres Mutes, ihrer Opfer und ihres speziellen Status durch die ganze Gesellschaft aufzubewahren.