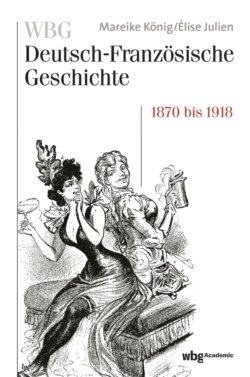Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 17
1.3.2. Der Fall des Elsass
ОглавлениеDie deutsch-französische Perspektive schließt auch die regionale Analyseebene ein. Tatsächlich ist die deutsch-französische Geschichte auch die Geschichte der Regionen zwischen Frankreich und Deutschland, der Grenzen und der Kontakte. In der Zeit, die uns beschäftigt, stellt der Fall Elsass-Lothringen und damit die Rückkehr der verlorenen Provinzen – wie es in der französischen Terminologie damals hieß – einen wichtigen Aspekt dieser Geschichte dar.
Abgesehen von der Freude der Bevölkerung bei der Ankunft der französischen Truppen, die am 22. November in Straßburg kulminierte und Poincaré bei dieser Gelegenheit sagen ließ: „Das Plebiszit ist geschaffen“86, war eine der radikalsten politischen Äußerungen der fortgesetzten Feindseligkeit nach dem 11. November 1918 die französische Politik gegenüber den deutschstämmigen Elsässern, die gewöhnlich als Altdeutsche oder umgangssprachlich auf Elsässisch als Schwowa bezeichnet werden. Dieser Ausdruck bedeutete eigentlich Schwabe, wurde aber verwendet für alle Deutschen, die nicht ursprünglich aus dem Elsass stammten. Zwischen 1871 und 1914 ließen sich mehr als 120.000 dort nieder87. Sehr schnell – am 2. November 191888, noch vor dem Waffenstillstand – entschieden die Franzosen, sie in großer Zahl aus dem Elsass zu vertreiben. Diese „Säuberung“89, wie sie zeitgenössisch in Quellen genannt wird, wurde nicht nur außerhalb des Elsass beschlossen. Die Wirtschaftskrise, die Versorgungsprobleme und die Arbeitslosigkeit, die die Arbeiter traf, spiegelten sich in einem zunehmenden Gegensatz zwischen Elsässern und Deutschen wider. So entstanden „von unten“ offiziöse „Säuberungskomitees“, um zur Auswahl und zur Vertreibung der Deutschen von den Arbeitsplätzen zu schreiten, und sehr schnell auch aus dem Gebiet selbst. François Uberfill schreibt überdies, dass die Polizei in Straßburg von Denunziationsbriefen buchstäblich überflutet wurde. Die ersten Vertreibungen von November bis Dezember 1918 waren bisweilen brutal und willkürlich, indem sie den Menschen nicht mehr als 24 Stunden ließen, um 40 kg Gepäck zusammenzustellen und das Elsass zu verlassen, oft bis zur Brücke von Kehl begleitet von einer feindseligen Menschenmenge. Maria Falk, eine Straßburgerin, beschreibt die Vertreibung einer deutschen Freundin am 8. Dezember 1918:
„Das Portal öffnete sich. Die ersten Ausgewiesenen kamen heraus, sie trugen Koffer und Bündel. Für einen kurzen Moment hielt die Menge erstaunt inne, dann ging ein Sturm von Beleidigungen los: ‚Da sind sie, die dreckigen Deutschen, die Schweine! Haut ab! …‘ – alles wurde von großem Geschrei begleitet. (…) Jedes Mal, wenn ein Deutscher mit seinem Namen gerufen wurde, wurde er mit Beschimpfungen überschüttet. Alle waren bleich und versuchten, sich gegenseitig zu helfen. Der Rollstuhl, auf dem sich die alte Dame befand, wurde hereingebracht. Ihr Koffer war auf ihre gelähmten Beine gelegt. Ihre Tochter konnte ihr nicht mehr zu Hilfe kommen. ‚Die Alte da‘, schrie die Menge, ‚stapelt sie in den Lastwagen. Lasst sie Gymnastik machen‘90.“
Die allgemeine Freude, die Deutschen gehen zu sehen, spiegelt sich in den berühmten Zeichnungen von Hansi, eigentlich Jean-Jacques Waltz, wider91. Man findet sie auch in hochgradig symbolischer Weise in der Demontage und der Zerstörung von Statuen, die die deutsche Präsenz symbolisieren, durch die Menge. Der Kopf Wilhelms I. wird am 21. November 1918 durch die Straßen von Straßburg geschleift, am Tag vor der Ankunft General Gourauds und seiner Truppen92. Einige Wochen später entfernten die Straßburger eine allegorische Statue, die von den Deutschen aufgestellt worden war, den „Vater Rhein“, und verlegten die Bewachung der Grenze an die Mosel93. Durch diesen hochgradig politischen und symbolischen Akt stellten sie die französische Konzeption des Rheins als nationale Grenze wieder her und wiesen jene zurück, die bisher Geltung hatte, die des „deutschen Rheins“. Sie stimmten hierin mit der Konzeption einiger Militärs, Politiker und Literaten überein, die eine „Französisierung“ der linken Rheinseite über das Elsass hinaus vorhersahen94.
Angesichts der Flut von Anträgen der Zivilbevölkerung, die Ausweisungen zu beschleunigen, versuchten die Behörden Anfang 1919, beruhigend zu wirken und die offizielle Einrichtung von „Auswahlkommissionen“ – eine Idee, die auf den ersten französischen Einfall in das Elsass im Oktober 1914 zurückging – zu verzögern. Die Kommissionen existierten von Mitte Januar bis Mitte Juni 191995.
Diese Maßnahmen richteten sich zunächst gegen die „Unerwünschten“ – Deutsche und Elsässer, die als den Deutschen zu nahestehend galten –, wurden jedoch rasch auf die Gesamtheit der Altdeutschen ausgeweitet, die nach und nach alle unerwünscht waren. Doch in der Zwischenzeit hatten einige ihre Landsleute oder Elsässer geheiratet und Kinder bekommen. Politische Kriterien – die echte oder vermutete Feindschaft zu Frankreich – wurden zu ethnischen Kriterien und betrafen alle deutschstämmigen Einwohner des Elsass. Die Ausweisungen wurden somit massiv und systematisch. Die Kriterien zur Feststellung der Nationalität gingen hier ebenfalls auf die Kriegsjahre zurück, genauer gesagt auf die Elsass-Lothringen-Konferenz vom 19. bis 26. April 1915, die die Rückeroberung als eines der Hauptkriegsziele Frankreichs betrachtete. Diese Konferenz sah die Einrichtung von vier Kategorien und Typen von Ausweisen vor. Alfred Wahl und Jean-Claude Richez fassen es so zusammen: „Jeder erhielt einen Ausweis gemäß seiner nationalen Herkunft. Seit dem 14. Dezember 1918 wurden durch einen Ministererlass vier Kartenmodelle eingerichtet: A, B, C und D. Die Karte A, die mit den Farben der Trikolore gekreuzt war, wurde an all diejenigen ausgeteilt, deren Eltern und Großeltern in Frankreich oder im Reichsland geboren worden waren. Die Karte B, die von zwei roten Strichen gekreuzt wurde, stand jenen zu, von denen ein Eltern- oder Großelternteil deutschen Ursprungs war. Die Karte C, von zwei blauen Strichen gekreuzt, war für jene vorgesehen, deren mütterliche und väterliche Herkunftslinien aus einem alliierten oder während des Krieges neutralen Land stammten. Die Karte D schließlich, ohne jede Linie, wurde an die ‚Ausländer aus feindlichen Ländern‘ ausgegeben, also an Deutsche, darunter auch diejenigen, die nach 1871 in Elsass-Lothringen geboren worden waren“96.
Wahl und Richez erwähnen sogar Zeugnisse, gemäß derer „die Inhaber der Karte A sich darüber empörten, dass die Inhaber der Karte B ihnen nicht den Vortritt in den Warteschlangen lassen mussten“97. Diese Unterscheidung hatte auch unmittelbare finanzielle Auswirkungen, denn die Inhaber der Karte A profitierten von einem vorteilhaften Kurs von 1,25 FF für 1 Mark (im November waren es noch 1 Mark für 0,60 FF)98, während der Standardkurs bei 0,80 FF für 1 Mark für die anderen lag. Indem die Behörden die feindlichen und die alliierten oder neutralen Ausländer voneinander unterschieden und indem sie Kindern, von denen ein Elternteil deutsch war, auch wenn sie im Elsass geboren worden waren, eine Unterkategorie (B) zuschrieben, stigmatisierten sie sie gemäß ihrer Abstammung. Dies stellt in der Geschichte der Republik einen einmaligen Fall dar, der sich weit von der französischen Tradition des Staatsbürgerschaftsrechts entfernt. Immerhin scheint es klar, dass diese Maßnahmen ihrem Ursprung nach ein direktes Erbe antideutscher Feindseligkeiten sind, die sich während des Krieges radikalisiert und biologisiert haben, und die, so scheint es, anschließend die elsässische Bevölkerung erreichten. Zweifellos reihen sich diese Maßnahmen eher in eine Kontinuität mit dem Ersten Weltkrieg ein, als dass sie die diskriminierende und klassifizierende Gesetzgebung des Vichy-Regimes ankündigen99.
Tatsächlich dienten die Karten auch zur Unterstützung bei der Ausweisung der Deutschen aus dem Elsass. Im Fall Straßburgs schätzt François Uberfill die Anzahl der Ausgewiesenen auf 28.000 bis 29.000 zwischen November 1918 und Ende 1921, wobei der Großteil von ihnen zwischen November 1918 und November 1919 ausgewiesen wurde. Die Anzahl der ausgegebenen Karten D betrug 31 200 für die elsässische Hauptstadt.
Im Juni 1919 wird gemäß dem Wunsch des Generalkommissars Millerand eine neue Institution geschaffen100: die Sonderkommission zur Prüfung der Ausländer (Commission spéciale d’examen des étrangers – CSE), die die von der Armee eingerichteten Auswahlkommissionen ablöst. Sie soll die Denunziationsfälle behandeln und die Fälle derjenigen, die aus dem ein oder anderen Grund im Elsass bleiben möchten.
Die Gesamtanzahl der Ausgewiesenen für das Elsass ist schwierig festzustellen, umso mehr als die Archive lückenhaft sind und die Angelegenheit von elsässischen Autonomisten wie von Vereinigungen ausgewiesener Deutscher instrumentalisiert wurde. Gemäß François Uberfill erscheint die Zahl von 129.000 Vertriebenen oder ‚freiwillig‘ Repatriierten plausibel, die in einer Sammelpublikation aus den 1930er Jahren mit dem Titel Das Elsass 1870–1932 auftaucht. Für A. Wahl und J.-C. Richez beläuft sich die Gesamtanzahl auf 100.000101.
Während sich die Vertreibungen in ihrer symbolischen Dimension sowohl in die Geschichte des Elsass als auch in diejenige des Ersten Weltkrieges einordnen lassen, erfüllten sie darüber hinaus eine nachgeordnete, aber ebenfalls sehr wichtige Funktion als Mittel, um die Situation der elsässischen Bevölkerung in dieser Zeit der Krisen, des Mangels und der Arbeitslosigkeit zu verbessern: Die Vertreibungen befreiten den Kaufmann von einem Konkurrenten, boten dem Arbeitslosen eine Stelle etc.
Unter dieser Masse von Vertriebenen und Repatriierten erhielten einige mehr Aufmerksamkeit als andere. Die deutschen Eliten beispielsweise wurden sehr systematisch ausgewiesen und wurden Objekt von Spezialbehandlung und Spezialkonvois, von denen die bekanntesten und symbolhaftesten jene der Hochschullehrer der Straßburger Kaiser-Wilhelm-Universität sind102. Von den deutschstämmigen Professoren schaffte es nur Werner Wittich, aufgrund seiner Ehe und seiner Verbindungen, vor Ort zu bleiben, allerdings verlor er seinen Posten an der Universität.
Die deutsche Universität und Wissenschaft blieb verbunden mit ihrer Rolle, die sie bei der Germanisierung des Elsass gespielt hatte, sowie mit der Erinnerung an das Manifest der 93 im Jahr 1914 und an den Gaskrieg, der die Alliierten aufs Äußerste empört hatte. Der deutsche Professor hatte während des Krieges ein sehr mächtiges und mobilisierendes Feindbild dargestellt. Der Boykott, der die deutsche Wissenschaft in den Nachkriegsjahren traf, ist auch sehr eng mit diesen Erinnerungen verbunden, und die Behandlung der Hochschullehrer in Straßburg fügt sich somit in einen allgemeineren Kontext ein.
1918–1919 wird der Krieg also auf dem regionalen Niveau des Elsass sowie auf deutschem Territorium im Milieu der aus dem Elsass vertriebenen Deutschen fortgesetzt, die die Frage Elsass-Lothringens – mit sehr begrenztem Erfolg103 – auf der Agenda der großen Politik zu halten versuchen. In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg hingegen findet diese Fortsetzung des Krieges dann an anderen Fronten statt. Dies steht nicht notwendigerweise im Widerspruch zum Willen, zum Alltagsleben zurückzukehren und somit eine rasche Demobilisierung einleiten zu können, die von weiten Teilen der deutschen und französischen Veteranen und Zivilisten gewünscht wird.
33 Arnold Gehlen zitiert nach BREUER 1996 [486], S. 8.
34 Über die Debatten, die sie hervorrufen, siehe II.8.
35 BEAUPRÉ 2006 [741], REIMANN 2000 [384].
36 KOSELLECK 1990 [100].
37 FREUD 1915 [46].
38 Die Debatten um diesen Begriff zählen zu den spannendsten der letzten Jahre. AUDOIN-ROUZEAU/BECKER 1997 [266]. Vgl. den Abschnitt 2.6. der Bibliographie.
39 Le Petit Provençal vom 12. November 1918, zit. von LE NAOUR 2005 [358], S. 125.
40 Zitiert nach BEAUPRÉ 2006 [741], S. 34.
41 Über das Jahr 1917, u.a.: BECKER 1997 [281].
42 Zitiert nach DEMM 1999 [310], S. 363. Siehe auch LINDNER-WIRSCHING 2004 [361] und BEAUPRÉ 2006 [741].
43 AUDOIN-ROUZEAU/BECKER 2000 [262], S. 182–195.
44 GEYER 2006 [325], S. 41.
45 BECKER 1997 [281], S. 105–111.
46 PEUKERT 1987 [217], S. 36; GAY 1993 [199], S. 25.
47 Die Zahlen stammen aus R. Ia. Ezerov, I. P. Mador, T. T. Timofeev, zit. von CHARLE 2001 [166], S. 285.
48 ZIEMANN 2004 [426], S. 142–144.
49 LIULEVICIUS 2002 [362], S. 189–217.
50 VINCENT 1985 [405], S. 124–156.
51 ZIEMANN 2004 [426], S. 144–145; ZIEMANN 1999 [421].
52 DUMÉNIL 2004 [316], S. 235.
53 Ebd., S. 229.
54 ZIEMANN 1999 [421], S. 182.
55 GEYER 2001 [323], S. 475.
56 Ebd., S. 502.
57 DEIST 1986 [305] und DEIST 1992 [306].
58 DUMÉNIL 2004 [316], S. 255.
59 PEUKERT 1987 [217], S. 168.
60 HAFFNER 2002 [50], S. 26.
61 Ebd., S. 29.
62 GEYER 2001 [323], S. 489.
63 DUMÉNIL 2004 [316], GEYER 2004 [324].
64 LE NAOUR2005 [358], S. 114
65 CABANES 2004 [294], S. 24.
66 Ebd., S. 32.
67 RENOUVIN 1968 [386].
68 KRUMEICH 2004 [351], S. 981.
69 Ebd., S. 987.
70 Kapitel II.3 bis II.5.
71 DELPAL 2001 [309].
72 Siehe Kapitel II.6.3.
73 Es gibt nur ein Überblickswerk zu diesem grundlegenden Problem: VINCENT 1985 [405]. Zu den Auswirkungen der Blockade in Berlin: WINTER/ROBERT 1997 [419], S. 305–341 und 487–523.
74 Die Zahlen stammen alle aus WINTER/ROBERT 1997 [419], S. 487–524.
75 Über diese Debatte und ihre Verbindungen zur Dolchstoßlegende siehe BARTH 2003 [270], S. 26–37.
76 BONZON/DAVIS 1997 [290], S. 333–339.
77 DAVIS 2000 [304].
78 BONZON/DAVIS 1997 [290], S. 317.
79 VINCENT 1985 [405], S. 136.
80 Ebd., S. 141–145.
81 LIULEVICIUS 2002 [362].
82 VINCENT 1985 [405], S. 150.
83 Siehe Kapitel II.8.
84 DAVIS 2000 [304], S. 243.
85 VINCENT 1985 [405], S. 162.
86 Zitiert nach ROTH 2004 [658], S. 1065. Siehe auch GRANIER 1969 [600]. Der echte Enthusiasmus der Elsass-Lothringer hinderte diese nicht daran, ihre sozialen, schulischen und religiösen Rechte zu verteidigen, die sie während des Deutschen Kaiserreichs erhalten hatten, das sie ansonsten wenig vermissten. Zum Einzug der Truppen selbst siehe BAECHLER 1969 [558], S. 393–407.
87 WAHL/RICHEZ 1994 [675], S. 114–121.
88 GRÜNEWALD 1984 [603], S. 20 und UBERFILL 2001 [673]. Die Passagen zu dieser Frage verdanken den beiden Werken vieles, auf die mich Jean-Marc Dreyfus freundlicherweise hingewiesen hat. Sie sind die einzigen, die eingehend auf diese Frage eingehen. Das letztgenannte ist besonders präzise und wertvoll, behandelt jedoch nur Straßburg. In ihrer Gesamtheit wartet diese Episode noch auf ihren Historiker. Der sehr patriotische GRANIER 1969 verliert kein Wort über diesen Punkt.
89 UBERFILL 2001 [673], S. 196–284.
90 Ebd., S. 336.
91 Siehe die Frontispiz-Zeichnung dieses Kapitels, S. 17.
92 GRANIER 1969 [600], S. 43.
93 OETTINGER 2004 [651]. Dieser Autor sieht hierin nur eine unverständliche Bewegung einer antideutschen Menge, ohne den symbolischen Aspekt dieser Demontage zu erfassen.
94 WEIN 1992 [676]. Siehe auch Kapitel II.5.
95 UBERFILL 2001 [673], S. 206.
96 WAHL/RICHEZ 1994 [675], S. 117.
97 Ebd., S. 118.
98 UBERFILL 2001 [673], S. 196–284. Die Währungsumstellung schuf auch neue Ungleichheiten innerhalb der elsässischen Bevölkerung und ließ die Lebenshaltungskosten steigen.
99 Zu dieser Frage: NOIRIEL 1999 [249].
100 Dieser publizierte wenig eloquente Erinnerungen zu dieser Frage: MILLERAND 1923 [69], S. 30–31.
101 WAHL/RICHEZ 1994 [675], S. 118; UBERFILL 2001 [673]: In seinem Vorwort unterstreicht Pierre Ayçoberry, dass das Verschwinden der Archive der Auswahlkommission, das jede exakte Rechnung erschwert und den Blick auf die Vorgehensweisen dieser Kommissionen verdunkelt, vielleicht Ausdruck eines schlechten Gewissens sei und/oder das Zeichen, dass man die Spuren dieser Arbeit verwischen wollte.
102 UBERFILL 2001 [673], S. 239ff.
103 BARIÉTY 1977 [430], S. 5–25; GRÜNEWALD 1984 [603].