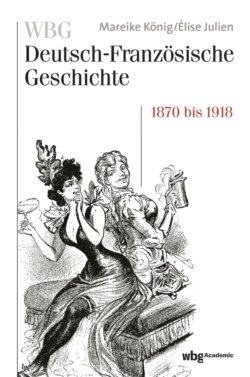Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 14
1.2. Ende der Kriegshandlungen und Beginn einer neuen gegenseitigen Feindschaft
ОглавлениеNoch vor dem Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 wurde man sich erst in den Kanzleien und dann der Front bewusst, dass die Entscheidung auf den Schlachtfeldern des Westens fallen würde. Natürlich waren Franzosen und Deutsche bei weitem nicht die einzigen Kriegsparteien, die sich gegenüberstanden, aber der Krieg sollte nun in Frankreich gewonnen oder verloren werden. Obwohl der Krieg ein Weltkrieg blieb – die Auswirkungen des US-amerikanischen Kriegseintritts im April 1917 begannen sich nun direkt bemerkbar zu machen –, wurde er in gewisser Weise im Jahr 1918 wieder deutsch-französisch. Die Geister wurden erneut mobilisiert, und die Hoffnungen auf den Sieg waren, nach der wiederholten Niedergeschlagenheit über die Kriegsdauer und nach den Niederlagen in den großen Materialschlachten der Jahre 1915, 1916 und 1917, wiederbelebt. Das Jahr 1917 war in der Tat durch eine extreme Kriegsmüdigkeit unter den Kriegsparteien gekennzeichnet, vor allem in Deutschland und in Frankreich. Auch wenn Deutschland nicht wie Frankreich große Wellen von Soldatenmeutereien erlebte, so gab es in beiden Ländern vergleichbare umfassende Streiks45.
Diese Streikwellen hatten Ausläufer bis zu Beginn des Jahres 1918, vor allem in Deutschland mit dem großen Streik im Januar 1918. Ihre Auswirkungen waren sogar über das Jahr 1918 hinaus zu spüren, denn sie wurden den Sozialdemokraten in Deutschland ständig von deren politischen Gegnern zum Vorwurf gemacht.
Dennoch wurde diese „Ernüchterung“46 ab dem Winterende 1917/1918 unterbrochen. Die geschätzte Anzahl der Streikenden 1917 und 1918 bestätigt diese Unterbrechung: In Deutschland waren es 1917 667.000 und 392.000 im Jahr 1918, und in Frankreich 294.000 1917 und 176.000 1918. Im Jahr 1919 steigen diese Zahlen wieder auf 2 321.000 beziehungsweise 1 151.00047.
De facto hatte die Aussicht auf das Kriegsende, und damit auf eine letzte Anstrengung zur Beendigung des Krieges, einen gewissen abschreckenden Effekt, der sich in diesem umfassenden Absinken der Anzahl der Streikenden im Jahr 1918 niederschlägt.
Weiterhin muss angefügt werden, dass die Streiks in der Heimat nicht die Solidarität der Frontsoldaten fand, die sie in ihrer ganz großen Mehrheit ablehnte. Diese Tatsache wird besonders deutlich im Fall des deutschen Streiks vom Januar 1918. Die Soldaten – von denen die Mehrheit Bauern waren und aus der Provinz stammten – hielten die Berliner Arbeiter für Privilegierte, die unberechtigterweise den Krieg durch die Streiks verlängerten, und forderten sie auf, zu ihnen an die Front zu kommen48.
Im Fall Deutschlands können der deutsche Sieg im Osten 1918 und seine Inszenierung durch das Große Hauptquartier, das an seine eigenen utopischen Fiktionen vom Aufbau eines von Deutschland abhängigen Militärstaates glaubt, der Bevölkerung weismachen, dass die Armee ihre Bemühungen auf die Westfront übertragen und schließlich den Sieg davontragen könnte.
Das Abenteuer der Besatzung im Osten und im sogenannten Gebiet Ober Ost wird von intensiven Propagandabemühungen und einer millenarischen Phantasiewelt bezüglich eines Großdeutschland, der Kolonisation und der Vormundschaft über weite Gebiete Osteuropas begleitet. Diese Propaganda und die Erfahrung, die Millionen Soldaten im eroberten Osten machten, generierten neue mentale Karten (mental maps) zeitgleich mit Erwartungen und Ängsten bezüglich der Territorien und ihrer zu kontrollierenden Bevölkerung. Die Erfahrungen bezüglich sozialer und demographischer Projektplanung von Ober Ost, die gekonnt in Szene gesetzt wurden, kultivierten diese Erwartungen und Ängste49.
Sicherlich kompensiert die Anregung der Vorstellungskraft nicht immer die leeren Bäuche und die immer schwierigeren materiellen Bedingungen, denen die vom Krieg erschöpfte deutsche Bevölkerung unterworfen ist. Die Härte der aufeinanderfolgenden „Steckrübenwinter“, die zum Teil der alliierten Blockade zuzuschreiben sind, und die im Krieg ungefähr 800.000 Tote bedingten50, bestätigte die Deutschen in ihrer doppelten Überzeugung, einerseits einen gerechteren Krieg als der Gegner zu führen, und dass es andererseits notwendig sei, ihn rasch zu beenden. Der Frieden sollte schnell eintreten, aber auch siegreich sein. Die großen siegreichen Frühjahrsoffensiven 1918 und die Rückkehr zum Bewegungskrieg verstärkten den Eindruck, das Ende sei nah und der Sieg noch immer möglich. Tatsächlich hat die Großoffensive den Effekt einer erneuten Mobilisierung51, und „das tiefe Streben nach Frieden, das sich in den Korrespondenzen der Soldaten zumindest seit der zweiten Hälfte des Jahres 1916 ausdrückt, geht nun völlig in der Hoffnung auf eine entscheidende Offensive auf“52. Die Frustration angesichts des Scheiterns ab dem Sommer hätte größer nicht sein können.
Zugegebenermaßen waren die Erfolge zu Beginn des Frühjahrs überzeugend. Dank eines gewissen Überraschungseffekts aufgrund reduzierter Artillerievorbereitung und der neuen Taktik, mobile Stoßtruppen in das feindliche Grabensystem einsickern zu lassen, ermöglicht es die Offensive Michael ab dem 21. März 1918 zum ersten Mal seit 1914 wieder, die Front in der Picardie zu durchbrechen. Ende Mai wird die Front bei der dritten großen deutschen Offensive im Sektor des Höhenzugs Chemin des Dames nochmals innerhalb von drei Tagen mehr als 60 km tief durchbrochen.
Seither erblickten selbst die am wenigsten kriegerischen deutschen Soldaten, selbst jene, die vorher zu einem Frieden um jeden Preis bereit waren, die Möglichkeit eines siegreichen Friedens, womit sie sich mit denen trafen, für die ein Frieden ohne Sieg undenkbar war. Und erst nachdem Deutschland „seine wesentlichen Ressourcen an Männern und Material in eine intensive Anstrengung hatte fließen lassen, den Sieg zu erzwingen, bevor die Ankunft der amerikanischen Truppen das strategische Gleichgewicht verändern würde, erlebte es eine schwere militärische Krise, die Niederlage und das Chaos der Revolution“53. Es stimmt, dass diese zunächst erfolgreiche Offensive extrem kostspielig an Menschen war und die logistische Schwäche einer ausgebluteten Armee ebenso offenbarte wie die Blindheit des Oberkommandos, allen voran Ludendorffs, der Mitte Juli einen Rückzug nach der Niederlage seiner Offensive südlich von Reims ablehnte. Am 18. Juli starteten die Alliierten eine Gegenoffensive im Bereich der Somme. Der Generalstab, und hauptsächlich Prinz Ruprecht von Bayern, begriff nun, dass der Krieg militärisch verloren war. Diejenigen, die sich selbst vom Gegenteil überzeugen wollten, konnten dies nach dem „schwarzen Tag des deutschen Heeres“ am 8. August 1918 nicht mehr: An diesem Tag wird die Offensive von Amiens – durchgeführt vor allem mithilfe von mehr als 400 Kampfpanzern, eine Waffe, an die die Deutschen nicht glaubten – mit 12.000 deutschen Gefangenen und ungefähr 18.000 Toten und Verletzten bezahlt. Das Jahr 1918 ist demnach von extremen Wechseln der Truppenmoral gekennzeichnet, deren revolutionäre und gegenrevolutionäre politische Auswirkungen noch näherer Untersuchungen bedürfen54.
Im Oktober 1918 bewegt eine Debatte die Ebene ziviler und militärischer Führungsträger, bevor sie in die Öffentlichkeit gelangt: die einer levée en masse (Massenaushebung). Für Michael Geyer, der ihre Bedeutung betont, konnten Revolution und Niederlage erst ihren Lauf nehmen55, als die Option eines Volkskrieges oder eines Endkampfes – oft nur mit größtem Widerwillen wie im Falle des Reichskanzlers Max von Baden – beiseite geschoben war.
Die politische Entscheidung des Kanzlers und des Reichstages, keinen Endkampf mithilfe einer Massenaushebung zu führen – eine Möglichkeit, die vor allem von Walther Rathenau unterstützt wurde –, als die militärische Niederlage, wie vom Führungsstab zugegeben, vollzogen war, zeugt von großem politischen Mut: „Wichtiger als die militärischen und die Belange des Nationalstolzes war es, den Krieg durch politische Mittel zu beenden“56, schreibt Michael Geyer, nicht ohne anzufügen, dass diese Entscheidung der Ausgangspunkt für tiefe soziale und politische Spaltungen war. Für viele auf Seiten der Rechten und der extremen Rechten war der Endkampf nur vertagt.
Die Erzählungen vom Kriegsende und dem Anfang der Weimarer Republik betonen nun aber immer den „verdeckten Streik der Soldaten“ und die „Verdrossenheit“57 der Zivilbevölkerung. Selbst wenn diese Phänomene echt sind und sich auf chronische Weise verschärfen, als die dramatischen Nachrichten vom Zustand der Armee an der Front durchsickern, darf man nicht vergessen, dass diese Haltung einer mächtigen Bewegung allgemeiner Remobilisierung, vor allem im Jahr 1918, folgte. Dieser Augenblick der Remobilisierung war selbst eine Episode enormen Einsatzes, der 50 Monate lang – mit Höhen und Tiefen – die Bevölkerung beider Länder mobilisiert hatte.
Die Demobilisierung von im Krieg befindlichen Körpern und Geistern folgte also auf sehr große Erwartungen. Sie war auch weniger die Ursache als die Konsequenz der militärischen Niederlage. In Deutschland zerbrach die „Dynamik der Zustimmung“58 angesichts des Wissens um die Niederlage.
Detlev Peukert hat außerdem betont: „Angesichts der millenarischen Hoffnungen, die der Weltkrieg geweckt hatte, musste jeder Friedensschluss zur Enttäuschung führen“59. Dies ist umso wahrer, als diese „millenarischen Hoffnungen“ und andere „eschatologischen Erwartungen“ ein letztes Mal in der ersten Hälfte des Jahres 1918 anschwollen und sich bis zur Idee einer Massenaushebung oder eines Endkampfes im Oktober hielten. Dabei erreichten diese Hoffnungen ein Niveau, das sie seit 1914 nicht mehr hatten. Es handelte sich hier weniger um Euphorie – schwer möglich nach vier Jahren Massensterben – als vielmehr um den Entschluss, den Sieg zu erzwingen, um Frieden zu haben.
Sebastian Haffner, damals ein Jugendlicher, verdeutlicht diese geistige Remobilisierung sehr gut: „Ich wartete tatsächlich auf den Endsieg noch in den Monaten Juli bis Oktober 1918, obwohl ich nicht so töricht war, nicht zu merken, dass die Heeresberichte trüber und trüber wurden und dass ich nachgerade gegen alle Vernunft wartete“60. An anderer Stelle fügt er hinzu: „Wie aber so ein Kriegsende ohne Endsieg aussehen würde, davon hatte ich keinen Begriff; ich musste es erst sehen, um es mir vorstellen zu können“61. Trotz des verdeckten Streiks, der so gerne als untrügliches Zeichen der Verdrossenheit gewertet wird, verhinderten die Frontsoldaten nicht, dass 1918 die heftigsten Kämpfe des ganzen Krieges stattfanden, und das noch vor dessen Höhepunkt, den die minoritäre Selbstmobilisierung der Freikorps darstellte. Die Verlustraten vom Frühjahr zum Sommer 1918, als die Deutschen in die Offensive und schließlich in die Defensive gingen, sind in der Tat die höchsten des Krieges62. Die Zäsur tritt in den Einheiten auf, die in diesem letzten Ansturm dezimiert wurden, als der Sieg nicht mehr denkbar scheint und als individuelle Überlebensstrategien die Oberhand gewinnen. Aber auch diese dominieren nicht völlig, da sehr viele, komplett aufgelöste Einheiten weiterkämpfen und Schritt für Schritt zurückweichen, beherrscht von der Angst, dass der „Verwüstungskrieg“, den sie erlebt haben, in ihr Land transportiert werden könnte63.
Da sie undenkbar war, stellte man sich die Niederlage sehr lange Zeit nicht einmal vor. Für einige blieb sie unwirklich, beziehungsweise der Krieg blieb unvollendet, und der für 1918 erwartete Endkampf sollte noch kommen.
Auf französischer Seite war das Jahr 1918 ebenfalls von einer geistigen Remobilisierung geprägt. Die „Friedenssehnsucht“ kulminierte 1917 nach der Niederlage der Nivelle-Offensive auf dem Chemin des Dames. Der deutsche Vorstoß vom Frühjahr 1918 lässt noch einmal defensive Phantasien hervortreten, die im Zentrum der französischen Kriegskultur standen. Noch einmal wird Paris direkt bedroht. Die Luftangriffe und der Beschuss der Hauptstadt mit schwerer, weitreichender Artillerie wurden im Januar 1918 wieder aufgenommen, ein Beispiel dafür ist der Beschuss der Kirche Saint-Gervais am 29. März 1918 während des Karfreitagsgottesdienstes. Diese Angriffe prägten die Menschen und schweißten das Land zusammen, indem sie die verschiedensten Zwistigkeiten zwischen Front und Hinterland, zwischen Norden und Süden abmilderten. Als in Paris bei einem Zeppelinangriff am 31. Januar 1918 26 Menschen den Tod erlitten, richtete der Stadtrat von Marseille eine Unterstützungsadresse an die Hauptstadt64.
Es gibt also neue Kämpfe an der Marne, und in gewisser Weise spielt man 1918 das Jahr 1914 nach. Anschließend erreichen das deutsche Scheitern und die Aussicht auf einen möglichen Sieg eine geistige Remobilisierung für den besten Frieden, der vorstellbar ist: den Sieg. Je schneller er erreicht wird, desto schneller können die Soldaten demobilisert werden und in das normale Leben zurückkehren, auf das sie hoffen. Hier zeigt sich erneut, dass sich die Hoffnung auf den Sieg – die notwendigerweise über den Kampf führt –, die Erschöpfung der Männer und der Wille zum Frieden und zur Rückkehr in den Alltag nicht ausschließen. Die Archive der Postkontrollbehörde bezeugen diesen Anstieg der Truppenmoral und ihren Willen, mit einem Sieg zum Ende zu kommen65. In gewisser Weise wurden die Ermüdung und der Verschleiß – teilweise – durch die Aussicht auf den Sieg kompensiert. Die Stimmung ist seitdem abhängig vom Vorrücken und vom Fortschritt der Armee, ebenso wie die Lebensbedingungen. Als der Winter näherkommt, während der Sieg schon im Sommer in Reichweite schien, sinkt die Stimmung wieder. Die Beunruhigung wird durch eine Spanische-Grippe-Epidemie verstärkt, die zu wüten beginnt. Aber, wie Bruno Cabanes schreibt: „Diese Erschöpfung der Truppen im September–Oktober 1918 bedeutet auch nicht, dass die Soldaten damit einverstanden wären, dass Frankreich einen raschen Frieden zu jedem erdenklichen Preis unterzeichnet.“ Der Historiker fügt an, dass Formulierungen wie: „Der Moment ist noch nicht gekommen, es ist wichtig den Feind zu schlagen, bevor man mit ihm redet“, die häufigsten in den Soldatenbriefen sind66. Die immer massivere Ankunft der neuen amerikanischen Alliierten und die zunehmende Entdeckung des Zustands der überfallenen, nun befreiten Territorien tragen ebenfalls zur Remobilisierung der Truppen bei.
Wenn wir auf diese französischen und deutschen Erwartungen von 1914 bis 1918 zurückkommen, 1918 zunächst wiederbelebt, dann ab Ende des Jahres zunehmend demobilisiert, dann deswegen, weil sie in Untersuchungen zumeist vergessen werden – diese beginnen häufig am 11. November 1918. Und das, obwohl die Erwartungen des Sieges und an den Sieg eine wichtige Rolle für das Selbst- und Fremdbild spielen. Sie wiegen schwer im Moment der Konfrontation mit der Erfahrung des Waffenstillstands, der Niederlage, des Sieges und schließlich der Konsequenzen der Friedensverträge.
Die Beibehaltung und die Remobilisierung von aus dem Krieg erwachsenen Vorstellungen im Jahre 1918 erklären, warum weder der Waffenstillstand noch die Verträge einen Schlusspunkt für alle setzen. Gerd Krumeich betont, der Waffenstillstand von Rethondes (in der Nähe von Compiègne)67 habe eher einer bedingungslosen Kapitulation geglichen als einem Waffenstillstand im echten Sinne des Wortes. Klassischerweise war ein Waffenstillstand „eine momentane und gegenseitig vereinbarte Einstellung der Kampfhandlungen, eine Art Waffenruhe, die normalerweise der Erholung und der Wiederherstellung der Mittel der Kriegsparteien dient, dessen Funktion jedoch auch darin bestehen kann, Friedensverhandlungen zu beginnen“68. Obwohl es die Deutschen sind, die aufgrund der militärischen Niederlage den Waffenstillstand verlangen, sind sie kaum in der Position zu verhandeln, nicht mehr übrigens als die Russen ein Jahr zuvor.
Seit dem 29. September und dem Eingeständnis des Scheiterns der großen Offensive sind die deutschen Generäle nicht mehr in der Position der Stärke, um irgendetwas durchzusetzen. Ludendorff selbst forderte die Eröffnung von Waffenstillstandsgesprächen, jedoch unter der Verantwortung einer neuen Regierung und des Parlaments, was es ihm erlaubte, die Verantwortung für die Niederlage auf das Letztere abzuwälzen.
Tatsächlich waren Ludendorff und Hindenburg nicht dazu bereit, sich für besiegt zu erklären und die Verantwortung für den Waffenstillstand auf sich zu nehmen, obwohl sie sie für die militärische Niederlage trugen69.
Der Rücktritt Ludendorffs am 26. Oktober, zwei Tage nachdem er von den deutschen Soldaten unter dem Vorwand, der von den Alliierten vorgeschlagene Frieden sei nicht „ehrenvoll“, die Fortsetzung des Kampfes gefordert hatte – während er gegen Rathenaus Endkampf-Lösung gewesen war –, eröffnet den Weg zum Waffenstillstand. Doch indem der General zurücktrat, bevor er seine Verantwortung für die Niederlage übernehmen musste, gelang ihm ein symbolischer Coup. Im Folgenden suchte er Sündenböcke für die Niederlage und wurde einer der führenden Vertreter der Dolchstoßlegende. Die Tatsache, dass der Waffenstillstand aufgezwungen und nicht ausgehandelt wurde, warfen Ludendorff und seine Freunde nicht nur den Alliierten vor, sondern auch und vielmehr den innenpolitischen Gegnern. Unter diesem Blickwinkel gehört die Geschichte des Waffenstillstands und des Kriegsendes ebenso zur Geschichte des Krieges wie zu jener der Jahre 1918–1933.