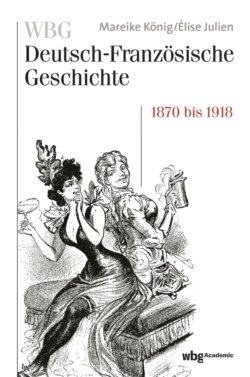Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 21
3.2. Eine deutsch-französische Angelegenheit
ОглавлениеWenn Versailles auch nicht nur eine deutsch-französische Angelegenheit ist, so ist sie es doch in erster Linie. Seine gänzlich symbolische Unterzeichnung am 28. Juni 1919, auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Attentat auf Franz Ferdinand, am selben Ort, an dem das Deutsche Kaiserreich 1871 proklamiert worden war, macht aus dem Versailler Vertrag tatsächlich eine Art Abrechnung zwischen beiden Nationen. Auch Clemenceaus Einladung einer Delegation von Soldaten mit Gesichtsverletzungen zählt zu dieser symbolischen Dimension160. Die Einladung richtet sich sowohl an die Verletzten selbst, denen Clemenceau laut der Zeitung L’Illustration vom 5. Juli 1919 zu verstehen gibt: „Ihr habt gelitten, aber hier ist eure Entschädigung“161, als auch an Deutschland, das damit angeklagt wird, einen die Menschheit verstümmelnden Krieg verursacht und geführt zu haben. Die Akteure der Zeremonie hatten sich nicht getäuscht; ein Journalist des Petit Parisien gab am 30. Juni die Worte eines Verwundeten wider: „Indem die französische Regierung uns ausgewählt hat, demonstrierte sie ihren Willen, den deutschen Delegierten die schmerzhaften Konsequenzen des Krieges zu demonstrieren, den sie verschuldet haben.“162 Stéphane Audoin-Rouzeau betont, dass die fünf gueules cassées (so nannte man in Frankreich die Gesichtsverletzten), deren Gesichtsverletzungen im Spiegelsaal von Versailles vervielfacht widergespiegelt werden, in gewisser Weise den berühmten Paragraphen 231 verkörpern. Gleichzeitig bedeuten sie auch von vornherein, dass die hauptsächlichen Kriegsopfer die Soldaten sind, was nicht ohne Wirkung bleibt in Bezug auf den Platz der zivilen Opfer bei den Anerkennungsmaßnahmen nach dem Krieg.
Bei der Pariser Konferenz und den Verhandlungen zu den Vertragsklauseln gab es bereits direkte Auseinandersetzungen zwischen deutschen und französischen Delegierten, die häufig von den Belgiern unterstützt wurden. Briten und Amerikaner nahmen neben den Gegnern eine moderierende Position ein. Die Verhandlungen ließen sogar neue Risse zwischen den Alliierten erkennen. Die Mehrheit der französischen Politiker hoffte, die deutsche Militärmacht zerstören, ja sogar das Bismarckreich zerschlagen zu können. Aber auch sie stritten sich über die Mittel, um an dieses Ziel zu gelangen. Nachdem sie für eine Annexion des linken Rheinufers eingetreten waren, verhandelten Foch und Weygand im Juni 1918 mit den lokalen Amtsträgern in Baden, Württemberg und Bayern und stachelten bisweilen zur separatistischen Agitation an. Dahinter stand der Versuch, den Süden des Reiches abzutrennen. Diese extreme Sichtweise kollidierte sogar mit Clemenceau, der kaum im Verdacht zärtlicher Gefühle gegenüber Deutschland stand und zusammen mit Tardieu einst versucht hatte, die linke Rheinseite zu annektieren, bevor er im April 1919 auf eine „aktive Rheinlandpolitik“ verzichtete. Dass dies kein definitiver Verzicht war, zeigte die französische Politik gegenüber Deutschland bis zur Ruhrkrise163.
Auf jeden Fall sind sich Zeugen weitgehend einig in der Aussage, dass die Atmosphäre innerhalb der Delegationen und während der Konferenz zumeist scheußlich und chaotisch gewesen sei164. Nach fast vier Monaten Arbeit wurde der Vertragstext den deutschen Delegierten am 7. Mai 1919 feierlich übergeben. Der Leiter der deutschen Delegation, Graf Brockdorff-Rantzau, blieb während der Ansprache bei der Überreichung des Vertragsentwurfs sitzen165. Deutschland sollte demnach ein Siebtel seines Territoriums und ein Zehntel seiner Bevölkerung verlieren. Der Vertrag brachte sogar die Regierung zu Fall. Der neue Kanzler Bauer versuchte noch am 22. Juni, den Paragraphen 231 zu modifizieren, erhielt jedoch als Antwort ein Ultimatum. Falls Deutschland sich weigern sollte zu unterzeichnen, würden die Feindseligkeiten in 24 Stunden wiederaufgenommen. Dieses Ultimatum und der Eindruck, dass die deutschen Delegierten nur sehr wenig auf die Endfassung Einfluss nehmen konnten, bilden den Ursprung des Ausdrucks „Diktat von Versailles“, der sofort überwältigenden Erfolg hatte. Wenn auch der Versailler Vertrag zweifellos ein Frieden der Sieger war, hat der Historiker Hagen Schulze doch recht, wenn er schreibt, dass „die alliierten Staatsmänner erheblich milder gehandelt hatten, als Militärs und die öffentliche Meinung in den Siegerstaaten von ihnen erwartet hatten“166.
Im Sieg noch vereint, sind die Franzosen über und durch die Verträge gespalten, auch wenn nur wenige von ihnen die Verträge als zu hart erachten – die Bruchstelle verläuft zwischen denen, die sie gerecht finden, und denen, die sie als zu konziliant ansehen167. Dieser Bruch verwandelt sich anschließend in eine Trennung zwischen denen, die sich auf die Buchstaben des Vertrages beziehen, und den anderen, die sich auf den Geist des Vertrages berufen, zwischen denen, die eine strikte Anwendung wollen, und jenen, die mehr und mehr Hoffnungen auf eine Befriedung der Beziehungen mit Deutschland setzen, das seinen Status als Feind für den eines Partners aufgeben sollte. Davon ist man 1919 allerdings noch weit entfernt. Trotz der Aufspaltungen und Desillusionierung, die der Vertrag potenziell hervorruft, dominiert zu diesem Zeitpunkt und vor allem direkt nach dem Krieg die Meinung: „Der Deutsche muss zahlen“, und das in jeder Hinsicht168. Der junge Offizier und aus Deutschland zurückgekehrte Gefangene Charles de Gaulle, der am 25. Juni 1919 an seine Mutter schreibt, verkörpert diese Überzeugung sehr gut:
„Hier ist also der unterzeichnete Frieden. Er muss noch vom Feind umgesetzt werden, denn so wie wir ihn kennen, wird er nichts tun, nichts hergeben, nichts zahlen, so dass man ihn zwingen wird, es zu tun, herzugeben, zu zahlen, und dies nicht nur mit Gewalt, sondern auch mit der letzten Brutalität“.169
Auf der anderen Seite des Rheins sind die Deutschen zutiefst durch den Krieg und die Niederlage gespalten, ebenso über den Sinn, den man beiden geben muss. Doch sie finden sich zusammen in einer gemeinsamen Abscheu gegenüber dem „Diktat“, dem „Schandvertrag“. Und auch wenn die Gründe für diese Abscheu nicht immer dieselben sind, ist ihre Intensität doch innerhalb der gesamten Gesellschaft sehr groß170. Jüngste Recherchen haben die starke Verwicklung konservativer Frauenvereinigungen in den militanten Aktivismus gegen den Vertrag und für seine Revision dargelegt; eine militante Haltung, die umso aktiver war, als sie sich von einem Schuldgefühl gegenüber den von den Männern während des Krieges dargebrachten „Opfern“, vom Verlust und der Trauer nährte171. Das soziale Engagement gegen den Vertrag konnte somit eine Form der moralischen Reparation sein.
Diese Einheit im Negativen sollte gleichwohl im Augenblick nicht sehr integrativ wirken, und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft blieb tief, auch wenn die Parteien der Rechten und extremen Rechten sogleich ein Mobilisierungs- und Vereinigungspotential erhielten, das ein Argument für die Revision des Versailler Vertrags sein konnte. Dies findet sich in den ersten beiden Punkten des Programms der NSDAP vom 24. Februar 1920, als diese noch eine Splittergruppe war:
„1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Deutschland.
2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und St. Germain.“
De facto schwappte der Hass auf den Vertrag auf die Republik über, die ihn unter Zwang unterzeichnet hatte: „Versailles stand für die Krankheit der Weimarer Republik, ihre Heilung hieß Revision (…)“172.
Während der Sieg in Frankreich ein Fest gewesen ist – allerdings ein von Trauer überschattetes Fest –, wurde der Versailler Vertrag als ein Minimum betrachtet, über das sich nicht verhandeln ließ; laut einer Reihe von französischen Beobachtern waren bereits während der Verhandlungen zu viele Konzessionen eingeräumt worden. Auch wenn diese gegenüber Briten und Amerikanern gemacht worden waren, so wurden sie doch zugestanden, und es war keine Frage, mit den Deutschen zu verhandeln. Die französische Politik der Unnachgiebigkeit wurde mindestens bis 1924 verfolgt.
Das einzige Element, das am Ende des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit Franzosen und Deutsche hätte zusammenbringen können, waren entgegengesetzte Hoffnungen in den Wilsonismus, die letztlich von kurzer Dauer waren. Die amerikanische Intervention hatte in Frankreich – auf der Linken wie der Rechten – zunächst eine Welle des Enthusiasmus für die Vereinigten Staaten und im Besonderen für die Person und Ideen Wilsons hervorgerufen. Er wurde als Retter, als Sieger und als Visionär in einem angesehen, als Friedensapostel und derjenige, der garantieren sollte, dass der „Krieg von 1914“ wirklich „der letzte der letzten“ war. Bei jeder seiner Reisen nach Frankreich anlässlich der Verhandlungen von 1919 wurde er mit Enthusiasmus begrüßt. Dennoch beabsichtigte die Mehrheit der Franzosen nicht, die allgemeinen Prinzipien Wilsons auf die Besiegten und ganz speziell auf Deutschland anzuwenden. Sie hatten auch nicht vor, die Bevölkerung der verlorenen Provinzen, die wieder ins Staatsgebiet integriert worden waren, einem Referendum zu unterwerfen. Ebenso war die Idee eines Beitritts Deutschlands zum künftigen Völkerbund weit entfernt davon, bei einer Mehrheit Zustimmung zu finden173.
In Deutschland hatten die großzügigen, humanitären und pazifistischen Ideen Präsident Wilsons ebenfalls Hoffnungen geweckt, vor allem das berühmte „Recht der Völker auf Selbstbestimmung“. Zweifellos einigermaßen naiv – oder wohl eher zynisch –, glaubten die öffentliche Meinung und die deutschen Entscheidungsträger, dass diese Prinzipien auch auf Deutschland angewendet und es vor einem „Frieden der Sieger“ bewahren würden. Die Desillusionierung war vielleicht umso stärker, und die Prinzipien Wilsons zur Selbstbestimmung der Völker angewendet auf Deutschland und die Deutschen fanden sich bis zu den Extremisten instrumentalisiert, die am weitesten von den philosophisch-politischen Ansichten Wilsons selbst entfernt waren, wie etwa das bereits erwähnte Programm der NSDAP.
Doch die Ablehnung des Wilsonismus durch die Amerikaner selbst schaffte es, die Ideen Wilsons, oder zumindest das, was von ihnen nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags übrig geblieben war, in Misskredit zu bringen. Der Völkerbund bündelte und trug dennoch weiterhin die Hoffnungen aller aufgeklärten Geister, die vor allem eine mentale Demobilisierung wünschten. 1919 stellten sie sowohl in Deutschland als auch in Frankreich noch eine winzige Minderheit dar174. Gleichwohl lässt sich die Welle des Wilsonismus wie eine Ankündigung einer ähnlichen und parallelen Woge in beiden Ländern lesen, als sich für eine kurze Zeit – zwischen Locarno und dem Briand-Kellogg-Pakt – Vertrauen in den Völkerbund sowie der weitreichende Glaube an Abrüstung, Ablehnung des Krieges als Mittel der Politik, die Möglichkeit eines Friedens und eines mit sich selbst versöhnten Europa entwickelten. Man kann also davon ausgehen, dass der Idealismus Wilsons in gewisser Weise einen zweiten Ausbruch in anderer Form erlebte. 1919 bis 1920 erschien die Politik der Stärke aktueller denn je und die geistige Demobilisierung noch ein frommer Wunsch, auch wenn die kämpfenden Truppen am Arbeitsplatz, auf dem Land oder zu Hause demobilisiert wurden.
149 Für BARIÉTY/POIDEVIN 1977 [434], S. 240, dauerte dieser streng genommen von 1920 bis 1923.
150 BARIÉTY 1977 [430], S. 752.
151 Es gibt eine große Anzahl von Werken und Artikeln über diese Polemik, die den Rahmen dieses Buches sprengen würden. Eine gute Beschreibung findet sich in: JARAUSCH 2003 [98].
152 Zitiert nach SCHULZE 2001 [392], S. 421.
153 Für Frankreich: MIQUEL 1972 [366].
154 CORNELISSEN 2001 [578], S 237.
155 Ebd.
156 SCHULZE 2001 [394].
157 Zum Beispiel die gegensätzlichen Analysen von Keynes und Bainville (HUSSON/TODD 2002 [55]). Siehe auch DEPERCHIN 2001 [311] über die Juristen.
158 KRUMEICH 2001 [348].
159 Ebd., S. 53ff.
160 DELAPORTE 1996 [307]; AUDOIN-ROUZEAU 2001 [263].
161 Zitiert nach ebd., S. 280.
162 Zitiert nach ebd., S. 286.
163 BARIÉTY 1977 [430], S. 46–61; SOUTOU 2004 [665].
164 SHARP 1991 [396], S. 19.
165 Ebd., S. 38.
166 SCHULZE 2001 [394], S. 415.
167 Z. B. Jacques Bainville, in HUSSON/TODD 2002 [55], S. 287–459.
168 MIQUEL 1972 [366].
169 Zitiert nach BAUMANN 2005 [4], S. 100.
170 Zur Haltung der Linken siehe KLEIN 2001 [512], zum bürgerlichen Milieu siehe BARTH 2003 [270], S. 444–465.
171 SÜCHTING-HÄNGER 2001 [547].
172 SCHULZE 2001 [394], S. 417 u. 420.
173 MIQUEL 1972 [366], S. 37–214.
174 HORNE 2000 [501], GUIEU 2006 [792].